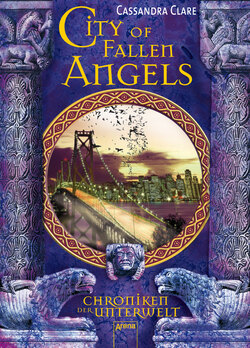Читать книгу City of Fallen Angels - Cassandra Clare - Страница 8
Оглавление3 Siebenfach
»Wisst ihr, was echt cool ist?«, fragte Eric und legte die Drumsticks auf die Snare. »Dass wir jetzt einen Vampir in unserer Band haben. Das wird uns endlich ganz nach oben bringen.«
Kirk ließ das Mikro sinken und verdrehte die Augen. Eric faselte ständig davon, die Band ganz nach oben zu bringen, aber bisher war in dieser Richtung noch nicht viel passiert. Das Beste, was sie bisher geschafft hatten, war ein Auftritt in der Knitting Factory gewesen, zu dem aber nur vier Fans gekommen waren (eigentlich drei, denn Simons Mom konnte man nicht wirklich dazuzählen). »Ich kapier nicht, wie uns das ganz nach oben bringen soll, wenn wir niemand erzählen dürfen, dass er ein Vampir ist.«
»Tja, Pech«, sagte Simon. Er saß auf einem der Lautsprecher, neben Clary, die eifrig SMS-Nachrichten verschickte, vermutlich an Jace. »Außerdem würde uns das sowieso keiner glauben, denn schaut mal her: Hier sitze ich – im hellen Tageslicht.« Er hob die Hände und zeigte auf die Sonnenstrahlen, die durch die Löcher im Dach von Erics Garage fielen, dem derzeitigen Proberaum der Band.
»Das stellt unsere Glaubwürdigkeit wohl tatsächlich infrage«, bemerkte Matt, schob sich die feuerroten Haare aus den Augen und blinzelte in Simons Richtung. »Vielleicht könntest du ja falsche Vampirzähne tragen.«
»Simon braucht keine falschen Vampirzähne«, warf Clary leicht gereizt ein und ließ ihr Handy in den Schoß sinken. »Er hat echte. Ihr habt sie selbst gesehen.«
Das stimmte allerdings. Simon hatte seine Vampirzähne zeigen müssen, als er der Band die Nachricht von seiner Verwandlung mitgeteilt hatte. Anfangs hatten die anderen geglaubt, er hätte eine Kopfverletzung oder einen Nervenzusammenbruch. Erst als er die spitzen Zähne entblößte, hatten sie die Neuigkeit akzeptiert. Eric hatte sogar behauptet, dass ihn das eigentlich nicht sonderlich verwunderte. »Ich hab immer gewusst, dass es Vampire gibt, Alter«, hatte er gesagt. »Weil, na ja, da sind doch diese Leute, die irgendwie immer gleich aussehen, auch wenn sie eigentlich längst hundert sind oder so. Wie David Bowie beispielsweise. Das liegt nur daran, dass das Vampire sind.«
Simon hatte darauf verzichtet, den anderen Bandmitgliedern mitzuteilen, dass Clary und Isabelle Nephilim waren. Schließlich war das ihre Entscheidung, ob sie jemandem davon erzählen wollten oder nicht. Und von Maias Werwolfdasein wussten die anderen auch nichts – sie dachten einfach nur, dass Maia und Isabelle zwei heiße Bräute waren, die aus unerklärlichen Gründen beschlossen hatten, sich mit Simon zu verabreden – was die Jungs auf Simons »sexy Vampir-Mojo« zurückführten, wie Kirk es formuliert hatte. Simon war es im Grunde egal, wie sie es nannten, solange sie sich nicht verplapperten und Maia oder Isabelle von der jeweils anderen erzählten. Bis jetzt war es ihm immer gelungen, sie zu unterschiedlichen Gigs einzuladen, sodass sie nie gemeinsam beim selben Auftritt aufgetaucht waren.
»Vielleicht könntest du deine Vampirzähne ja mal auf der Bühne zeigen?«, schlug Eric nun vor. »Bloß ein einziges Mal, Alter. Nur ganz kurz in Richtung Publikum.«
»Wenn er das täte, würde der Anführer des New Yorker Vampirclans euch alle töten. Das wisst ihr doch wohl, oder?«, fragte Clary, schaute dann zu Simon und schüttelte den Kopf. »Ich kann einfach nicht fassen, dass du ihnen erzählt hast, dass du ein Vampir bist«, sagte sie. Dann fügte sie mit gesenkter Stimme, sodass nur Simon sie hören konnte, hinzu: »Das sind allesamt Deppen, falls du das noch nicht bemerkt haben solltest.«
»Sie sind meine Freunde«, murmelte Simon.
»Sie sind deine Freunde und ausgemachte Deppen.«
»Ich möchte, dass die Leute, an denen mir was liegt, die Wahrheit über mich kennen.«
»Ach ja?«, konterte Clary, nicht besonders freundlich. »Und wann schenkst du deiner Mutter endlich reinen Wein ein?«
Doch bevor Simon etwas erwidern konnte, hämmerte jemand laut gegen das Garagentor und einen Moment später wurde es hochgeschoben. Als warmes Herbstlicht in die Garage fiel, schaute Simon blinzelnd in Richtung des sich öffnenden Tors. Dabei war das Blinzeln nur noch ein Reflex aus seiner Zeit als Mensch, denn im Grunde gewöhnten sich seine Augen im Bruchteil einer Sekunde an Hell und Dunkel.
Im Rahmen des Garagentors, beschienen von hellen Sonnenstrahlen, stand ein junger Mann. Er hielt einen Zettel in der Hand, auf den er jetzt einen unsicheren Blick warf, ehe er wieder zu den anderen schaute. »Hey, Jungs«, sagte er, »bin ich hier richtig bei der Band Dangerous Stain?«
»Wir heißen inzwischen Millennium Link«, erwiderte Eric und ging einen Schritt auf ihn zu. »Aber wer will das wissen?«
»Ich bin Kyle«, erklärte der Junge und tauchte unter dem Garagentor hindurch. Als er sich wieder aufrichtete, warf er seine dunklen Haare, die ihm bis über die Augen fielen, nach hinten und reichte Eric den Zettel. »Ich hab gelesen, ihr seid auf der Suche nach ’nem Leadsänger.«
»Wow!«, staunte Matt. »Das Flugblatt haben wir schon vor einem Jahr verteilt. Das hatte ich komplett vergessen.«
»Ja«, bestätigte Eric. »Damals haben wir völlig anderes Zeug gespielt. Inzwischen haben wir kaum noch Songs mit Vocals. Hast du denn Erfahrung?«
Kyle – der sehr groß, aber alles andere als schlaksig war – zuckte die Achseln. »Nicht wirklich. Aber man hat mir gesagt, ich könnte singen.« Er sprach in einem langsamen, leicht schleppenden Tonfall, der eher nach Kalifornien als nach Südstaaten klang.
Die Mitglieder der Band schauten unentschieden in die Runde und Eric kratzte sich hinter dem Ohr. »Kannst du uns ’ne Minute Zeit geben, Alter?«
»Klar.« Kyle tauchte wieder unter dem Garagentor hindurch und zog es hinter sich zu. Simon konnte ihn draußen pfeifen hören. Die Melodie klang wie »Von den Blauen Bergen kommen wir« und war noch dazu leicht schief.
»Ich weiß nicht so recht«, setzte Eric an. »Ich bin mir nicht sicher, ob wir im Moment irgendjemand Neues gebrauchen können. Weil wir ihm ja wohl kaum von dieser Vampirgeschichte erzählen können, oder?«
»Stimmt«, bestätigte Simon.
»Na, dann…« Matt zuckte die Achseln. »Eigentlich schade. Denn wir brauchen ’nen Sänger. Kirk ist echt beschissen. Nichts für ungut, Kirk.«
»Du kannst mich mal«, schnaubte Kirk. »Ich bin nicht beschissen.«
»Doch, bist du wohl«, erwiderte Matt. »Du bist so mies, dass schlecht gegen dich schon wieder gut ist…«
»Ich denke, ihr solltet ihn einfach mal ausprobieren«, unterbrach Clary die beiden mit erhobener Stimme.
Verwundert starrte Simon sie an. »Warum?«
»Weil er einfach superscharf ist«, erklärte Clary zu Simons Überraschung. Kyles Äußeres hatte ihn zwar nicht direkt umgehauen, aber schließlich war er auch nicht unbedingt der Fachmann, wenn es um männliche Schönheit ging. »Und eure Band kann etwas Sexappeal gut gebrauchen«, fügte Clary hinzu.
»Vielen Dank«, bemerkte Simon. »Im Namen aller Bandmitglieder: Herzlichen Dank auch.«
Clary schnaubte ungeduldig. »Jaja, ihr seid alle gut aussehende Jungs. Vor allem du, Simon.« Sie tätschelte ihm die Hand. »Aber Kyle ist richtig scharf, im Sinne von ›Wow, ist der heiß‹. Ich sag’s ja nur. Meine unparteiische Meinung als Frau lautet: Wenn ihr Kyle in die Band aufnehmt, werdet ihr die Anzahl eurer weiblichen Fans verdoppeln.«
»Was bedeuten würde, wir hätten schon zwei«, spottete Kirk.
»Wir haben einen weiblichen Fan? Wen denn?« Matt wirkte richtig neugierig.
»Die Freundin von Erics kleiner Cousine. Wie heißt sie noch mal? Die, die in Simon verknallt ist. Sie kommt zu all unseren Auftritten und erzählt Jan und jedermann, sie sei seine Freundin.«
Simon zuckte bestürzt zusammen. »Sie ist dreizehn!«
»Das liegt an deinem sexy Vampir-Mojo, Mann«, verkündete Matt. »Dem können die Ladys einfach nicht widerstehen.«
»Herrgott noch mal«, stöhnte Clary. »So etwas wie ein sexy Vampir-Mojo gibt es nicht.« Dann zeigte sie mit dem Finger auf Eric. »Und komm nicht auf die Idee, Sexy Vampir-Mojo wäre ein prima Bandname, sonst vergess ich mich und…«
Im selben Moment schwang das Garagentor wieder hoch. »Äh, Leute?«, meldete Kyle sich zu Wort. »Hört mal, wenn ihr mich nicht testen wollt – kein Problem. Vielleicht habt ihr ja euren Sound geändert oder was auch immer. Ihr braucht nur was zu sagen und schon bin ich weg.«
Eric neigte den Kopf leicht zur Seite. »Komm rein und lass dich mal ansehen.«
Als Kyle die Garage betrat, musterte Simon ihn von Kopf bis Fuß, um herauszufinden, weshalb Clary ihn als scharf bezeichnet hatte. Der Junge war groß, breitschultrig und schlank und hatte hohe Wangenknochen, lange schwarzbraune Locken, die ihm in die Stirn und bis in den Nacken hingen, und eine gebräunte Haut, die ihre sommerliche Tönung noch nicht verloren hatte. Die langen, dichten Wimpern um seine verblüffend grünbraunen Augen ließen ihn wie einen Teenie-Rockstar wirken. Er trug Jeans und ein enges grünes T-Shirt und um seine nackten Oberarme wanden sich verschlungene Tattoos – keine Runenmale, sondern ganz normale Tätowierungen. Sie erinnerten an eine gewundene Schrift, die sich über seine Haut zog und unter dem Ärmel seines T-Shirts verschwand.
Okay, er war nicht unbedingt abstoßend, musste Simon sich eingestehen.
»Wisst ihr, was?«, sagte Kirk schließlich und durchbrach damit das Schweigen. »Ich verstehe, was Clary meint. Er ist tatsächlich ziemlich scharf.«
Kyle blinzelte verwundert und wandte sich dann an Erik: »Also, soll ich nun vorsingen oder nicht?«
Eric nahm das Mikro vom Ständer und gab es ihm. »Dann mal los«, sagte er. »Lass mal hören, was du draufhast.«
»Kyle war richtig gut«, sinnierte Clary. »Eigentlich hatte ich das ja nur im Scherz gesagt, dass ihr ihn in eure Band aufnehmen sollt, aber er kann tatsächlich singen.«
Sie spazierten durch die Kent Avenue in Richtung von Lukes Haus. Der Abendhimmel hatte inzwischen seine Farbe gewechselt – von einem dunklen Blau zu Grau – und tiefe Wolken hingen über dem East River. Clary streifte mit dem Handschuh über den Maschendrahtzaun, der die Straße von dem brüchigen, betonierten Flussufer trennte, und die Berührung ließ das Metall rasseln.
»Das sagst du doch nur, weil du ihn scharf findest«, warf Simon ein.
Clary grinste so breit, dass ihre Grübchen zum Vorschein kamen. »So scharf nun auch wieder nicht. Jedenfalls nicht wie der schärfste Typ, den ich je gesehen habe.«
Bei dem es sich ja wohl nur um Jace handeln konnte, überlegte Simon. Allerdings war sie so freundlich, es nicht laut auszusprechen.
»Aber ich glaube wirklich, es wäre eine gute Idee, ihn in die Band aufzunehmen. Ehrlich. Denn wenn Eric und die anderen ihm nicht sagen können, dass du ein Vampir bist, dann können sie es auch keinem anderen erzählen. Und hoffentlich ist dann endlich Schluss mit dieser blöden Idee.«
Inzwischen hatten sie Lukes Haus fast erreicht. Simon konnte es auf der gegenüberliegenden Straßenseite sehen: Die hell erleuchteten Fenster sandten einen warmen gelblichen Schein in die aufkommende Dunkelheit.
Plötzlich blieb Clary bei einem Loch im Zaun stehen. »Weißt du noch, wie wir hier einen Haufen Raumdämonen getötet haben?«
»Du und Jace habt sie getötet. Ich dagegen musste mich fast übergeben.« Simon erinnerte sich zwar, war aber nicht ganz bei der Sache. Seine Gedanken wanderten immer wieder zu Camille, wie sie am Rand der Gartenterrasse gesessen und ihn belehrt hatte: Du bist mit den Schattenjägern befreundet, aber du kannst niemals einer der ihren sein. Du wirst immer anders sein, immer ein Außenseiter bleiben. Er warf Clary einen raschen Seitenblick zu und fragte sich, was sie wohl sagen würde, wenn er ihr von dem Treffen mit der Vampirdame erzählte und von ihrem Angebot. Vermutlich wäre Clary total entsetzt. Die Tatsache, dass er nicht verletzt werden konnte, hinderte sie nicht daran, sich noch immer Sorgen um seine Sicherheit zu machen.
»Heute würdest du keine Angst haben«, sagte sie leise, als hätte sie seine Gedanken gelesen. »Denn heute hast du das Runenmal.« Sie drehte sich zu ihm, noch immer leicht gegen den Zaun gelehnt. »Hat irgendjemand es schon mal bemerkt oder dich danach gefragt?«
Simon schüttelte den Kopf. »Meistens hängen meine Haare darüber und außerdem ist es inzwischen ziemlich verblasst. Sieh mal.« Er schob seine Haare beiseite.
Clary streckte eine Hand aus und berührte seine Stirn mit dem geschwungenen Mal. Ihre Augen besaßen einen traurigen Ausdruck, so wie an jenem Tag in der Halle des Abkommens in Alicante, wo sie den ältesten Fluch der Welt in seine Haut geritzt hatte. »Und, tut es weh?«
»Nein. Nein, es tut nicht weh.« Und Kain sprach zu Jehova: Zu groß ist meine Strafe, um sie zu tragen. »Du weißt doch, dass ich dir keinen Vorwurf mache, oder? Schließlich hast du mir damit das Leben gerettet.«
»Ich weiß.« Ihre Augen glitzerten. Rasch strich sie sich mit dem Handrücken übers Gesicht. »Verdammt. Ich hasse es zu weinen.«
»Na, dann gewöhn dich besser mal dran«, erwiderte Simon. Als Clary ihn mit großen Augen fragend ansah, fügte er hastig hinzu: »Ich meinte die Hochzeit. Die ist doch nächsten Samstag, oder? Und bei Hochzeiten brechen schließlich alle ständig in Tränen aus.«
Clary schnaubte.
»Wie geht’s eigentlich Luke und deiner Mom?«, fragte Simon.
»Sie sind total verliebt… ist schon fast widerwärtig. Na ja, wie auch immer…« Clary tätschelte seine Schulter. »Ich sollte jetzt besser reingehen. Sehn wir uns morgen?«
Simon nickte. »Klar. Morgen.«
Er schaute ihr nach, als sie über die Straße lief und dann die Stufen zu Lukes Haustür hinaufsprang. Morgen. Er fragte sich, wie lange es her war, dass er Clary mal über mehrere Tage lang nicht gesehen hatte, und wie es wohl sein würde, unstet und flüchtig auf Erden zu wandeln, wie Camille es ihm prophezeit hatte. Und auch Raphael. Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Erdboden her. Er war zwar nicht Kain, der seinen eigenen Bruder erschlagen hatte, aber der Fluch machte ihn dafür verantwortlich. Irgendwie war es seltsam, überlegte Simon, darauf zu warten, alles zu verlieren, aber nicht zu wissen, ob das jemals eintreffen würde oder nicht.
Die Haustür fiel hinter Clary ins Schloss. Simon machte auf dem Absatz kehrt und marschierte die Kent Avenue entlang in Richtung der U-Bahn-Haltestelle an der Lorimer Street. Inzwischen war es fast vollständig dunkel geworden und der Himmel über Simons Kopf wirkte wie eine wirbelnde Masse aus Schwarz und Grau. Plötzlich hörte er, wie hinter ihm auf der Straße Reifen quietschten, doch er schaute sich nicht um. In dieser Gegend wurde ständig zu schnell gefahren, trotz der Risse und Schlaglöcher im Straßenbelag. Erst als der blaue Lieferwagen neben ihm vorfuhr und knirschend zum Stehen kam, drehte Simon sich zu dem Wagen.
Der Fahrer riss den Schlüssel aus dem Zündschloss, woraufhin der Motor erstarb, und stieß seine Tür auf. Es handelte sich um einen Mann, einen großen Mann in Turnschuhen und einem grauen Trainingsanzug mit Kapuze, die so tief heruntergezogen war, dass sie den größten Teil seines Gesichts verdeckte. Er sprang vom Fahrersitz herunter und Simon sah, dass er ein langes schimmerndes Messer in der Hand hielt.
Später sollte Simon zum Schluss kommen, dass er einfach hätte weglaufen sollen. Schließlich war er ein Vampir und damit schneller als jeder Mensch: Er konnte jeden Sterblichen mühelos hinter sich lassen. Er hätte wirklich davonlaufen sollen, doch er war zu überrascht. Also stand er nur stocksteif da, als der Mann mit dem glitzernden Messer auf ihn zukam. Dann stieß der Angreifer mit tiefer, kehliger Stimme ein paar Worte hervor, in einer fremden Sprache, die Simon nicht verstand.
Simon wich einen Schritt zurück. »Ganz ruhig, Mann«, setzte er an und griff zu seiner Gesäßtasche. »Du kannst mein Portemonnaie ja haben…«
Doch der Mann stürzte auf ihn zu, die Waffe auf seine Brust gerichtet. Ungläubig schaute Simon an sich herab: Alles schien sehr langsam, wie in Zeitlupe zu passieren. Er sah die Spitze der Klinge auf seiner Brust, sah, wie sie das Leder seiner Jacke eindrückte… und dann zur Seite glitt, als hätte jemand den Arm des Angreifers gepackt und weggerissen. Im nächsten Moment schrie der Mann laut auf und wurde wie eine Marionette an ihren Drähten in die Luft gewirbelt. Hastig schaute Simon sich um – irgendjemand musste den ganzen Tumult doch gehört oder bemerkt haben, aber weit und breit war niemand zu sehen. Der Mann schrie weiterhin wie am Spieß und zuckte und zappelte, während sein T-Shirt vorne aufklaffte, als würde das Gewebe von unsichtbaren Händen zerrissen.
Entsetzt starrte Simon auf das Geschehen. Tiefe Wunden erschienen auf dem Oberkörper des Mannes. Sein Kopf flog nach hinten und Blut schoss aus seinem Mund. Seine Schreie verstummten schlagartig und dann stürzte er zu Boden – als hätte die unsichtbare Hand sich geöffnet und ihn freigegeben. Mit einem dumpfen Dröhnen schlug er auf dem Pflaster auf und zerschellte dann wie Glas in Tausende glitzernde Partikel, die sich über den Gehweg verteilten.
Simon sank auf die Knie. Das Messer, das ihn hatte töten sollen, lag nur wenige Schritte entfernt – das Einzige, was von dem Angreifer noch übrig geblieben war, abgesehen von einem Haufen schimmernder Kristalle, die der böige Wind bereits in alle Himmelsrichtungen zerstreute. Vorsichtig berührte Simon eines der Körnchen. Es war Salz.
Simon schaute auf seine Hände herab. Sie zitterten. Er wusste, was passiert war und auch warum.
Da sprach der HERR: Fürwahr, wer Kain totschlägt, zieht sich siebenfache Rache zu!
So sah also siebenfache Rache aus.
Er schaffte es gerade noch bis zum Rinnstein, ehe er sich auch schon zusammenkrümmte und sich blutig auf die Straße erbrach.
In dem Moment, in dem Simon die Haustür öffnete, wusste er, dass er sich verschätzt hatte. Er hatte gedacht, seine Mutter schliefe längst, aber das war nicht der Fall. Sie saß hellwach im Flur, in einem Sessel, der zur Tür gewandt war, das Telefon neben sich auf einem Tischchen. Und das Blut auf seiner Jacke sah sie sofort.
Zu seiner Überraschung schrie sie nicht auf, sondern schlug nur erschrocken eine Hand vor den Mund: »Simon!«
»Das ist nicht mein Blut«, erklärte er hastig. »Ich war bei Eric… und Matt hatte Nasenbluten…«
»Spar dir die Mühe.« Einen derart harschen Ton schlug sie nur selten an – er erinnerte Simon an die Zeit, als sein Vater im Sterben gelegen hatte und Sorgen und Angst die Stimme seiner Mutter scharf wie ein Messer hatten klingen lassen. »Ich will mir keine weiteren Lügen von dir anhören.«
Simon legte den Hausschlüssel auf den Tisch neben der Tür. »Mom…«
»Du erzählst mir nichts als Märchen. Ich bin es endgültig leid.«
»Das stimmt doch gar nicht«, widersprach Simon, aber er wusste, dass sie recht hatte, und verspürte einen Stich im Magen. »Ich hab im Moment einfach nur furchtbar viel zu tun.«
»Das kann ich mir vorstellen.« Seine Mutter erhob sich aus dem Sessel; sie war schon immer sehr dünn gewesen, doch jetzt wirkte sie regelrecht hager und ihre dunklen Haare waren von deutlich mehr grauen Strähnen durchzogen, als er in Erinnerung hatte. »Komm mal mit, junger Mann. Und zwar sofort.«
Verwirrt folgte Simon ihr in die kleine, leuchtend gelbe Küche, wo seine Mutter abrupt stehen blieb und auf die Küchentheke zeigte. »Kannst du mir das mal erklären?«
Simon bekam mit einem Mal einen trockenen Mund. Auf der Theke standen wie Zinnsoldaten die Flaschen mit Blut aufgereiht, die er in seinem Mini-Kühlschrank in den Tiefen seines Kleiderschranks aufbewahrt hatte. Eine war halb leer, die anderen noch bis zum Rand gefüllt; die rote Flüssigkeit darin schimmerte anklagend. Seine Mutter hatte außerdem die Blutbeutel gefunden, die er ausgespült und sorgfältig in eine Plastiktüte gestopft hatte, ehe er sie in der Mülltonne versenkt hatte. Auch sie lagen ausgebreitet auf der Küchentheke wie eine groteske Dekoration.
»Ich hab erst gedacht, das wäre Wein«, sagte Elaine Lewis mit zittriger Stimme. »Aber dann habe ich die Beutel gefunden. Also habe ich eine der Flaschen geöffnet. Das ist Blut. Stimmt’s?«
Simon schwieg. Scheinbar hatte er seine Stimme verloren.
»In letzter Zeit hast du dich sehr merkwürdig verhalten«, fuhr seine Mutter fort. »Du bleibst bis tief in die Nacht fort, isst nichts, schläfst kaum, triffst dich mit Freunden, die ich nicht kenne, von denen ich noch nicht einmal gehört habe. Glaubst du wirklich, ich merke es nicht, wenn du mich belügst? Das tue ich sehr wohl, Simon. Anfangs hab ich gedacht, du würdest vielleicht Drogen nehmen.«
Plötzlich fand Simon seine Stimme wieder: »Dann hast du also mein Zimmer durchsucht?«
Seine Mutter errötete. »Das musste ich doch! Ich dachte… ich dachte, wenn ich dort Drogen finde, dann könnte ich dir helfen… dich vielleicht in einem Entzugsprogramm unterbringen. Aber das hier?« Aufgebracht zeigte sie auf die Flaschen. »Ich weiß ja nicht einmal, was ich davon halten soll. Was geht hier vor, Simon? Hast du dich irgendeiner Sekte angeschlossen?«
Simon schüttelte den Kopf.
»Dann erzähl es mir«, sagte seine Mutter mit bebender Unterlippe. »Denn die einzigen Erklärungen, die mir selbst einfallen, sind alle grässlich und pervers. Bitte, Simon…«
»Ich bin ein Vampir«, erwiderte Simon. Er hatte keine Ahnung, wie er das gesagt hatte oder warum. Aber jetzt war es heraus. Die Worte hingen wie eine Giftwolke zwischen ihnen in der Luft.
Seiner Mutter schienen die Knie zu versagen und sie sank auf einen der Küchenstühle. »Was hast du gerade gesagt?«, hauchte sie fassungslos.
»Ich bin ein Vampir«, wiederholte Simon. »Schon seit etwa zwei Monaten. Tut mir leid, dass ich es dir nicht schon eher gesagt habe, aber ich wusste einfach nicht, wie.«
Elaine Lewis war kreidebleich im Gesicht. »Es gibt keine Vampire, Simon.«
»Doch«, widersprach er, »es gibt sie sehr wohl. Hör zu, Mom, ich hab nicht darum gebeten, in einen Vampir verwandelt zu werden. Ich bin angegriffen worden; ich hatte keine Chance. Wenn ich könnte, würde ich es sofort rückgängig machen.« Seine Gedanken kehrten zu der Broschüre zurück, die ihm Clary vor so langer Zeit in die Hand gedrückt hatte – das Infoblatt zum Thema »Wie oute ich mich gegenüber meinen Eltern«. Damals hatte er den Vergleich lustig gefunden, doch inzwischen war ihm das Lachen vergangen.
»Du glaubst nur, du wärst ein Vampir«, sagte Simons Mutter benommen. »Du glaubst, du würdest Blut trinken.«
»Nein, ich trinke tatsächlich Blut. Tierblut«, erklärte Simon.
»Aber du bist doch Vegetarier.« Seine Mutter sah aus, als würde sie mit den Tränen kämpfen.
»Das war ich mal. Aber jetzt nicht mehr. Weil das nicht mehr möglich ist: Blut ist das Einzige, was mich am Leben hält.« Simon spürte einen Kloß im Hals. »Ich habe noch nie jemandem wehgetan. Und ich würde niemals das Blut eines anderen Menschen trinken. Ich bin immer noch dieselbe Person. Ich bin immer noch ich.«
Seine Mutter schien um Fassung zu ringen. »Deine neuen Freunde… sind das auch Vampire?«
Simon dachte an Isabelle, Maia, Jace. Er konnte seiner Mutter unmöglich die Existenz von Schattenjägern und Werwölfen erklären. Es wäre einfach zu viel gewesen. »Nein, aber sie wissen, dass ich einer bin«, erwiderte er bedächtig.
»Haben… haben sie dir Drogen gegeben? Haben sie dich gezwungen, etwas einzunehmen? Etwas, das Halluzinationen hervorruft?« Sie schien seine Antwort kaum wahrgenommen zu haben.
»Nein. Mom, das hier ist die Realität.«
»Das ist nicht die Realität«, wisperte sie. »Du glaubst nur, es wäre real. Oh, Gott. Simon. Es tut mir so leid. Ich hätte etwas bemerken müssen. Wir werden dir Hilfe besorgen. Wir werden irgendjemanden finden, der dich behandeln kann. Ein Arzt. Ganz egal, was es kostet…«
»Mom, ich kann zu keinem Arzt gehen.«
»Doch, natürlich kannst du das. Du musst irgendwo untergebracht werden. Vielleicht in einem Krankenhaus…«
Ruhig streckte Simon ihr seine Hand entgegen. »Fühl mal meinen Puls«, sagte er.
Verwirrt schaute sie ihn an. »Wie bitte?«
»Mein Puls«, wiederholte er. »Fühl ihn. Wenn ich einen Herzschlag habe, werde ich mit dir zum Krankenhaus fahren. Wenn aber nicht, dann musst du mir einfach glauben.«
Elaine Lewis wischte sich die Tränen aus den Augen und griff zögerlich nach Simons Handgelenk. Nachdem sie Simons Vater über so lange Zeit gepflegt hatte, wusste sie so gut wie jede Krankenschwester, wie sie den Pulsschlag überprüfen musste: Sie drückte die Kuppe ihres Zeigefingers gegen die Innenseite seines Handgelenks und wartete.
Simon sah zu, wie sich der Ausdruck auf ihrem Gesicht veränderte – von Kummer und Sorge zu Verwirrung und dann zu schierem Entsetzen. Sie sprang auf, ließ seine Hand fallen und wich vor ihm zurück. Ihre Augen wirkten riesig und dunkel in ihrem kreidebleichen Gesicht. »Was bist du?«, stieß sie hervor.
Simon fühlte sich elend. »Das hab ich doch schon erklärt. Ich bin ein Vampir.«
»Du bist nicht mein Sohn. Du bist nicht Simon.« Seine Mutter zitterte am ganzen Körper. »Welche Sorte von Lebewesen hat denn keinen Puls? Was für eine Art von Monster bist du? Was hast du mit meinem Kind gemacht?«
»Mom, ich bin’s, Simon…« Zaghaft ging er einen Schritt auf sie zu.
Doch seine Mutter stieß einen Schrei aus. Nie zuvor hatte Simon sie so kreischen gehört und er hoffte, dass er das auch nie wieder erleben musste. Es war ein grauenhafter Schrei.
»Geh weg!« Ihre Stimme brach. »Komm ja nicht näher.« Und dann wisperte sie: »Barukh atah Adonaj shome’a Tfilah…«
Mit einem Schlag wurde Simon klar, dass sie ein Gebet haspelte. Sie fürchtete sich so sehr vor ihm, dass sie betete, er möge verschwinden… für immer verbannt werden. Und das Schlimmste daran war, dass er es förmlich spüren konnte. Der Name Gottes bereitete ihm ein mulmiges Gefühl im Magen und ließ seine Kehle brennen.
Sie hatte allen Grund zu beten, dachte er, bis ins Mark erschüttert. Denn er war verflucht. Er gehörte nicht in diese Welt. Welche Sorte von Lebewesen hat denn keinen Puls?
»Mom«, wisperte er. »Mom, hör auf.«
Mit großen Augen schaute sie ihn an, während ihre Lippen sich weiterhin bewegten.
»Mom, du brauchst dich nicht aufzuregen.« Simon hörte seine eigene Stimme wie aus weiter Ferne, sanft und beruhigend – die Stimme eines Fremden. Er schaute ihr direkt in die Augen, während er mit ihr sprach, und hielt sie durch den engen Blickkontakt gefangen, so wie eine Katze eine Maus hypnotisiert. »Es ist nichts passiert. Du bist in deinem Sessel im Wohnzimmer eingeschlafen. Und du hattest einen Albtraum. Du hast geträumt, ich wäre nach Hause gekommen und hätte behauptet, ich sei ein Vampir. Aber das ist natürlich Unsinn. So etwas würde niemals geschehen.«
Seine Mutter hatte aufgehört zu beten, blinzelte nun einmal und starrte ihn gebannt an. »Ich träume«, wiederholte sie.
»Ja, ein schlechter Traum«, bestätigte Simon, ging langsam auf sie zu und legte ihr eine Hand auf die Schulter. Dieses Mal wich sie nicht zurück; stattdessen sackte ihr Kopf nach vorn, wie bei einem müden Kind. »Alles nur ein Traum. Du hast in meinem Zimmer rein gar nichts gefunden. Es ist nichts passiert. Du hast einfach nur geschlafen, das ist schon alles.«
Behutsam nahm er ihre Hand. Widerstandslos ließ sie sich von ihm ins Wohnzimmer führen, wo er sie sanft in einen Sessel drückte. Sie lächelte, als er ihr eine Decke über die Beine legte, und schloss dann die Augen.
Simon kehrte in die Küche zurück und stopfte die Flaschen und leeren Blutbeutel schnell und methodisch in einen Müllbeutel, den er zuknotete und mit in sein Zimmer nahm. Dort wechselte er seine blutbespritzte Jacke rasch gegen eine saubere aus und warf ein paar Klamotten in eine Reisetasche. Dann schaltete er das Licht aus und zog die Zimmertür hinter sich zu.
Als er das Wohnzimmer betrat, schlief seine Mutter bereits tief und fest. Vorsichtig streckte er seine Finger aus und berührte sie leicht an der Hand.
»Ich werde für ein paar Tage fort sein«, wisperte er. »Aber du wirst dir keine Sorgen machen. Denn du erwartest mich nicht so bald zurück. Du glaubst, ich bin auf einem Schulausflug. Es besteht kein Grund, mich anzurufen. Alles ist in bester Ordnung«, fügte er hinzu und zog seine Hand fort.
Im schwachen Licht des Wohnzimmers erschien seine Mutter zugleich älter und jünger als zuvor. Tief unter die Decke gekuschelt, wirkte sie so klein wie ein Kind, aber auf ihrem Gesicht zeichneten sich mehr Falten ab, als er jemals an ihr gesehen hatte.
»Mom«, flüsterte er.
Erneut berührte er ihre Hand, woraufhin sie sich unter der Decke regte. Da er sie nicht wecken wollte, zog er seine Finger hastig zurück. Dann ging er lautlos zur Haustür und nahm seine Schlüssel von dem kleinen Tisch, ehe er die Tür leise hinter sich ins Schloss zog.
Im Institut herrschte Stille. Neuerdings war es hier immer so still. Jace hatte sich angewöhnt, mit offenem Fenster zu schlafen, sodass der gedämpfte Lärm des Straßenverkehrs, die gelegentliche Blaulichtsirene eines Krankenwagens und das Hupen der Fahrzeuge auf der York Avenue zu ihm ins Zimmer wehten. Aber er konnte auch Dinge hören, die Irdische nicht wahrnahmen, und diese Dinge drangen durch die Nacht und bis in seine Träume – der Luftstrom eines fliegenden Vampirmotorrads, das Flattern von Elbenschwingen, das weit entfernte Heulen von Wölfen bei Vollmond.
Im Augenblick hing allerdings nur eine breite Mondsichel am Himmel und warf gerade genug Licht, dass Jace in ihrem schwachen Schein lesen konnte. Er lag auf dem Bett, das Silberkästchen seines Vaters aufgeklappt vor sich, und sichtete den Inhalt. Eine der Stelen, die einst seinem Vater gehört hatten, lag darin, daneben ein silberbeschlagener Jagddolch mit den Initialen SWH auf dem Griff und ein Stapel Briefe – die Jace ganz besonders interessierten.
Im Laufe der vergangenen sechs Wochen hatte er es sich zur Gewohnheit gemacht, jeden Abend einen oder zwei Briefe zu lesen, in der Hoffnung, ein Gefühl für den Mann zu bekommen, der sein biologischer Vater gewesen war. Vor seinem inneren Auge hatte sich allmählich ein Bild geformt – das Bild eines nachdenklichen jungen Mannes mit ehrgeizigen Eltern, der sich zu Valentin und seinen Gefolgsleuten hingezogen fühlte, weil sie ihm scheinbar die Gelegenheit boten, sich vor der Welt zu beweisen. Stephen Herondale hatte Amatis selbst nach der Scheidung noch geschrieben – ein Umstand, den sie mit keinem Wort erwähnt hatte. In diesen Briefen kam seine Enttäuschung über Valentin und seine Ablehnung gegenüber den Aktivitäten des Kreises deutlich zum Ausdruck; allerdings erwähnte er Jace’ Mutter, Celine, nur selten, wenn überhaupt. Was in gewisser Weise nur logisch war – schließlich hatte Amatis wohl kaum Neuigkeiten über ihre Nachfolgerin hören wollen. Und dennoch konnte Jace nicht anders, als seinen Vater dafür ein wenig zu hassen. Wenn ihm seine Mutter gleichgültig gewesen war, warum hatte er sie dann überhaupt geheiratet? Wenn er den Kreis so sehr verabscheut hatte, warum war er dann nicht ausgetreten? Valentin war zwar ein Irrer gewesen, aber zumindest hatte er zu seinen Prinzipien gestanden.
Doch diese Gedanken sorgten nur dafür, dass Jace sich noch schlechter fühlte, weil er Valentin seinem richtigen Vater vorzog. Was machte das für einen Menschen aus ihm?!
Ein leises Pochen an der Tür riss ihn aus seinen Selbstzerfleischungen. Er rappelte sich auf und durchquerte den Raum, in der Erwartung, Isabelle im Flur vorzufinden, die mal wieder irgendetwas von ihm leihen oder sich über irgendetwas beschweren wollte.
Aber vor der Tür stand nicht Isabelle, sondern Clary.
Sie trug andere Kleidung als üblich: ein tief ausgeschnittenes schwarzes Trägertop, darüber eine weiße, locker zusammengeknotete Bluse und einen kurzen Rock – kurz genug, dass die Kurven ihrer Beine bis zum Oberschenkel sichtbar waren. Ihr leuchtend rotes Haar hatte sie zu Zöpfen geflochten, wobei sich ein paar Strähnen gelöst hatten und sich auf Höhe der Schläfen kringelten, als hätte es draußen genieselt. Als sie ihn sah, lächelte sie und hob ihre gewölbten Augenbrauen, die in einem warmen Kupferton schimmerten – genau wie die feinen Wimpern, die ihre grünen Augen umsäumten.
»Willst du mich nicht reinlassen?«, fragte sie.
Jace warf rasch einen Blick in den Flur, aber weit und breit war niemand zu sehen. Gott sei Dank. Er nahm Clary am Arm, zog sie in sein Zimmer und schloss die Tür. Dann lehnte er sich mit dem Rücken dagegen und fragte: »Was tust du hier? Ist alles in Ordnung?«
»Alles in bester Ordnung.« Clary kickte die Schuhe von den Füßen und ließ sich auf der Bettkante nieder. Als sie sich zurücklehnte und auf die Hände stützte, rutschte der Saum ihres Rocks nach oben und zeigte noch mehr Bein als zuvor – was für Jace’ Konzentration nicht gerade förderlich war. »Du hast mir gefehlt«, fügte sie hinzu. »Und Mom und Luke schlafen tief und fest. Sie werden gar nicht merken, dass ich mich aus dem Haus geschlichen habe.«
»Du solltest besser nicht hier sein«, presste Jace hervor; die Worte klangen fast gequält. Er hasste sich dafür, doch er wusste, dass sie gesagt werden mussten – aus Gründen, die Clary nicht einmal kannte. Und die sie hoffentlich nie erfahren würde.
»Okay, wenn du willst, dass ich gehe…« Clary erhob sich. Ihre Augen schimmerten grün. Dann trat sie einen Schritt näher. »Aber ich bin den ganzen weiten Weg hierhergekommen. Du könntest mir wenigstens einen Abschiedskuss geben.«
Sofort streckte Jace die Arme nach ihr aus, zog sie an sich und küsste sie. Es gab nun mal ein paar Dinge, die man einfach tun musste, auch wenn das Ganze keine gute Idee war. Clary schmiegte sich an ihn wie feine Seide. Er schob seine Hände in ihre Haare und löste die Zöpfe, bis ihre Locken weich über die Schultern fielen – so wie er es mochte. Er erinnerte sich, dass er dies schon bei ihrer ersten Begegnung hatte tun wollen und den Gedanken dann als vollkommen verrückt abgetan hatte: Sie war eine Irdische, eine Fremde; es ergab überhaupt keinen Sinn, sie zu begehren. Und dann hatte er sie zum ersten Mal geküsst, damals im Gewächshaus, und dieser Kuss hatte ihn fast umgehauen. Anschließend waren sie nach unten gegangen und kurz darauf von Simon unterbrochen worden. In seinem ganzen Leben hatte Jace niemanden mehr umbringen wollen als Simon in jenem Moment, obwohl er verstandesmäßig genau wusste, dass Simon nichts Falsches getan hatte. Aber seine Gefühle hatten nichts mit seinem Verstand zu tun, und als er sich vorstellte, wie Clary ihn für Simon verließ, hatte der Gedanke ihn fast in den Wahnsinn getrieben und ihm mehr Angst eingejagt als jeder Dämon.
Und dann hatte Valentin ihnen erzählt, sie seien Bruder und Schwester, und Jace hatte erkannt, dass es viel schlimmere, unendlich viel schlimmere Dinge gab, als von Clary für jemand anderen verlassen zu werden – nämlich das Wissen, dass seine Liebe zu ihr auf schreckliche Weise unermesslich falsch war: Der scheinbar reinste und makelloseste Aspekt in seinem Leben war plötzlich unrettbar entweiht. Er erinnerte sich an die Worte seines Vaters: Wenn Engel fallen, dann fallen sie unter Qualen, denn sie haben das Antlitz Gottes gesehen und werden es nie mehr zu Gesicht bekommen. Und damals hatte er genau gewusst, was Engel in diesem Moment fühlten.
Aber das hatte nicht dazu geführt, dass er Clary weniger begehrte; es hatte seine Sehnsucht nach ihr nur zu einer Qual gemacht. Manchmal legte die Erinnerung an diese Tortur sich wie ein dunkler Schatten auf sein Gemüt – selbst wenn er sie küsste, so wie jetzt – und weckte in ihm das Bedürfnis, sie noch fester an sich zu drücken. Clary machte einen überraschten Laut, protestierte aber nicht, als er sie hochhob und zu seinem Bett trug.
Gemeinsam fielen sie darauf und zerknitterten dabei ein paar der verstreuten Briefe, während Jace das Kästchen von der Bettdecke fegte, um Platz für sie zu schaffen. Sein Herz wummerte wie wild in seinem Brustkorb. Nie zuvor hatten sie auf diese Weise gemeinsam im Bett gelegen. Natürlich war da jene Nacht in Idris gewesen, aber damals hatten sie sich kaum berührt. Jocelyn achtete sorgsam darauf, dass keiner der beiden beim jeweils anderen die Nacht verbrachte. Sie mochte ihn nicht besonders, vermutete Jace, und er konnte es ihr nicht verübeln. Wenn er an ihrer Stelle gewesen wäre, hätte er sich selbst wahrscheinlich auch nicht sonderlich ins Herz geschlossen.
»Ich liebe dich«, wisperte Clary. Sie hatte ihm das T-Shirt über den Kopf gestreift und fuhr mit den Fingerspitzen über die Narben auf seinem Rücken und das sternförmige Mal an seiner Schulter – ein Abbild ihres eigenen Mals und Erinnerung an den Engel, dessen Blut durch ihrer beider Adern floss. »Ich möchte dich nicht verlieren.«
Jace schob seine Hand nach unten, um den Knoten in ihrer Bluse zu lösen. Seine andere Hand, mit der er sich auf der Matratze abstützte, streifte das kalte Metall des Jagddolches – die Waffe musste sich mit dem restlichen Inhalt des Kästchens über das Bett verteilt haben. »Das wird niemals geschehen«, murmelte er.
Mit leuchtenden Augen schaute sie zu ihm auf. »Wie kannst du dir da so sicher sein?«
Seine Hand schloss sich um den Dolchgriff. Das Mondlicht, das durch das Fenster hereinfiel, spiegelte sich in der Klinge, als er die Waffe hob. »Ich weiß es einfach«, sagte er und ließ den Dolch herabsausen. Die Klinge durchbohrte Clarys Brust, als wäre sie aus Papier. Und als sich ihr Mund zu einem überraschten Laut öffnete und Blut die Vorderseite ihrer weißen Bluse rot färbte, dachte er, Oh Gott, bitte nicht schon wieder.
Das Erwachen aus diesem Albtraum erschien ihm jedes Mal wie ein Sturz durch eine Glasscheibe: Die rasierklingenscharfen Scherben schnitten ihm förmlich durch die Seele, als er sich ruckartig aufsetzte und keuchend nach Luft schnappte. Er rollte sich aus dem Bett, einem Instinkt folgend, der ihn möglichst schnell möglichst weit wegbringen sollte, und schlug mit Händen und Knien auf dem harten Steinboden auf. Kalte Nachtluft strömte durch das offene Fenster herein und ließ ihn schaudern, sorgte aber gleichzeitig dafür, dass auch die letzten, zäh haftenden Fetzen seines Albtraums fortgeweht wurden.
Jace starrte auf seine Hände – nicht ein Tropfen Blut klebte daran. Das Bett war vollkommen zerwühlt, die Decken und Laken von seinem unruhigen Schlaf zu einem wirren Knäuel verdreht. Doch das Kästchen mit den Briefen und Besitztümern seines Vaters stand unangetastet auf dem Nachttisch, dort, wo er es vor dem Schlafengehen abgestellt hatte.
In den ersten Nächten, in denen ihn dieser Albtraum heimgesucht hatte, war er schweißüberströmt aufgewacht und hatte sich übergeben müssen. Inzwischen achtete er sorgfältig darauf, schon Stunden vor dem Zubettgehen nichts mehr zu essen; daher rächte sich sein Körper an ihm, indem er ihn mit Krämpfen und Fieberanfällen schüttelte. Und auch jetzt erfasste ihn ein solcher Krampf und er krümmte sich keuchend und trocken würgend zusammen, bis der Anfall vorüber war.
Als der Krampf nachließ, presste er die Stirn auf den kühlen Steinboden. Kalter Schweiß rann ihm über den Rücken, das T-Shirt klebte an seiner Haut und er fragte sich erschöpft, ob die Albträume ihn eines Tages umbringen würden. Er hatte schon alles versucht, um sich dagegen zu schützen – Schlaftabletten und Schlummertrünke, Runen für Nachtruhe und friedliche Stunden. Doch nichts half. Die Albträume sickerten wie Gift in seinen Verstand und es gab nichts, was er dagegen tun konnte.
Selbst tagsüber fiel es ihm schwer, Clary direkt anzusehen. Sie hatte ihn immer auf eine Weise durchschaut, wie niemand anderes es konnte, und er mochte sich gar nicht vorstellen, was sie wohl denken würde, wenn sie vom Inhalt seiner Albträume wüsste. Mühsam rollte er sich auf die Seite und starrte auf das Kästchen auf dem Nachttisch, in dessen silberner Oberfläche sich das Mondlicht brach. Und er dachte an Valentin. Valentin, der die einzige Frau, die er je geliebt hatte, gequält und eingesperrt hatte und der seinen Sohn – seine beiden Söhne – gelehrt hatte, dass lieben zerstören heißt.
Seine Gedanken überschlugen sich, als er die Worte wieder und wieder murmelte – sie waren für ihn zu einer Art Mantra geworden, und wie bei jedem Mantra hatten die einzelnen Worte im Laufe der Zeit immer mehr an Bedeutung verloren.
Ich bin nicht wie Valentin. Ich will nicht wie er sein. Ich werde nicht wie er sein. Nein, niemals.
Vor seinem inneren Auge sah er Sebastian – Jonathan, genau genommen –, seinen sogenannten Bruder, der ihn hämisch angegrinst hatte, während seine schwarzen Augen unter den wirren silberweißen Haaren vor gnadenloser Schadenfreude funkelten. Und er sah wieder, wie seine eigene Klinge tief in Jonathans Rücken drang und wie Jonathans Körper den Abhang hinunter in den Fluss rutschte, wo sich sein Blut mit dem Unkraut und Gras der Uferböschung mischte.
Ich bin nicht wie Valentin.
Er hatte es keine Sekunde bedauert, dass er Jonathan getötet hatte. Und er würde es jederzeit wieder tun.
Ich will nicht wie er sein.
Aber es konnte doch nicht normal sein, dass man jemanden tötete, noch dazu den eigenen Stiefbruder, und nichts dabei empfand.
Ich werde nicht wie er sein.
Sein Vater hatte ihn gelehrt, es sei eine Tugend, ohne Gnade zu töten, und vielleicht konnte man das, was einem die eigenen Eltern beigebracht hatten, ja nicht mehr vergessen. Ganz gleich, wie sehr man es sich auch wünschte.
Ich werde nicht wie er sein.
Vielleicht konnten sich die Menschen ja doch nicht wirklich ändern.
Nein, niemals.