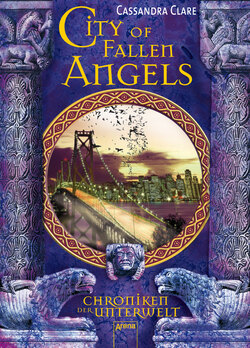Читать книгу City of Fallen Angels - Cassandra Clare - Страница 9
Оглавление4 Die Kunst der acht Gliedmaßen
Hier liegen bewahrt
die Begehren großer Herzen
und edle Dinge, die die Zeit überdauern,
das magische Wort, das geflügelte Wunder bewirkt,
die gesammelte Weisheit, die niemals verstirbt.
Diese Worte waren neben dem Eingangsportal der Stadtbibliothek von Brooklyn am Grand Army Plaza in den Stein gemeißelt. Simon saß auf den Eingangsstufen und schaute zur Fassade hinauf. Die Inschriften glitzerten wie dunkles Gold vor dem hellen Hintergrund der Steinplatten und jedes Wort erwachte flüchtig zum Leben, wenn das Scheinwerferlicht der vorbeifahrenden Fahrzeuge darüberhuschte.
Als kleiner Junge hatte die Bibliothek immer zu Simons Lieblingsorten gezählt. Um die Ecke befand sich ein eigener Eingang für Kinder, wo er sich jahrelang jeden Samstag mit Clary getroffen hatte. Gemeinsam hatten sie einen Stapel Bücher abgeholt und waren dann zum nahe gelegenen Botanischen Garten gelaufen, wo sie stundenlang geschmökert hatten, lang ausgestreckt im Gras, begleitet vom ständigen Rauschen des Verkehrs.
Heute Abend war sich Simon allerdings nicht sicher, was ihn hierhergebracht hatte. Er hatte zugesehen, dass er möglichst schnell von zu Hause fortkam, nur um dann festzustellen, dass er nirgends hinkonnte. Zu Clary wollte er nicht – sie würde nur entsetzt reagieren, wenn sie erfuhr, was er getan hatte, und darauf bestehen, dass er umkehrte und alles wieder in Ordnung brachte. Eric und die anderen würden es gar nicht erst kapieren. Jace mochte ihn nicht und außerdem konnte er sowieso nicht ins Institut. Bei dem Gebäude handelte es sich um eine Kirche und einer der wichtigsten Gründe dafür, dass die Nephilim überhaupt dort lebten, bestand nun mal darin, Kreaturen wie ihn draußen zu halten. Nach langem Grübeln war er schließlich darauf gekommen, an wen er sich tatsächlich wenden konnte, aber die Vorstellung war derart unangenehm, dass es geraume Zeit gedauert hatte, bis er sich ein Herz fasste und dann tatsächlich zum Telefon griff.
Nun hörte er das Motorrad, noch bevor es in Sicht kam; das laute Röhren des Motors durchschnitt das schwache Rauschen des abendlichen Verkehrs am Grand Army Plaza. Die Maschine raste über die Kreuzung auf den Gehweg, bäumte sich dann auf und schoss die Stufen hinauf. Simon ging rasch einen Schritt beiseite, als das Motorrad federleicht neben ihm landete und Raphael die Hände vom Lenker nahm.
Sofort erstarb die Maschine. Vampirmotorräder wurden mit Dämonenenergie betrieben und reagierten wie Haustiere auf die Wünsche ihrer Besitzer. Simon fand sie irgendwie unheimlich.
»Du wolltest mich sprechen, Tageslichtler?«, fragte Raphael, elegant wie immer in schwarzer Jacke und teurer Designer-Jeans. Geschmeidig stieg er ab und lehnte das Motorrad gegen das Treppengeländer. »Du hast hoffentlich einen verdammt guten Grund, mich hierher zu bestellen«, fügte er hinzu. »Schließlich musste ich den ganzen weiten Weg bis nach Brooklyn auf mich nehmen. Und Raphael Santiago gehört nicht in die Vorstadt.«
»Na, großartig. Jetzt redest du von dir selbst schon in der dritten Person. Und das ist ja kein Anzeichen für sich anbahnenden Größenwahn oder so was…«
Raphael zuckte die Achseln. »Du kannst mir jetzt entweder sagen, was du von mir willst, oder ich verschwinde wieder. Das liegt ganz bei dir.« Demonstrativ schaute er auf seine Armbanduhr. »Du hast genau dreißig Sekunden.«
»Ich hab meiner Mutter gesagt, dass ich ein Vampir bin.«
Raphaels Augenbrauen hoben sich ruckartig; sie wirkten sehr dünn und sehr dunkel. In weniger großmütigen Momenten fragte Simon sich manchmal, ob er sich die Augenbrauen vielleicht nachzog. »Und, was ist dann passiert?«, erkundigte Raphael sich.
»Sie hat mich als Monster bezeichnet und versucht, mich mit Gebeten zu verbannen.« Die Erinnerung daran ließ ihm den Geschmack von schalem Blut in die Kehle steigen.
»Und dann?«
»Und dann bin ich mir nicht sicher, was genau passiert ist. Ich habe mit einer total merkwürdigen, besänftigenden Stimme auf sie eingeredet und ihr erklärt, es wäre nichts geschehen und es sei alles nur ein Traum.«
»Und sie hat dir geglaubt.«
»Ja, das hat sie«, bestätigte Simon widerstrebend.
»Natürlich hat sie dir geglaubt«, feixte Raphael. »Weil du ein Vampir bist. Das ist nun mal eine unserer besonderen Gaben. Unser encanto. Unsere Faszination. Unsere Überredungskunst, wie du es nennen würdest. Du kannst einen Menschen von fast allem überzeugen, wenn du lernst, diese Fähigkeit richtig einzusetzen.«
»Aber ich wollte sie nicht bei ihr anwenden. Sie ist meine Mutter! Gibt es irgendeine Möglichkeit, diesen Zauber wieder rückgängig zu machen – irgendeinen Weg, das Ganze in Ordnung zu bringen?«
»Damit sie dich wieder hasst? Und dich wieder für ein Monster hält? Das ist eine sehr merkwürdige Definition von ›In-Ordnung-Bringen‹.«
»Ist mir egal«, schnaubte Simon. »Gibt es eine solche Möglichkeit?«
»Nein«, erwiderte Raphael heiter. »Die gibt es nicht. Und natürlich würdest du das alles auch längst wissen, wenn du deine eigene Art nicht so verachten würdest.«
»Ja, klar: Tu nur so, als ob ich euch abgelehnt hätte. Ist ja nicht so, als ob du versucht hättest, mich umzubringen.«
Erneut zuckte Raphael die Achseln. »Das war rein geschäftlich. Nichts Persönliches.« Er lehnte sich gegen das Geländer und verschränkte die Arme vor der Brust. Seine schwarzen Motorradhandschuhe schimmerten im Mondlicht. Simon musste zugeben, dass er ziemlich cool aussah. »Bitte sag mir, dass du mich nicht nur deshalb hast herkommen lassen, um mir eine äußerst ermüdende Story von deiner Schwester zu erzählen.«
»Mutter«, korrigierte Simon.
Raphael machte eine abschätzige Handbewegung. »Von wem auch immer. Irgendein weibliches Wesen in deinem Leben hat dich zurückgewiesen. Und das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, so viel kann ich dir verraten. Warum belästigst du mich überhaupt damit?«
»Ich wollte wissen, ob ich im Dumont unterkommen kann«, stieß Simon hastig hervor, damit er nicht nach der Hälfte des Satzes einen Rückzieher machen konnte. Es war kaum zu fassen, dass er diese Frage wirklich stellte. Seine Erinnerungen an das Vampirhotel waren eine Aneinanderreihung von Blut und Angst und Schmerz. Aber immerhin bot es eine Zufluchtsstätte, einen Ort, an dem er bleiben konnte und wo niemand nach ihm suchen würde – was bedeutete, dass er nicht nach Hause zurückkehren musste. Schließlich war er ein Vampir. Und es war dämlich, sich vor einem Hotel voller anderer Vampire zu fürchten. »Ich kann sonst nirgendwohin.«
Raphaels Augen glitzerten. »Aha«, sagte er, mit einem leichten Triumph in der Stimme, der Simon nicht besonders gefiel. »Jetzt willst du also etwas von mir.«
»Schätze schon. Obwohl es ziemlich beängstigend ist, dass du dich darüber so freust.«
Raphael schnaubte verächtlich. »Wenn du im Dumont bleiben willst, wirst du mich nicht länger mit Raphael anreden, sondern mit ›Gebieter‹, ›Sir‹ oder ›Großer Clanführer‹.«
Simon wappnete sich. »Und was ist mit Camille?«
Betroffen zuckte Raphael zusammen. »Wie meinst du das?«
»Du hast mir immer erzählt, dass nicht du das eigentliche Oberhaupt des Vampirclans wärst«, meinte Simon vage. »Und in Idris hast du erklärt, es sei jemand namens Camille. Du hast gesagt, sie sei noch nicht nach New York zurückgekehrt. Aber ich nehme doch mal an, dass sie die Große Gebieterin oder was auch immer sein wird, wenn sie wieder in der Stadt ist?«
Raphaels Miene verdüsterte sich. »Deine Art von Fragen gefällt mir nicht, Tageslichtler.«
»Aber ich habe das Recht, diese Dinge zu erfahren.«
»Nein, hast du nicht«, konterte Raphael. »Du kommst zu mir und fragst mich, ob du in meinem Hotel bleiben darfst. Aber nur, weil du sonst nirgends hinkannst. Nicht weil du mit anderen deiner Art zusammen sein willst. Du meidest uns.«
»Was – wie ich bereits sagte – unter anderem daran liegt, dass du versucht hast, mich zu töten.«
»Das Dumont ist keine öffentliche Einrichtung für unentschlossene Vampire«, fuhr Raphael fort. »Du lebst unter Menschen, du wandelst bei Tage, du spielst in deiner dämlichen Band – jaja, glaub bloß nicht, ich wüsste das nicht. In jeder erdenklichen Hinsicht weigerst du dich zu akzeptieren, dass du ein Vampir bist. Und solange sich daran nichts ändert, bist du im Dumont nicht willkommen.«
Simon dachte an Camilles Worte: In dem Moment, in dem seine Anhänger sehen, dass du an meiner Seite stehst, werden sie ihm den Rücken kehren und zu mir kommen. Ich bin davon überzeugt, dass sie mir ergeben sind… trotz ihrer Furcht vor Raphael. Wenn sie uns erst einmal gemeinsam sehen, wird diese Furcht verfliegen und sie werden sich uns anschließen. »Weißt du«, setzte er an, »ich hab auch noch andere Angebote erhalten.«
Raphael musterte ihn, als wäre er vollkommen verrückt geworden. »Was für Angebote?«
»Na ja… Angebote halt«, sagte Simon wenig überzeugend.
»Du bist furchtbar schlecht im Taktieren, Simon Lewis. Ich schlage vor, du lässt in Zukunft lieber die Finger davon.«
»Na schön«, murrte Simon. »Eigentlich wollte ich dir ja was mitteilen, aber jetzt verzichte ich darauf.«
»Und vermutlich wirst du auch das Geburtstagsgeschenk wegwerfen, das du extra für mich gekauft hast«, höhnte Raphael. »Wirklich sehr, sehr tragisch.« Er richtete das Motorrad auf und schwang ein Bein über die Sitzbank, worauf die Maschine röhrend zum Leben erwachte. Rote Funken flogen aus dem Auspuff. »Wenn du mich noch mal belästigen willst, Tageslichtler, dann solltest du besser einen triftigen Grund haben. Anderenfalls werde ich nicht so nachsichtig sein wie jetzt.« Und mit diesen Worten machte das Motorrad einen Satz nach vorn und dann in die Luft.
Simon legte den Kopf in den Nacken und schaute Raphael nach, der wie der Engel, nach dem er benannt war, in den Nachthimmel hinaufstieg, eine Spur rot glühender Funken hinter sich herziehend.
Clary balancierte ihren Skizzenblock auf den Knien und kaute nachdenklich auf dem Ende ihres Bleistifts herum. Sie hatte Jace Dutzende Male gezeichnet – vermutlich war das ihre Version der Tagebucheinträge, in denen die meisten Mädchen Gedanken über ihren festen Freund festhielten –, aber sie schien einfach nicht in der Lage, ihn exakt porträtieren zu können. Zum einen war es fast unmöglich, ihn dazu zu bringen, mal einen Moment ruhig zu sitzen. Deshalb hatte sie gedacht, es wäre einfacher, ihn zu malen, während er schlief – aber das Ergebnis war noch immer nicht so, wie sie es sich wünschte. Die Zeichnung sah einfach nicht aus wie Jace.
Frustriert warf sie den Skizzenblock auf die Picknickdecke, zog seufzend die Knie hoch und betrachtete ihn. Irgendwie hatte sie nicht damit gerechnet, dass er einschlafen würde. Sie waren in den Central Park gekommen, um zu picknicken und im Freien zu trainieren, solange das Wetter noch mitspielte. Und eines davon hatten sie auch tatsächlich getan: Diverse Plastikschälchen und Styroporschachteln von Taki’s lagen neben der Decke im Gras verstreut. Jace hatte nicht viel gegessen, sondern nur lustlos in seinen Sesamnudeln herumgestochert, dann die Box beiseitegestellt und sich auf die Decke fallen lassen, den Blick starr zum Himmel gerichtet. Clary hatte dagesessen und auf ihn hinabgeschaut, hatte die Spiegelung der Wolken in seinen klaren Augen beobachtet, die Konturen seiner muskulösen Arme, die er hinter dem Kopf verschränkt hatte, den Streifen perfekt glatter Haut, der zwischen dem Saum seines T-Shirts und dem Gürtel seiner Jeans zum Vorschein gekommen war. Und Clary hatte sich nichts sehnlicher gewünscht, als die Hand auszustrecken und über seinen flachen, festen Bauch zu streicheln. Stattdessen hatte sie den Blick abgewandt und nach ihrem Skizzenblock gesucht. Als sie sich wieder zu ihm umdrehte, den Bleistift in der Hand, waren ihm bereits die Augen zugefallen und seine Atmung ging ruhig und gleichmäßig.
Inzwischen war sie bei ihrer dritten Skizze, aber immer noch meilenweit von einer Zeichnung entfernt, die ihren Ansprüchen genügte. Während sie Jace so betrachtete, fragte sie sich, warum sie ihn einfach nicht porträtieren konnte. Dabei waren die Lichtverhältnisse perfekt: Die sanfte Oktobersonne übergoss sein ohnehin schon goldbraunes Haar und die hell schimmernde Haut mit ihrem warmen goldenen Schein. Seine geschlossenen Lider wurden von goldenen Wimpern gesäumt, die einen Hauch dunkler schienen als seine Haare. Eine Hand lag locker auf der Brust, die andere leicht geöffnet neben der Hüfte. Im Schlaf wirkte sein Gesicht entspannter und verwundbarer, weicher und weniger kantig als im Wachzustand. Vielleicht war ja genau das das Problem: Jace war so selten entspannt und verwundbar, dass es ihr schwerfiel, seine Konturen in diesem Zustand auch festzuhalten, jetzt, da er schlafend vor ihr lag. Irgendwie wirkte er… fremd.
Genau in diesem Moment rührte er sich im Schlaf: Er stieß kleine, keuchende Laute aus, seine Augen zuckten unter den geschlossenen Lidern hin und her, seine Hand verkrampfte sich und er schreckte so ruckartig hoch, dass er Clary fast umgestoßen hätte. Er riss die Augen auf und schaute sich einen Moment benommen um. Sein Gesicht war kreidebleich.
»Jace, was ist?« Clary konnte ihre Überraschung nicht verbergen.
Sein Blick konzentrierte sich auf ihre Augen und im nächsten Moment riss er Clary an sich, ohne seine sonst übliche Zurückhaltung und Sanftheit. Er zog sie auf seinen Schoß und küsste sie leidenschaftlich, während seine Hände durch ihre Haare wühlten. Clary konnte sein Herz gegen ihres schlagen spüren und fühlte dann, wie ihre Wangen erröteten. Sie waren in einem öffentlichen Park und die Leute starrten vermutlich schon zu ihnen herüber.
»Wow!«, stieß Jace hervor und zog sich etwas zurück, während ein Lächeln seine Lippen umspielte. »’tschuldigung. Damit hattest du wahrscheinlich nicht gerechnet.«
»Jedenfalls war es eine angenehme Überraschung«, murmelte Clary; ihre Stimme klang selbst in ihren eigenen Ohren tief und heiser. »Wovon um alles in der Welt hast du geträumt?«
»Von dir.« Langsam wickelte er eine von Clarys roten Locken um seinen Finger. »Ich träume immer von dir.«
»Ach, wirklich?«, fragte Clary, noch immer auf seinem Schoß, die Knie links und rechts neben seinen Hüften. »Ich dachte nämlich, du hättest einen Albtraum.«
Jace legte den Kopf in den Nacken, um sie in Ruhe anzuschauen. »Manchmal träume ich, du wärst fort«, erklärte er. »Ich frag mich noch immer, wann du endlich herausfindest, dass du mich verlassen und dir eine wesentlich bessere Partie schnappen solltest.«
Vorsichtig berührte Clary sein Gesicht mit den Fingerspitzen, zeichnete sanft die Konturen seiner Wangenknochen nach und ließ ihre Finger bis zu seinen geschwungenen Lippen gleiten. Derartige Dinge sagte er nur zu ihr. Aus langjähriger Erfahrung wussten Alec und Isabelle zwar, dass unter dem Schutzschild aus spöttischem Humor und vorgeblicher Arroganz die quälenden Erinnerungen seiner zerrütteten Kindheit noch immer an ihm nagten. Aber Clary war die Einzige, der gegenüber er diese Dinge auch laut aussprach. Langsam schüttelte sie den Kopf, woraufhin ihr die Haare nach vorn in die Stirn fielen und sie sie ungeduldig beiseitefegte.
»Ich wünschte, ich könnte so gut formulieren wie du«, sagte sie. »Alles, was du sagst… jeder Satz… das ist einfach perfekt. Du findest immer die richtigen Worte, weißt immer, was du sagen musst, damit ich dir glaube, dass du mich liebst. Aber wenn ich dich nicht davon überzeugen kann, dass ich dich nie verlassen werde…«
Jace umfing ihre Hand mit seiner. »Sag es mir einfach noch mal.«
»Ich werde dich nie verlassen«, erklärte Clary fest.
»Was auch passiert? Ganz gleich, was ich tue?«
»Ich werde immer zu dir halten, dich nicht im Stich lassen. Niemals. Was ich für dich empfinde…« Clary suchte nach den passenden Worten. »Das ist das Bedeutendste, was ich jemals empfunden habe.« Verdammt, dachte sie. Das klang total idiotisch.
Aber Jace schien anderer Meinung zu sein, denn er lächelte wehmütig und erwiderte: »L’amor che move il sole e l’altre stelle.«
»Ist das Latein?«
»Italienisch«, erklärte er. »Dante.«
Clary fuhr mit den Fingerspitzen über seine Lippen und Jace erschauderte. »Ich spreche kein Italienisch«, murmelte sie leise.
»Es bedeutet, dass die Liebe die mächtigste Kraft in der Welt ist«, erläuterte Jace. »Dass die Liebe alles bewirken kann.«
Clary löste ihre Hand aus seiner, wohl wissend, dass er sie dabei aus halb geschlossenen Augen beobachtete. Sie verschränkte die Hände in seinem Nacken, beugte sich vor und berührte seine Lippen mit ihrem Mund – kein Kuss, nur ein sanfter Hauch. Doch das reichte bereits: Sie konnte spüren, wie sein Puls in die Höhe schnellte und er ihr entgegenkam, im Versuch, ihren Mund mit seinen Lippen zu umfangen. Doch Clary schüttelte den Kopf und verteilte ihre Haare wie einen Vorhang um sie beide, der sie vor den neugierigen Blicken der anderen Parkbesucher abschirmte. »Wenn du müde bist, könnten wir zum Institut zurückkehren«, schlug sie leise, fast wispernd vor. »Wir könnten ein Nickerchen machen. Wir haben seit… seit Idris nicht mehr zusammen in einem Bett gelegen.«
Ihre Blicke trafen sich und Clary wusste, dass Jace an genau dasselbe zurückdachte wie sie: das schwache Licht, das durch das Fenster von Amatis’ winzigem Gästezimmer fiel, die Verzweiflung in seiner Stimme. Ich möchte mich einfach nur neben dich legen und zusammen mit dir aufwachen, nur ein Mal, nur ein einziges Mal in meinem Leben. In jener Nacht hatten sie die ganze Zeit Seite an Seite gelegen; nur ihre Fingerspitzen hatten einander berührt. Inzwischen hatten sie einander zwar weit mehr berührt, aber noch nie die Nacht zusammen verbracht. Jace wusste, dass sie ihm mehr anbot als ein Nickerchen in einem der ungenutzten Gästezimmer des Instituts. Clary hatte nicht den geringsten Zweifel daran, dass er es in ihren Augen lesen konnte – auch wenn sie sich nicht sicher war, wie viel genau sie ihm anbot. Aber das spielte keine Rolle. Jace würde niemals etwas von ihr verlangen, was sie nicht zu geben bereit war.
»Ich möchte ja gern…« Der leidenschaftliche Ausdruck und der heisere Ton in seiner Stimme verrieten ihr, dass er nicht log. »Aber… das geht nicht.« Mit festem Griff umfasste er ihre Handgelenke und zog diese nach vorn, zwischen sie beide, sodass ihre Hände eine Barriere bildeten.
Clary schaute ihn mit großen Augen an. »Warum nicht?«
Jace holte tief Luft. »Wir sind zum Trainieren hierhergekommen und das sollten wir jetzt auch tun. Wenn wir die ganze Zeit nur rumknutschen, statt zu üben, wird man mir irgendwann überhaupt nicht mehr gestatten, bei deiner Ausbildung zu helfen.«
»Sollte ich nicht sowieso von jemand anderem unterrichtet werden – von jemandem, der noch angestellt werden sollte, einem Vollzeitlehrer?«
»Stimmt«, bestätigte Jace, rappelte sich auf und zog Clary gleichzeitig auf die Füße. »Und wenn du es dir jetzt schon zur Gewohnheit machst, mit deinen Tutoren rumzuknutschen, dann wirst du das auch irgendwann mit ihm tun.«
»Sei doch nicht so sexistisch. Der Rat könnte mir auch eine Tutorin besorgen.«
»In diesem Fall hast du meine offizielle Genehmigung zum Rumknutschen – solange ich dabei zusehen darf.«
»Das hättest du wohl gern«, grinste Clary und bückte sich, um die mitgebrachte Picknickdecke zusammenzulegen. »Du hast doch nur Angst, dass man mir einen Mann als Tutor zur Verfügung stellt, der schärfer ist als du.«
Jace’ Augenbrauen gingen ruckartig nach oben. »Schärfer als ich?«
»Das wäre doch möglich«, erwiderte Clary. »Zumindest theoretisch.«
»Theoretisch könnte dieser Planet plötzlich entzweibrechen, sodass ich auf einer Hälfte zurückbliebe und du auf der anderen. Auf tragische Weise für immer voneinander getrennt, aber darüber mache ich mir auch keine Sorgen. Manche Dinge sind einfach zu unwahrscheinlich, um auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden«, sagte er mit seinem typischen schiefen Grinsen.
Dann hielt er ihr seine Hand entgegen und gemeinsam überquerten sie die Wiese in Richtung eines kleinen Hains am Rande der East Meadow, von dessen Existenz nur Schattenjäger zu wissen schienen. Clary vermutete, dass dieser Bereich im Nordosten des Central Park durch einen Zauberglanz kaschiert war, da Jace und sie hier relativ regelmäßig trainierten und dabei noch nie von anderen Parkbesuchern gestört worden waren, abgesehen von Isabelle oder Maryse.
Im Herbst bot der Central Park einen farbenprächtigen Anblick: Die Bäume am Rande der Wiese leuchteten in ihren kräftigsten Farben und umsäumten das grüne Gras mit strahlendem Gold, Rot, Kupfer und Rostorange. Es war ein wundervoller Tag für einen romantischen Spaziergang durch den Park und vielleicht einen zärtlichen Kuss auf einer der Steinbrücken. Aber das würde wohl nicht passieren, überlegte Clary. Jace betrachtete die Grünanlage offensichtlich als externen Trainingsplatz des Instituts und sie waren hierhergekommen, um Clarys Ausbildung fortzusetzen. Die bestand aus Geländeerkundung, Flucht- und Ausweichmanöver und dem Töten mit bloßen Händen.
Normalerweise wäre sie begeistert gewesen, eine Technik zum Töten mit bloßen Händen zu erlernen, aber Jace machte ihr immer noch Sorgen: Sie wurde das nagende Gefühl nicht los, dass irgendetwas mit ihm ernsthaft nicht in Ordnung war. Wenn es doch nur eine Rune gäbe, die ihn dazu brächte, ihr zu erzählen, was er wirklich fühlte, überlegte sie. Aber eine derartige Rune würde sie niemals erschaffen, ermahnte sie sich hastig. Es wäre total unethisch, ihre Fähigkeit dazu nutzen zu wollen, jemand anderen zu manipulieren. Außerdem schien ihre besondere Gabe nach der Erschaffung der Vereinigungsrune in Idris in den letzten Wochen offenbar brachzuliegen. Sie verspürte nicht das geringste Bedürfnis, uralte Runen zu zeichnen oder irgendwelche neuen zu entwerfen. Maryse hatte ihr gesagt, man würde versuchen, einen Spezialisten für Runen als ihren Lehrer zu gewinnen, sobald ihre Ausbildung richtig begonnen habe, doch bisher war in dieser Richtung nicht viel passiert. Aber das machte Clary nicht viel aus: Sie musste sich eingestehen, dass sie nicht allzu traurig sein würde, wenn ihre Fähigkeit für immer verschwunden bliebe.
»Es wird Situationen geben, in denen du einem Dämonen begegnest, aber keinerlei Waffe zur Verfügung hast«, dozierte Jace, während sie unter einer Baumreihe hindurchgingen, deren tief hängende Blätter die gesamte Palette von Grün bis Leuchtendgold präsentierten. »In solch einem Moment darfst du auf keinen Fall in Panik geraten. Erstens musst du dich daran erinnern, dass alles und jedes als Waffe genutzt werden kann: ein Ast, eine Handvoll Münzen – übrigens ein hervorragender Schlagring-Ersatz –, ein Schuh, einfach alles. Und zweitens darfst du nicht vergessen, dass du selbst eine Waffe bist. Wenn dein Training erst einmal abgeschlossen ist, solltest du theoretisch in der Lage sein, ein Loch in die Wand zu treten oder mit einem einzigen Schlag einen Elch niederzustrecken.«
»Ich würde niemals einen Elch schlagen«, protestierte Clary. »Sie sind vom Aussterben bedroht.«
Jace musste grinsen und wandte sich ihr zu. Inzwischen hatten sie die Lichtung inmitten des Hains erreicht – eine kleine, gerodete Fläche im Schutz der Bäume, deren Stämme Runen trugen und das Gelände damit als Schattenjägerterrain deklarierten.
»Es gibt einen uralten Kampfstil namens Muay Thai, auch ›Thaiboxen‹ genannt. Schon mal davon gehört?«, fragte Jace.
Clary schüttelte den Kopf. Die Sonne schien strahlend und beständig vom Himmel, sodass es ihr in ihrem Trainingsanzug fast schon zu warm war.
Jace zog die Jacke aus und streckte und dehnte seine schlanken Pianistenhände. Im herbstlichen Licht schimmerten seine Augen in einem leuchtenden Goldton. Runen für Schnelligkeit, Beweglichkeit und Kraft wanden sich wie verschlungene Ranken von seinen Handgelenken über die ausgeprägte Oberarmmuskulatur bis zum Rand seines T-Shirts, wo sie unter dem Stoff verschwanden. Clary fragte sich, warum er sich die Mühe gemacht und all diese Runen aufgetragen hatte, so als sei sie ein Feind, mit dessen Angriff man jederzeit rechnen müsse.
»Gerüchten zufolge soll der neue Tutor, den wir nächste Woche bekommen, ein Meister im Thaiboxen sein«, erklärte er nun. »Es heißt, er sei außerdem Spezialist für Sambo, Lethwei, Tomoi, Krav Maga, Jiu-Jitsu und einen weiteren Kampfstil, an dessen Name ich mich nicht mehr erinnern kann, der aber das Töten mit kleinen Stäben oder so was Ähnlichem beinhaltet. Was ich sagen will, ist: Der oder die neue Lehrkraft dürfte nicht daran gewöhnt sein, mit jemandem deines Alters zu trainieren, der so unerfahren ist wie du. Wenn wir dir also ein paar Grundlagen beibringen, erreichen wir hoffentlich, dass er oder sie sich dir gegenüber etwas großmütiger zeigen wird«, erläuterte er. Dann streckte er die Arme aus und legte seine Hände auf Clarys Hüften. »Okay, jetzt dreh dich zu mir.«
Clary tat wie ihr geheißen. Als sie sich direkt gegenüberstanden, reichte ihr Scheitel gerade einmal bis zu seinem Kinn. Locker legte sie ihre Hände auf seine Oberarmmuskeln.
»Muay Thai wird als die ›Kunst der acht Gliedmaßen‹ bezeichnet. Weil man dabei nämlich nicht nur seine Fäuste und Füße als Waffe einsetzt, sondern auch Knie und Ellbogen. Zuerst musst du deinen Gegner zu dir heranziehen und dann schlägst du mit jedem deiner ›Waffen‹ zu, bis er oder sie zu Boden geht.«
»Und das funktioniert bei Dämonen?«, fragte Clary und hob skeptisch die Augenbrauen.
»Bei den kleineren.« Jace trat einen Schritt näher. »Okay. Streck deine Hand aus und leg sie mir in den Nacken!«
Clary schaffte es gerade so, seiner Aufforderung nachzukommen, ohne sich auf die Zehenspitzen zu stellen – nicht zum ersten Mal verfluchte sie die Tatsache, dass sie so klein war.
»Jetzt mach dasselbe mit deiner anderen Hand und verschränk beide Hände in meinem Nacken!«
Clary befolgte Jace’ Anweisung. Sein Nacken fühlte sich von der Sonne ganz warm an und seine weichen Haare kitzelten sie an den Fingern. Ihre Körper waren eng aneinandergepresst und Clary konnte den Ring an der Kette um ihren Hals spüren… wie er zwischen ihnen zusammengedrückt wurde, so wie ein Kieselstein zwischen zwei Handflächen.
»In einem richtigen Kampf würdest du diese Bewegung natürlich viel schneller ausführen«, erklärte Jace. Falls Clary sich nicht täuschte, klang seine Stimme dabei ein wenig rau. »Also, dieser Griff um den Nacken erlaubt dir eine gewisse Hebelkraft. Und diese Hebelkraft wirst du nun dazu nutzen, dich selbst nach vorn zu ziehen und deinem nach oben ausgeführten Knietritt mehr Wucht zu verleihen…«
»Du meine Güte«, spöttelte in diesem Moment eine kühle, leicht belustigte Stimme. »Gerade einmal sechs Wochen zusammen und schon geht ihr euch gegenseitig an die Kehle?! Wie rasch die Liebe der Irdischen doch schwindet.«
Sofort lockerte Clary ihren Griff um Jace’ Nacken und wirbelte herum. Dabei wusste sie längst, wer da sprach: Die Königin des Lichten Volkes stand im Schatten zwischen zwei Bäumen. Clary fragte sich, ob sie sie – trotz ihrer Gabe des Zweiten Gesichts – überhaupt wahrgenommen hätte, wenn die Feenkönigin sich nicht bemerkbar gemacht hätte. Denn sie trug ein grünes Kleid von der Farbe der Gräser und ihre Haare, die ihre Schultern umspielten, schimmerten im Ton eines Herbstblatts. Sie war zugleich so schön und schrecklich wie eine vergehende Jahreszeit und Clary hatte ihr nie über den Weg getraut.
»Was tut Ihr hier?«, erkundigte Jace sich distanziert und mit zusammengekniffenen Augen. »Dies ist Schattenjägerterrain.«
»Und ich habe Neuigkeiten, die für die Schattenjäger interessant sein dürften.« Als die Elbenkönigin anmutig einen Schritt vortrat, fiel ein Sonnenstrahl durch das Blätterdach und ließ den Reif aus goldenen Beeren auf ihrem Haupt aufblitzen. Clary fragte sich manchmal, ob die Königin diese theatralischen Auftritte plante, und wenn ja, wie. »Es hat einen weiteren Todesfall gegeben«, fügte sie hinzu.
»Was für eine Art von Todesfall?«
»Es hat einen weiteren von euch getroffen. Ein toter Nephilim.« Aus den Worten der Elbenkönigin sprach eine gewisse Wonne. »Der Leichnam wurde in der Morgendämmerung unterhalb der Oak Bridge aufgefunden. Und wie ihr ja wisst, ist der Central Park mein Territorium. Ein toter Mensch wäre für mich nicht weiter von Bedeutung gewesen, doch bei dem Toten schien es sich nicht um einen Irdischen zu handeln. Deshalb wurde der Leichnam an meinen Hof gebracht und dort von meinen Heilkundigen untersucht. Sie erklärten den Toten für einen aus euren Reihen.«
Rasch schaute Clary zu Jace, da sie sich an die Nachricht von dem toten Schattenjäger zwei Tage zuvor erinnerte. Und sie konnte ihm ansehen, dass er dasselbe dachte, denn er erbleichte.
»Wo ist der Leichnam jetzt?«, fragte er.
»Machst du dir Sorgen hinsichtlich meiner Gastfreundschaft? Der Tote befindet sich an meinem Hof und ich kann dir versichern, dass wir seinem Leichnam denselben Respekt zollen wie einem lebenden Schattenjäger. Nun, da ein Vertreter meines Volkes einen Sitz in der Kongregation innehat, direkt neben deinesgleichen, kannst du unsere Redlichkeit wohl kaum infrage stellen.«
»Und wie immer gehen Redlichkeit und Eure Ladyschaft Hand in Hand.« Der Sarkasmus in Jace’ Stimme war nicht zu überhören, doch die Königin lächelte nur fein.
Offensichtlich mochte sie Jace – so wie alle Feenwesen schöne Dinge mochten, einfach um ihrer Schönheit willen, überlegte Clary. Allerdings konnte sie nicht davon ausgehen, dass die Königin auch sie mochte, und dieses Gefühl beruhte auf Gegenseitigkeit.
»Aber warum überbringt Ihr diese Nachricht uns statt Maryse? Es wäre doch Sitte, dass…«
»Ach, Sitte.« Mit einer abschätzigen Handbewegung setzte die Königin sich über die gesellschaftlichen Konventionen hinweg. »Ihr seid hier. Es erschien mir zweckdienlich.«
Jace schenkte ihr einen weiteren Blick aus skeptisch zusammengekniffenen Augen und klappte sein Mobiltelefon auf. Dann bedeutete er Clary zu bleiben und ging ein paar Schritte beiseite. Sie konnte hören, wie er »Maryse?« fragte, als am anderen Ende der Leitung jemand abhob. Allerdings wurden seine weiteren Worte von den lauten Rufen auf den nahe gelegenen Sportplätzen verschluckt.
Mit einem mulmigen Gefühl im Magen wandte Clary sich der Feenkönigin wieder zu. Sie hatte sie seit jenem letzten Abend in Idris nicht mehr gesehen; damals war sie nicht besonders höflich zu ihr gewesen und Clary bezweifelte, dass die Königin dieses Verhalten vergessen oder vergeben hatte. Willst du wahrhaftig einen Gefallen der Königin des Lichten Volkes ausschlagen?
»Ich habe gehört, Meliorn hat einen Sitz in der Kongregation erhalten«, setzte Clary nun an. »Das muss Euch sehr gefreut haben.«
»In der Tat.« Die Königin betrachtete sie mit unverhohlener Belustigung. »Ich bin gebührend entzückt.«
»Dann… dann hegen Sie also keinen Groll?«, fragte Clary.
Das Lächeln der Königin gefror um ihre Lippen, so wie Frost zuerst den Rand eines Teichs erstarren lässt. »Ich vermute, du beziehst dich auf mein Angebot, das du so rüde abgelehnt hast«, erwiderte sie. »Wie du ja weißt, habe ich mein Ziel dessen ungeachtet erreicht. Du bist also diejenige, die das Nachsehen hat, wie mir die meisten sicherlich beipflichten würden.«
»Ich habe Euer Angebot nicht gewünscht«, erklärte Clary fest und versuchte dabei, den scharfen Ton in ihrer Stimme zu unterdrücken, was ihr aber nicht gelang. »Die Leute tun nicht immer das, was Ihr von ihnen wollt.«
»Wage es nicht, mir Vorhaltungen zu machen, meine Kleine.« Die Königin schaute zu Jace hinüber, der mit dem Mobiltelefon am Ohr unter den Bäumen auf und ab lief. »Er ist wunderschön«, bemerkte sie. »Ich kann verstehen, warum du ihn liebst. Aber hast du dich je gefragt, was es ist, das ihn zu dir hinzieht?«
Clary schwieg – was hätte sie auch darauf antworten sollen?
»Das Himmlische Blut bindet euch beide«, fuhr die Königin fort. »Die Stimme des Blutes lässt sich nicht ignorieren. Aber Liebe und Blut sind nicht dasselbe.«
»Rätsel, nichts als Rätsel«, schnaubte Clary wütend. »Verbinden Sie mit diesem Gerede eigentlich irgendeine Bedeutung?«
»Er ist an dich gebunden«, näselte die Königin. »Aber liebt er dich auch?«
Clary spürte, wie ihre Hände zuckten. Es juckte sie förmlich in den Fingern, ihre neu erlernten Kampftechniken an der Königin auszuprobieren, doch sie wusste, dass dies nicht sehr ratsam wäre. »Ja, er liebt mich.«
»Und begehrt er dich auch? Denn Liebe und Begehren sind nicht immer dasselbe.«
»Das geht Euch nichts an«, erwiderte Clary kurz angebunden, aber sie konnte sehen, dass die Königin sie aus messerscharfen Augen musterte.
»Du willst ihn mehr, als du jemals etwas in deinem Leben gewollt hast. Aber empfindet er für dich dasselbe?« Die honigsüße Stimme der Königin war unerbittlich. »Er könnte alles oder jede haben, ganz wie es ihm gefällt. Fragst du dich, warum er dich erwählt hat? Fragst du dich, ob er seine Entscheidung bereut? Hat er sich dir gegenüber verändert?«
Clary spürte, wie ihr die aufsteigenden Tränen in den Augen brannten. »Nein, das hat er nicht«, widersprach sie, doch sie erinnerte sich an den Ausdruck auf seinem Gesicht im Aufzug des Instituts und wie er sie nach Hause geschickt hatte, als sie zu bleiben angeboten hatte.
»Du hast mir damals gesagt, dass du keinen Pakt mit mir einzugehen wünschst, denn es gäbe nichts, was ich dir geben könnte. Du sagtest, du hättest alles, was du dir nur wünschen könntest.« Die Augen der Königin glitzerten. »Wenn du dir dein Leben ohne ihn ausmalst, bist du dann noch immer derselben Ansicht?«
Warum tut Ihr mir das an?, hätte Clary am liebsten gebrüllt, doch sie schwieg, weil die Elbenkönigin in diesem Moment an ihr vorbeischaute und dann lächelnd säuselte: »Wisch deine Tränen, denn er kehrt hierher zurück. Und du erweist dir keinen Gefallen, wenn er dich weinen sieht.«
Hastig wischte Clary sich mit dem Handrücken über die Augen und drehte sich um. Jace kam mit gerunzelter Stirn direkt auf sie zu. »Maryse ist auf dem Weg zum Lichten Hof«, verkündete er und fragte dann: »Wohin ist die Königin verschwunden?«
Verwirrt musterte Clary ihn. »Sie steht direkt hinter mir…«, setzte sie an, drehte sich um und verstummte. Jace hatte recht: Die Königin war verschwunden – nur ein Strudel aus wirbelnden Blättern neben Clarys Füßen ließ noch ahnen, wo sie gestanden hatte.
Simon lag auf dem Rücken, seine Jacke als Kissen unter den Kopf gestopft, die Reisetasche zu seinen Füßen, und starrte mit einem Gefühl trostloser Unabwendbarkeit an die löchrige Decke von Erics Garage. Er presste sich das Handy ans Ohr und die Vertrautheit von Clarys Stimme am anderen Ende der Leitung war das Einzige, was ihn noch davon abhielt, vollends zusammenzubrechen.
»Simon, das tut mir so leid.«
Er konnte hören, dass sie sich irgendwo in der Innenstadt befinden musste: Der laute Verkehrslärm im Hintergrund dämpfte ihre Stimme.
»Bist du wirklich in Erics Garage? Weiß er denn, dass du da bist?«
»Nein«, räumte Simon ein. »Im Moment ist niemand zu Hause, aber ich hab einen Schlüssel. Es schien mir ein guter Unterschlupf zu sein. Und wo bist du?«
»In der Stadt.« Für die Einwohner Brooklyns blieb Manhattan immer »die Stadt«. In ihren Augen existierte keine andere Metropole. »Ich war mit Jace trainieren, aber dann musste er zum Institut zurück, in einer Art Ratsangelegenheit. Ich bin gerade auf dem Weg zu Luke.« Im Hintergrund ertönte eine laute Autohupe. »Hör mal, möchtest du vielleicht bei uns übernachten? Du könntest auf Lukes Couch schlafen.«
Simon zögerte. Er hatte gute Erinnerungen an Lukes Haus. Seit er Clary kannte, und das waren nun schon einige Jahre, hatte Luke immer in denselben leicht schäbigen, aber heimeligen Räumen über seiner Buchhandlung gewohnt. Clary besaß einen Schlüssel zu seinem Haus und sie beide hatten viele angenehme Stunden dort verbracht – mit der Lektüre von Büchern, die sie unten im Buchladen »ausgeliehen« hatten, oder gemeinsam vor dem Fernseher.
Aber inzwischen hatten sich die Zeiten geändert.
»Vielleicht könnte meine Mom ja mit deiner Mutter reden«, schlug Clary vor, da sein Schweigen am anderen Ende der Leitung ihr offenbar Sorgen bereitete. »Und ihr alles erklären…«
»Ihr erklären, dass ich ein Vampir bin? Clary, ich glaube, sie weiß das längst, auf eine ganz eigentümliche Art und Weise. Aber das bedeutet nicht, dass sie es auch akzeptiert oder sich jemals damit arrangieren wird.«
»Mag sein. Andererseits kannst du aber auch nicht ständig ihr Gedächtnis löschen, damit sie es vergisst, Simon«, gab Clary zu bedenken. »Das funktioniert nicht ewig.«
»Warum denn nicht?« Er wusste, dass er unvernünftig reagierte. Aber während er auf dem harten Betonboden lag, umgeben von Benzingeruch und dem Wispern der Spinnen, die in den Garagenecken ihre Netze webten, fühlte er sich einsamer als je zuvor und so etwas wie Vernunft schien meilenweit entfernt.
»Weil dann deine ganze Beziehung zu ihr auf einer Lüge basieren würde. Du würdest niemals nach Hause zurückkehren können…«
»Na und?«, unterbrach Simon Clary schroff. »Schließlich ist das doch Teil des Fluchs, oder? ›Unstet und flüchtig sollst du sein!‹«
Trotz des Verkehrslärms und Stimmengewirrs irgendwelcher Passanten im Hintergrund konnte er hören, wie Clary bei seinen Worten scharf die Luft einzog.
»Meinst du, dass ich ihr davon auch erzählen sollte?«, fragte er. »Wie du mich mit dem Kainsmal versehen hast? Dass ich im Grunde ein wandelnder Fluch auf zwei Beinen bin? Glaubst du ernsthaft, dass sie so was gern im Haus hätte?«
Die Hintergrundgeräusche verstummten – Clary musste sich in eine Toreinfahrt zurückgezogen haben. Simon konnte hören, wie sie mit den Tränen kämpfte, als sie erwiderte: »Simon, es tut mir so leid. Du weißt, dass es mir leidtut…«
»Es ist nicht deine Schuld.« Plötzlich fühlte er sich unendlich müde. So ist es recht: Versetz deine Mutter in Angst und Schrecken und bring dann deine beste Freundin zum Weinen. Echt tolle Leistung, Simon. »Hör mal, Clary, ganz offensichtlich sollte ich im Moment besser nicht unter Leuten sein. Ich werd einfach hierbleiben, bis Eric zurück ist, und dann auf seinem Gästesofa übernachten.«
Clary stieß ein schniefendes Geräusch aus, eine Mischung aus Lachen und Weinen. »Ach, fällt Eric denn nicht unter ›Leute‹?«
»Das klären wir besser ein anderes Mal«, erwiderte Simon und fügte dann zögernd hinzu: »Ich ruf dich morgen an, okay?«
»Nein, wir treffen uns morgen. Du hast versprochen, mit mir zu dieser Kleiderprobe zu kommen. Schon vergessen?«
»Wow, ich muss dich echt lieben«, schnaubte Simon.
»Ich weiß«, grinste Clary. »Und ich liebe dich auch. Also, bis morgen.«
Simon beendete die Verbindung und ließ sich wieder auf den Boden sinken, das Handy an seine Brust gepresst. Irgendwie seltsam, dachte er. Jetzt konnte er gegenüber Clary mühelos »Ich liebe dich« sagen, während er jahrelang mit diesen Worten gekämpft und sie einfach nicht über die Lippen gebracht hatte. Jetzt, wo er diese Worte nicht mehr auf dieselbe Weise meinte wie früher, fiel es ihm leicht.
Manchmal fragte er sich noch, was wohl passiert wäre, wenn es einen Jace Wayland nie gegeben hätte, wenn Clary niemals von ihrer Schattenjäger-Natur erfahren hätte. Aber diesen Gedanken schob er beiseite – es war sinnlos, darüber nachzudenken. Man konnte die Vergangenheit nicht ändern; man konnte nur nach vorne schauen. Nicht dass er auch nur irgendeine Vorstellung davon gehabt hätte, was dieses »Nach-Vorne-Schauen« mit sich brachte. Schließlich konnte er nicht ewig in Erics Garage bleiben. Selbst in seinem gegenwärtigen Gemütszustand musste er sich eingestehen, dass dieser Raum nicht gerade einladend war. Simon fror zwar nicht – im Grunde war er nicht mehr in der Lage, so etwas wie Kälte oder Wärme überhaupt noch zu spüren –, aber der Betonboden war hart und er hatte größte Mühe einzuschlafen. Er wünschte, er könnte seine Sinne irgendwie dämpfen. Der laute Verkehrslärm von der Straße vor dem Haus hinderte ihn daran einzunicken – genau wie der stechende Benzingeruch in der Garage. Aber das Schlimmste war die quälende Sorge darüber, was er als Nächstes tun sollte.
Von seinen Blutvorräten hatte er den größten Teil entsorgt und den verbleibenden Rest in seinen Rucksack gestopft – das würde für die nächsten Tage reichen, aber danach musste er schleunigst für Abhilfe sorgen. Eric würde ihn sicherlich bei sich wohnen lassen, aber das würde möglicherweise dazu führen, dass Erics Eltern mit seiner Mutter telefonierten. Und da sie wiederum glaubte, er wäre auf einem Schulausflug, konnte er dieses Risiko nicht eingehen.
Ein paar Tage, überlegte er, das war exakt der Zeitraum, der ihm noch blieb. Bis seine Blutreserven aufgebraucht waren. Bis seine Mutter sich fragte, wo er steckte, und in der Schule anrief. Bis sie sich wieder erinnerte. Er war jetzt ein Vampir. Und eigentlich sollte ihm die Ewigkeit zur Verfügung stehen. Aber ihm blieben gerade einmal noch ein paar Tage.
Dabei war er so vorsichtig gewesen, hatte so hart um etwas gekämpft, was er als »normales Leben« bezeichnete – Schule, Freunde, sein eigenes Zuhause, sein eigenes Zimmer. Natürlich war es schwierig gewesen, aber so war das Leben nun mal. Alle anderen Möglichkeiten erschienen ihm derart trostlos und einsam, dass er gar nicht daran denken mochte. Und dennoch ertönte nun Camilles Stimme in seinem Kopf. Was ist in zehn Jahren, wenn du eigentlich deinen sechsundzwanzigsten Geburtstag feiern solltest? Oder in zwanzig oder dreißig Jahren? Glaubst du ernsthaft, dass niemand merken wird, wie alle um dich herum altern und sich verändern, nur du nicht?
Die Situation, die er für sich geschaffen und so sorgfältig in die Rahmenbedingungen seines alten Lebens eingepasst hatte, war nie von Dauer gewesen, erkannte er nun niedergeschlagen. Und das hatte sie auch nicht sein können. Denn er hatte sich an Schatten der Vergangenheit und Erinnerungen geklammert. Erneut musste er an Camille und an ihr Angebot denken. Mittlerweile klang es deutlich verlockender als noch vor ein paar Tagen: das Angebot, Teil einer Gemeinschaft zu werden, selbst wenn es sich nicht um die Gemeinschaft handelte, die er sich wünschte. Ihm blieben nur noch drei Tage, bis die Vampirdame eine Reaktion von ihm erwartete. Und was würde er ihr dann sagen? Er hatte gedacht, er würde die Antwort kennen, doch inzwischen war er sich nicht mehr so sicher.
Ein knirschendes Geräusch riss ihn aus seinen düsteren Gedanken. Das Garagentor bewegte sich langsam nach oben und grelles Tageslicht drang in die Dunkelheit des Raumes. Simon setzte sich ruckartig auf; sein ganzer Körper war plötzlich in Alarmbereitschaft versetzt.
»Eric?«
»Nein. Ich bin’s nur. Kyle.«
»Kyle?«, wiederholte Simon verständnislos, ehe er sich erinnerte – das war der Typ, den sie als Leadsänger für die Band engagieren wollten. Fast hätte Simon sich wieder auf den Boden gelegt. »Ach ja, richtig. Von den anderen ist momentan keiner da, falls du also gehofft hast, heute proben zu können…«
»Ist schon okay. Deswegen bin ich nicht hier.« Kyle betrat die Garage, die Hände in den Gesäßtaschen seiner Jeans, und blinzelte in die Dunkelheit. »Du bist der… der Dingsda… der Bassist, stimmt’s?«
Simon erhob sich vom Boden und klopfte sich den Staub von der Kleidung. »Hi, ich heiße Simon.«
Langsam schaute Kyle sich um, eine Sorgenfalte auf der Stirn. »Ich muss gestern meine Schlüssel hier irgendwo verloren haben… glaube ich zumindest. Ich hab schon überall danach gesucht. Hey, da sind sie ja.« Er bückte sich, verschwand kurz hinter dem Drumset und kam eine Sekunde später wieder hoch, einen rasselnden Schlüsselbund triumphierend in der Hand. Seit dem Vortag hatte er sich nicht sonderlich verändert; allerdings trug er dieses Mal ein blaues T-Shirt unter seiner Lederjacke und um seinen Hals glitzerte eine Goldkette mit einem Heiligen-Medaillon. Aber seine dunklen Haare wirkten noch verwuschelter als zuvor. »Sag mal«, setzte er nun an und lehnte sich gegen einen der Lautsprecher, »hast du gerade geschlafen? Hier auf dem Boden?«
Simon nickte. »Bin zu Hause rausgeflogen.« Das entsprach zwar nicht ganz der Wahrheit, aber mehr wollte er im Moment nicht preisgeben.
Kyle nickte verständnisvoll. »Deine Mom hat deinen Stoff gefunden, was? Echt übel.«
»Nein. Keinen… Stoff.« Simon zuckte die Achseln. »Wir hatten eine Meinungsverschiedenheit über meinen Lebensstil.«
»Dann hat sie also von deinen beiden Freundinnen erfahren?«, fragte Kyle grinsend.
Er sah wirklich gut aus – das musste Simon ihm lassen. Aber im Gegensatz zu Jace, der um seine Attraktivität genau zu wissen schien, wirkte Kyle wie jemand, der sich wahrscheinlich seit Wochen nicht gekämmt hatte. Allerdings strahlte er eine welpenhafte Offenheit und Freundlichkeit aus.
»Kirk hat mir davon erzählt. Echt cool, Mann«, grinste Kyle.
Simon schüttelte den Kopf. »Nein, darum ging’s auch nicht.«
Einen Moment lang herrschte Stille, dann verkündete Kyle: »Ich… lebe auch nicht mehr zu Hause. Bin schon vor ein paar Jahren ausgezogen.« Er schlang die Arme um seinen Oberkörper, ließ den Kopf hängen und fügte dann mit leiser Stimme hinzu: »Seitdem habe ich nicht mehr mit meinen Eltern geredet. Ich meine, ich komme allein ganz gut klar, aber… ich verstehe, wie das ist.«
»Deine Tattoos…«, wechselte Simon abrupt das Thema und berührte kurz seine eigene Haut, »was bedeuten die?«
Kyle streckte seine Arme. »Shaantih shaantih shaantih«, erläuterte er. »Das sind Mantras aus den Upanishaden. Sanskrit. Gebete für Frieden.«
Normalerweise hätte Simon eine Tätowierung in Sanskrit für ziemlich angeberisch gehalten, nicht jedoch in dieser Situation. »Shalom«, sagte er.
Verwundert schaute Kyle ihn an. »Was?«
»Shalom bedeutet Frieden«, erklärte Simon. »Ist Hebräisch. Ich musste nur gerade daran denken, dass die Worte irgendwie ähnlich klingen.«
Kyle warf ihm einen langen Blick zu; er schien über etwas nachzudenken. Schließlich meinte er: »Das mag jetzt ein wenig verrückt erscheinen, aber…«
»Ach, keine Sorge. Meine Definition von ›verrückt‹ ist in den vergangenen Monaten ziemlich dehnbar geworden.«
». . . aber ich habe eine Wohnung. In Alphabet City. Und mein Mitbewohner ist gerade ausgezogen. Ist eine Zweizimmerwohnung, daher könntest du in seinem ehemaligen Zimmer pennen. Es hat ein Bett und alles, was man so braucht.«
Simon zögerte. Einerseits kannte er Kyle überhaupt nicht und der Gedanke, in die Wohnung eines völlig Fremden zu ziehen, klang nach einem kapitalen Fehler. Möglicherweise entpuppte Kyle sich ja als Serienkiller, trotz seiner Friedens-Tattoos. Andererseits kannte er Kyle überhaupt nicht, was bedeutete, dass dort niemand nach ihm suchen würde. Und welche Rolle spielte es schon, falls Kyle tatsächlich ein Massenmörder war?, überlegte Simon bitter. Das würde dem Jungen schlechter bekommen als ihm selbst, genau wie bei dem Straßenräuber am Abend zuvor.
»Weißt du, was?«, sagte er schließlich. »Ich denke, ich werde dein Angebot annehmen, wenn das okay ist.«
Kyle nickte. »Mein Pick-up steht draußen, falls du mit mir zusammen in die Stadt willst.«
Simon bückte sich nach seiner Reisetasche, richtete sich wieder auf und schob sich die Griffe über die Schulter. Dann steckte er sein Handy ein und spreizte die Arme. »Okay – dann mal los.«