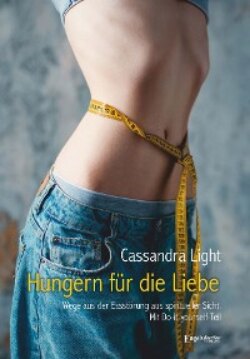Читать книгу Hungern für die Liebe - Cassandra Light - Страница 7
Mit Kinderaugen sehen
ОглавлениеSolange ich mich zurückerinnern kann, war ich ein ganz normales Mädchen. Schon als ich anfing, Fahrrad zu fahren, waren meine Hand- und Fußnägel rot lackiert.
Während ich diese Zeilen schreibe, muss ich grienen.
Ja, ich hatte bunt lackierte Nägel, einen sehr zierlichen Körper, trug schicke Bikinis, Kleider und Röcke und hatte lange dunkelblonde Haare, die ich meist zu zwei Zöpfen gebunden hatte.
So ein richtiges Bild eines Mädchens eben.
Ich achtete schon als Kind auf mein Aussehen. Vielleicht ist das darauf zurückzuführen, dass in der Familie allgemein sehr viel Wert darauf gelegt wurde, was andere wohl dachten. Das »Außen« war allen sehr wichtig.
Darüber hinaus waren Jungen »mehr wert« als Mädchen, und so war es auch deutlich zu spüren, dass die Familie an meiner Stelle damals lieber einen Jungen gehabt hätte.
Dann kam jedoch »Klein Cassandra« – gut so, wie ich finde! Ich bin froh, dass ich hier sein darf, dass ich auf dieser Erde lebe, dass ich eine Frau bin und diese Zeilen schreiben kann.
Ich tat immer das, was von mir erwartet wurde, war lieb, ruhig, unkompliziert und wurde kaum bemerkt.
Im Alter von neun Monaten kam ich bereits in die Kinderkrippe, weil meine Mutter dort arbeitete. Als ich später in den Kindergarten kam, gefiel mir das nicht so. Kaum war ich dort, wurde ich krank. Wurde ich abgeholt, ging es mir besser, und im Nu war ich wieder gesund.
Da meine Mutter als Erzieherin in der Kita arbeitete, in der ich war, und sich die Kinderkrippe sowie der Kindergarten für die Älteren in getrennten Räumlichkeiten befanden, sah ich meine Mutter dort kaum. Wenn ich sie sah, wollte ich zu ihr. Noch heute ist mir in Erinnerung, wie ich vor dem bunten, hohen Kindergartenzaun stand, meine Mutter sah, rauswollte und nicht konnte. Ich weinte, bekam Fieber, mochte nichts essen.
Zwei Jahre später, als meine Schwester in den Kindergarten kam, beruhigte sich die Situation.
Aus heutiger Sicht ist es vollkommen verständlich, wie ich mich als ein so kleines Kind »hinter Gittern« fühlte. Ich stand da, sah meine Mutter. Sie war vor mir und doch so fern. So etwas muss für ein Kind, das auf seine Mutter bzw. seine Eltern angewiesen ist und sich von ihnen getrennt fühlt, enorm schmerzlich sein. Und das war es für mich.
Noch heute wird mir in der einen oder anderen Situation dieses Gefühl der Trennung – »nah und doch so fern« – bewusst. Doch weiß ich jetzt, anders als früher, wo dieses Gefühl herkommt und dass es ein Gefühl ist und keine Tatsache.
In der Schule war das nicht anders. Sie war nicht unbedingt mein Ding. Alle freuten sich, zum Unterricht gehen zu dürfen, nur ich nicht – ich wollte nicht.
Während der ersten zwei Jahre rannte ich morgens weg, wenn der Bus kam. Ich hatte sehr gute und gute Leistungen, doch wollte ich partout nicht in die Schule. Ich wollte zu meiner Oma. Nicht nach Hause und nicht in irgendeine Bildungsstätte – nur zu meiner Lieblingsoma.
Auf den ersten Blick war ich also ein ganz normales Mädchen. Doch eins war anders: Ich war überwiegend allein. Zumindest aus meiner Sicht, und anhand meiner Tagebücher ist es auch so zu deuten. Ich kann mich noch sehr genau an die folgende Situation an einem Freitagnachmittag im Jahre 1999 erinnern:
Meine Schwester und ich waren bei meiner Lieblingsoma zum Mittagessen. Anschließend ging meine Schwester zu Freunden spielen, während ich mich auf den Weg nach Hause machte. Dort hatte ich Langeweile und kam auf die Idee, einen Kuchen zu backen. Als ich nach längerem Suchen ein schönes Rezept fand, für das ich alle Zutaten zur Verfügung hatte, ging es los: »Selterskuchen backen« hieß die Mission!
Schon bald war der Kuchen im Backofen. Die Zeit, die er brauchte, um fertig zu backen, nutzte ich und räumte auf. Ich rief meine Mutter an und fragte sie, wann sie nach Hause käme. Um 14.30 Uhr wollte sie da sein. Bis dahin blieb mir nicht mehr viel Zeit. Ich schaffte es trotzdem, rechtzeitig den Tisch zu decken, aufzuräumen, Kaffee zu kochen und die Wäsche abzunehmen.
Alles war vorbereitet. Ich war so gespannt, denn ich wollte meiner Mutter und nach Feierabend auch meinem Vater eine Freude machen und sie mit meinem gemütlich gedeckten Kaffeetisch und dem selbst gebackenen Kuchen überraschen.
14.30 Uhr war vorbei, doch Mutti kam nicht. Also wartete ich, bis sie von der Arbeit zurückkehrte. Als sie endlich da war, fand ich, dass ihre Begeisterung gar nicht so groß war, wie ich es mir ausgemalt hatte. Na ja, war nicht so schlimm. Ich lobte mich selbst für meinen Kuchen.
Es ist traurig, in meinen damaligen Tagebüchern zu lesen und mich daran zu erinnern, dass ich mich selbst lobte. Aus meiner heutigen Sicht ist ein zwölfjähriges Mädchen eben nicht in der Lage, sich ausschließlich selbst zu loben. In jeder Phase des Lebens braucht ein Kind Liebe und Zuneigung, und gerade in der Zeit der Entwicklung sind liebevolle, anerkennende Worte Balsam für die kleine Kinderseele. Balsam, der mir fehlte. Diese Worte berühren mich, denn aus heutiger Sicht tut mir das Kind – also ich – leid.
Als zwölfjähriges junges Mädchen stand ich da, wollte meiner Mutter eine Freude machen und hätte gerne ein Lob gehört. Ich wollte sie entlasten – nicht nur an diesem Tag. Stets gab ich mir große Mühe und begann, um ihre Anerkennung zu kämpfen. Doch von ihr kam nie eine Reaktion. Das Gleiche gilt für meinen Vater. Meine Mühe wurde nicht gesehen und schon gar nicht gewürdigt.
Wenn ich mich heute in das Mädchen von damals hineinversetze, sehe ich, dass es für mich völlig unverständlich war und ich diese Ignoranz als Ablehnung empfand. Ich bezog die gerade beschriebene und ähnliche Situationen auf mich persönlich, fühlte mich nicht angenommen und geliebt. Heute weiß ich, dass meine Eltern nach bestem Wissen und Gewissen handelten. Ich vergebe ihnen, denn ich liebe sie so, wie sie sind. So, wie sie waren. Sie gaben ihr Bestmögliches und hatten ihre eigenen Ängste. Es gab Gründe, weshalb ihnen so wenig Zeit für mich zur Verfügung stand. Einer dieser Gründe war die Arbeit, weshalb wir es materiell immer gut hatten und für mich und meine Schwester gesorgt war.
Diese Erfahrungen der Kindheit schenkten mir jedoch schon ganz früh die Fähigkeit, ganz bei mir zu sein, in meiner Mitte. Sie ermöglichten es mir, mir selbst durch den Blick nach innen Liebe, Wärme, Lob und Aufmerksamkeit zu schenken. Aus dem Bedürfnis wurde eine Stärke.
Ein Kind ist von Natur aus offen und nicht geprägt von Ängsten und Erfahrungen. Es blickt liebevoll, voller Erwartungen, Freude und mit offenem Herzen, voller Licht in unsere Welt. Es ist zerbrechlich, verletzlich, unendlich sensibel und liebebedürftig.
Es darf immer gesehen werden: Ein Kind kommt unbefleckt auf diese Welt und weiß nicht, wie ihm geschieht. Es ist einfach da.
Ich wünsche vielen Kindern auf dieser Welt, dass sie sanft, liebevoll, voller Verständnis und vorsichtig behandelt werden. Und ich wünsche genauso den Eltern das Bewusstsein für diese Liebe. Die Fähigkeit, so lieben und ihren eigenen Eltern deren Fehler vergeben zu können. Es ist nicht unsere Pflicht, die Fehler und Ängste unserer Eltern zu übernehmen. Wir haben die Wahl.
Ein Kind bezieht alles auf sich und kann nicht verstehen, warum seine Eltern so handeln, wie sie handeln. So, wie auch ich das nicht verstehen konnte. Ich dachte, ich wäre der »Fehler im System«, den keiner lieben wollte. Der es nicht wert war, geliebt zu werden. Allein. Verloren und ohne Halt. Geboren, um sich hier auf dieser Welt durchzukämpfen und dann doch keine Liebe zu erfahren.
Auf diese Weise begann ein ablehnendes Bild meiner selbst in mir zu wachsen. Da war aus meiner damaligen Sicht nichts. Nichts, woran ich hätte festhalten können außer Schule, Leistungen, mein Ich sowie die Gedanken und Gefühle, mit denen ich allein war.
Es gab mich, mein Tagebuch und die Leidenschaft zu schreiben. Bereits mit sieben Jahren schrieb ich täglich Ereignisse, Gedanken und Gefühle nieder. Alles, was mich bedrückte, verletzte, erfreute, und das, was in mir vorging, schrieb ich in mein Tagebuch hinein. Es war mein Freund und Begleiter. Doch auch hier war ich allein, ich erfuhr keine Reaktion auf meine Gedanken.