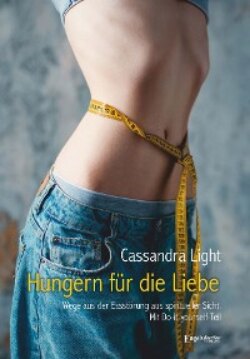Читать книгу Hungern für die Liebe - Cassandra Light - Страница 8
Ein Blick zurück
ОглавлениеIch erinnere mich zurück und weiß, dass das Nicht-Essen schon eine Rolle spielte, seitdem ich bewusst wahrnehmen konnte, was um mich herum geschieht. Allgemein das Thema Essen hatte einen besonderen Stellenwert, insbesondere aber gemeinsame Mahlzeiten. Bei uns in der Familie gab es diese kaum. So mancher denkt vielleicht: Na was denn sonst? Gemeinsame Mahlzeiten sind doch wohl normal! Und ich sage aus meiner Sicht: Nein, das sind sie eben nicht.
Ja, bei uns gab es Mahlzeiten. Diese nahm ich zusammen mit meiner kleinen Schwester ein. Währenddessen wuselte meine Mutter in der Küche herum, erledigte Arbeiten, die ihr dort in die Hände fielen, machte sauber oder schmierte die Arbeitsbrote für meinen Vater. Alles natürlich weit weg vom Tisch und im Stehen.
In den seltensten Fällen konnten meine Schwester und ich unser Abendbrot in Gegenwart unseres Vaters genießen. Und auch hier saß meine Mutti nicht mit am Tisch. Sie bereitete lediglich das Essen für alle zu, doch sich selbst nährte sie nicht, jedenfalls nicht gemeinsam mit uns. Sie aß nebenbei.
Als Kind orientierte ich mich an meinen Eltern. Ich beobachtete, was meine Mutter aß. Immer wieder fragte ich mich: Was esse ich? Ist das normal? Sie isst anders. Esse ich zu viel?
Wenn ich das verglich, dachte ich: Ja, dann esse ich wohl zu viel. Es ist doch unnormal, wie viel ich esse.
Mich ärgerte es, denn ich wünschte mir, dass wir alle zusammen aßen. Doch das gab es nicht. Ich empfand es so, als würden wir von unserer überanstrengten, genervten Mutter etwas zu essen vorgesetzt bekommen, getreu dem Motto: »Um zu leben, gehört Essen dazu.« Und ihre Pflicht – ob sie wollte oder nicht – war es, uns Kinder zu versorgen. Das tat sie. An Essen mangelte es nicht, an einer liebevollen, gemeinsamen Mahlzeit schon.
Zu Recht stellte ich mir irgendwann die Frage: Warum soll ich denn essen? Sie isst doch auch nicht!
Ich verband mit Essen keinen Genuss, keine Liebe, sah es nicht als etwas Schönes an, vielmehr empfand ich es als Mittel zum Zweck. Für mich war es eher ein Muss. Man möchte leben, also braucht man Nahrung. Nicht mehr und nicht weniger.
Jetzt, mit vierunddreißig Jahren, bin ich an dem Punkt, an dem mir bewusst wird, was ich mit dem Essen verbunden habe und auch teilweise noch verbinde. Und zwar genau das: etwas Notwendiges. Nichts Schönes. »Das Mittel zum Zweck« – vom Genuss ganz weit entfernt.
Ich begann, mein Leben, meine Eltern und das Essen zu hassen. Ich wollte nicht mehr auf dieser Welt sein. Essen hieß Leben, und leben wollte ich nicht. Ich ließ Stück für Stück das Essen weg und entfernte mich dadurch immer weiter vom Leben. Mit jedem Hungergefühl war ich dem Leben ferner, während ich meinem Wunsch, nicht mehr auf dieser Welt zu sein, näher kam. Essen zu mir zu nehmen fiel mir immer schwerer, denn »es« arbeitete sozusagen gegen mich. Gegen das festgesetzte Ziel: Raus aus dieser Welt und endlich das Ende des Lebens erreichen! In Frieden und Liebe »da oben« leben und nicht lieblos, allein und pflichtbewusst »hier«.
Mit der Nahrungsaufnahme kam der Widerstand. Es quälte mich, wenn ich aß. Jeder Bissen erzeugte Abwehr in mir. Mit jedem Bissen kamen Wut und Verzweiflung in mir hoch. Mein Ziel war es, in Ruhe zu sein. In Frieden. In Liebe. Widerstandslos. Ohne Essen auszukommen.
Jeder, der mir Essen anbot, mich zum Essen überreden wollte, wollte mich aus meiner Sicht an meinem Ziel hindern und mich am Leben halten. Ich jedoch wollte das Leben nicht und empfand Wut, Zweifel und Abwehr gegen alles und jeden, der sich mir bei meiner Zielerreichung, aus dem Leben zu gehen und in Frieden zu sein, in den Weg stellte.
Die ersten Gedanken in diese Richtung hatte ich bereits mit neun Jahren. Wer möchte schon einen unendlichen und letztendlich erfolglosen Kampf um die Liebe führen?!
Also begann ich einen Kampf gegen mich selbst. Dafür brauchte ich niemanden, diesen Kampf konnte ich mit mir selbst ausmachen. Ich führte ihn ganz allein. Es lag in meiner Hand, wie der Kampf lief, und niemand konnte den Erfolg oder die Mühe, die ich investierte, ablehnen. Niemand konnte mich ablehnen, denn ich brauchte keinen Menschen mehr und lehnte jeden ab. In diesem Kampf war ich von niemandem außer von mir selbst abhängig. Auf keinen Fall wollte ich mehr jemanden oder eine bestimmte Reaktion brauchen und auf Liebe, Beachtung, Anerkennung oder Lob warten müssen.
Ich war unabhängig.
Scheinbar.
Ob Lob, Anerkennung, Tadel, Verurteilung, Leben oder Tod – all dies lag in meiner Hand. Es war nicht nur eine Entscheidung, sondern meine Entscheidung.
Irgendwann drang der Wunsch, nicht mehr auf dieser Welt sein zu wollen, nach außen und wurde sichtbar. Einerseits war das gut für mich, denn ich war dem Tod tatsächlich nah. Andererseits wurde es sehr schwierig, meinen Kampf ohne das Außen, ohne Eltern oder Lehrer weiterzuführen. Ich wurde immer verzweifelter, weil ich die Reaktion meiner Mitmenschen ignorierte und sie nicht mehr verstand.
Freitag, der 29.09.2000
Hallo liebes Tagebuch!
Zum Glück ist heute Freitag. Wir haben dieses Wochenende ein verlängertes Wochenende. Montag und Dienstag wird frei sein.
Ach, liebes Tagebuch, ich habe im Moment nur Sorgen. Am Mittwoch hat mich meine Klassenlehrerin in der Deutschstunde gefragt, wie tief mein Problem denn ist und ob ich breche. Sie hat mit meiner Mutter auf der Elternversammlung gesprochen und so weiter und so fort.
Na, jedenfalls glauben alle, ich bin krank.
Und ich, ich bin am Ende. Ich bekomme von allen Seiten Druck. Es heißt nur:
Esse! Esse!
Okay, am Mittwoch habe ich es eingesehen, aber jetzt sehe ich das schon wieder nicht. Ich bin nicht krank!
Ich will mir ja Mühe geben, aber irgendwie bekomme ich, wenn ich essen muss, immer schlechte Laune. Und auch so bekomme ich schnell schlechte Laune.
Das geht mir alles so auf den Keks. Ich weiß nicht, was das ist, aber eine Essstörung habe ich nun wirklich noch nicht. Mutti setzt mich so unter Druck. Da kann man auch schlechte Laune bekommen.
Ich glaube, die sollten mich einfach in Ruhe lassen, vielleicht wird es dann besser. Ich fühle mich auch so beobachtet und alle fragen so viel und schreiben mir alles vor. Zum Beispiel, was ich essen soll – dass ich keine Margarine nehmen darf, sondern Butter nehmen muss.
Ich wünschte, es wäre alles nicht so schwer. Ich will nicht immer schlecht gelaunt sein und ich will nicht so bedrängt werden. Das nervt total. Ich hoffe, ich bekomme das in den Griff mit der Laune. Ich hoffe auch, nachher beim Einkaufen nicht wütend zu werden. Das kenne ich gar nicht von mir, aber wenn es um Essen geht, dann passiert das so.
Dienstag, der 10.10.2000
Ich habe nicht viel Zeit, jetzt einzuschreiben. Ich muss noch duschen, Abendbrot essen und dann wieder pauken. Physik, Chemie und Musik zu morgen.
Wir hatten heute Sportfest. Es war eiskalt. Ich habe gedacht, ich sterbe. Alles tat mir weh vor Kälte, und dann mussten wir noch kurze Sachen anziehen. Ich bin froh, dass das jetzt vorbei ist.
Um 17.00 Uhr bin ich vom Konfirmationsunterricht gekommen.
Kaum bin ich hier, habe ich wieder Ärger mit Mutti gehabt – wegen Essen. Sie war nahe daran, mir eine zu knallen. Ich schätze, die Woche und nachher das Abendbrot wird die Hölle werden. Die ganze Woche nur Arbeiten in der Schule und Ärger mit Mutti und Vati wegen Essen.
Liebes Tagebuch, wünsche mir Glück!
Mittwoch, der 18.10.2000
Ich habe heute einen anstrengenden Tag gehabt. Auch so war die ganze Woche bis jetzt sehr anstrengend und es ist noch kein Ende zu sehen.
Heute haben wir Physik und Chemie wiederbekommen. In Physik habe ich eine 2 und in Chemie eine 1. Wir haben in dieser Woche bis jetzt nur Arbeiten geschrieben. Ich weiß schon gar nicht mehr, welche ich zurückbekommen werde. Außerdem kann ich langsam nicht mehr.
Dienstag haben wir Chemie und Russisch geschrieben, wobei wir Freitag erst die letzten Arbeiten bekommen haben. Da waren ja nur das Wochenende und der Montag zwischen. Weil nur ein Tag dazwischen lag, war ich gar nicht darauf gefasst, wieder eine Arbeit zu schreiben. In Russisch habe ich leider nicht alles gewusst. Morgen bekomme ich die Arbeit in Russisch wieder und in Englisch und Mathe schreiben wir.
Wenn ich Zeit habe, schreibe ich wieder mehr ein.
Mein Wochenende ist aber auch komplett voll.
Nächste Woche stehen schon drei Arbeiten fest: Montag Russisch Klassenarbeit, Dienstag Biologie und Freitag Englisch Klassenarbeit.
So, ich mache jetzt Schluss. Ich brauche eine Pause. Dann geht es weiter. Anschließend dann wieder Stress mit Mutti und Vati wegen Abendbrot essen, dann wieder lernen und dann ins Bett.
Irgendwer da draußen: Wünscht mir einfach nur Glück, dann bin ich beruhigter.
Ich bat irgendjemanden, wahrscheinlich Gott, mir Glück zu wünschen.
Glück – doch was hieß denn Glück in dem Moment?
Das Glück war, den Ärger zu umgehen, Ruhe zu haben und gleichzeitig nicht essen zu müssen. Ohne Essen davonzukommen.
Am liebsten würde ich nie hier gewesen sein und nicht leben.
Na ja, leider nicht zu ändern.
Der Wunsch, von dieser Welt gehen zu wollen, wurde von Tag zu Tag stärker. Ich erinnere mich noch genau daran, dass ich jeden Tag mehr spürte, wie schwach ich körperlich wurde. Das Herz schlug langsamer.
Dieser schleppende Herzschlag war spürbar. Es fühlte sich anstrengend an. Anstrengung, die das Herz aufbringen musste, um zu schlagen. Das Herz hatte im wahrsten Sinne des Wortes zu kämpfen.
Das Herz wurde langsamer und langsamer. Es ging in Richtung Stillstand. Mit der schrittweisen Verabschiedung des Herzens wuchs mein Wille, nicht mehr zu leben, von Tag zu Tag mehr. Der Wille, das, was am Leben hält, zu verweigern. Nahrung. Wuchs.
Donnerstag, der 19.10.2000
Wir haben heute die Arbeit in Mathe geschrieben.
Ich habe heute meine Schulstullen nicht gegessen.
Ich kann nur jetzt nicht so viel schreiben, muss noch lernen, Abendbrot usw.
Zusätzlich als Plus: Natürlich wieder Zoff mit Mutti und Vati, davon bekomme ich ja jeden Tag genug. Du weißt ja …
Sonntag, der 29.10.2000
Eben habe ich Abendbrot gegessen – könnte schon wieder richtig sauer werden, aber lieber nicht, sonst fange ich noch an zu heulen.
Noch heute bin ich ein Genie in Sachen Unterdrücken, und wenn in mir Wut hochkommt, neige ich dazu, sie wegdrücken zu wollen. Doch inzwischen weiß ich, woher sie kommt und dass ich mir jahrelang antrainiert habe, Gefühle wie eben Wut oder aber Traurigkeit nicht fließen zu lassen.
Aus meiner Sicht sollte es Weinen nicht geben. Wozu auch?
Wenn ich im Normalzustand – also dann, wenn alles funktionierte, wie es sollte – schon »zu viel« war. Dann ging ja Weinen überhaupt nicht.
Darüber hinaus war niemand da, der mich verstand und mich in den Arm genommen hätte. Dementsprechend suchte ich nach einem anderen Weg für mich: Gefühle unterdrücken und einfach funktionieren. Keine Rücksicht auf mich selbst. Alles andere war fehl am Platze – so meine Erfahrung zu diesem Zeitpunkt.
Morgen wollen Marleen und ich mit Oma bummeln gehen. Vorher muss ich aber noch mit Mutter zur Ärztin fahren. Ich muss Blut abnehmen lassen. Vielleicht wiegt mich ja die Ärztin wieder. Scheißegal!
Ich lese jetzt ein bisschen und dann gehe ich schnell ins Bett. Gelernt habe ich schon.
An diesem Abend lag ich im Bett und mein Herz schlug so langsam. Es fühlte sich an, als müsste es sich unglaublich anstrengen, um zu schlagen. Ich quälte mich und selbst das Liegen empfand ich als anstrengend.
Ich konnte kaum noch richtig schlafen. Ich merkte, es würde bald zu Ende gehen und mein Herz würde für immer stehen bleiben. Ich dachte, dass ich von dem Moment an frei wäre. Ich hätte keine Qualen mehr auszustehen und es gäbe keinen Kampf mehr. Nicht den Kampf gegen mein Leben, und auch nicht jenen, den ich sowieso schon längst aufgegeben hatte: den Kampf um Liebe.
Wenn mein Herz stehen bliebe, hätte endlich das Kämpfen ein Ende.
Meine Tage waren geprägt von Leistungsdruck, von Stress, Streit und den Gedanken, die sich um das Ende meines Lebens drehten.
Ein ständiger Kampf.
Nur der Wille trieb mich voran.
Mein Umfeld reagierte erst sehr spät auf meine Veränderungen. Aus heutiger Sicht viel zu spät. Ich frage mich manchmal: Hat es niemand gesehen, dass ich dünner und dünner wurde? Erst als ich dem Tod näher war als dem Leben, wurde mein Erscheinungsbild angesprochen. Das macht erschreckenderweise sehr deutlich, dass kaum jemand auf mich achtete und ich einfach »zu viel« war. Und wie vielen Menschen geht das so?
Noch heute berührt mich diese »Blindheit«, weshalb mir so viel daran liegt, die Menschen wachzurütteln und ihnen mitzuteilen: Macht eure Augen auf und achtet euer Umfeld! Lebt nicht so dahin und funktioniert wie Roboter. Erweitert euer Bewusstsein, fangt an zu fühlen, zu sehen und füreinander da zu sein. Geht mit offenen Augen und aufmerksamem Bewusstsein durch euer Leben. Seid aufmerksam gegenüber allen Menschen, mit denen ihr in Kontakt steht, sei es in der Familie, im Freundeskreis oder bei neuen Begegnungen. Seid offen und wertschätzt euch doch bitte gegenseitig.
Lehrte uns nicht Jesus, wie in der Bibel geschrieben steht: »Hebe deine Augen auf und sieh!«
In meinem Fall war dieses Bewusstsein noch nicht da – weder bei mir selbst noch bei meinem Umfeld –, und so spitzte sich die Situation immer mehr zu.
Einen Monat nach dem bisher letzten Eintrag, fünf Tage vor meinem vierzehnten Geburtstag, kam ich in ein Krankenhaus. Ich hatte laut der ärztlichen Meinung noch drei Tage zu leben, mein Herzschlag war wie der einer achtzigjährigen Dame, die kurz vor dem Einschlafen war, und die Ärzte wussten nicht, ob ich es schaffen würde.
Donnerstag, der 30.11.2000
Ich habe schon so lange nicht mehr eingeschrieben. Doch jetzt muss ich dir etwas schreiben.
Ich bin hier gerade im Krankenhaus. Ich kann nicht mehr. Ich vermisse Mutti, Vati, meine Schwester und meinen Kater. Ich darf keine Besuche, keine Anrufe und keinen Briefkontakt haben. Nichts.
Am Dienstag habe ich Geburtstag. Na toll!
Ich sollte eigentlich erst am Freitag hierher. Doch Mutti meinte, es hat keinen Zweck mehr, noch zu warten …
Nun bin ich schon heute hier.
Ich will hier raus. Ich kann nicht mehr. Liebe Engel, helft mir doch! Ich vermisse sie so sehr.
Der Arzt hat heute gesagt, es kann bis Februar dauern, bis ich hier raus bin. Er hat auch gesagt, dass ich einen Body Mass Index von 13 habe, und unter 17 ist es schon Magersucht und lebensbedrohlich. Er meinte, ich bin so dünn, dass ich jede Minute sterben könnte. Ich habe Angst und keiner ist hier, der mich tröstet. Ich vermisse sie alle so.
Mir laufen die Tränen, denn das bin ich, die da so um Hilfe schrie. Das tut weh. Ich war gerade noch dreizehn Jahre alt, saß in diesem Krankenhaus und wusste nicht, was mit mir geschah. Drum herum dachten sie, ich würde bald sterben, und ich stand mit meiner Angst ganz allein da.
Die Bestätigung: Wieder allein!
Ich bin froh, dass ich diese Zeit überstanden habe. Aber sie hat mich geprägt – und auch die Beziehung zu meinen Eltern. Denn mit dreizehn getrennt von allem zu sein, das konnte ich bis jetzt nicht vergessen. Ich verzeihe, aber es sitzt so tief, dass mir das Vergessen nicht gelingt.
Noch heute ist es bei mir so, dass Vertrauen mit Angst einhergeht. Angst davor, wieder allein gelassen zu werden. Dabei ist es vorbei und ich weiß: Diese Angst ist nicht mehr real. Wissen ist aber nicht Fühlen, und so lerne ich nur langsam, Stück für Stück, neu zu vertrauen. Noch heute.
Die größte Hilfe war damals meine Oma. Denn nachdem ich über Jahre in Behandlung und in verschiedenen Krankenhäusern gewesen war, zog ich zu ihr. Wir hatten eine wundervolle Zeit zusammen. Bei ihr durfte ich bedingungslose Liebe kennenlernen. Sie liebte mich unendlich und zeigte mir, dass ich vertrauen durfte und konnte. Dass ich wütend sein durfte und weinen konnte, dass ich in den Arm genommen wurde und ich nicht allein war. Dass ich gut bin, so wie ich bin. Dass ich immer geliebt werde – egal wie die äußeren Umstände sind.
Höre auf dein Herz! Unser innerster Kern zählt – nur der.
Alles andere ist vergänglich und nebensächlich.
Die Seele bleibt.