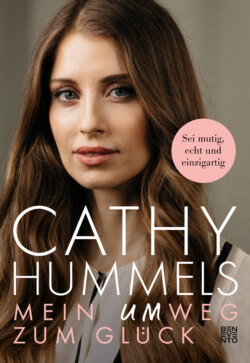Читать книгу Mein Umweg zum Glück - Cathy Hummels - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 Wie alles losging
ОглавлениеDer dreißigste Geburtstag ist für die meisten eine wichtige Wegmarke. Mit dreißig ist man irgendwie erwachsen, oder sollte es sein, ist im Leben angekommen. Ausreden zählen nicht mehr. Meinen runden Geburtstag feierte ich ganz groß in München, mit meiner Familie, Freunden, die mich seit vielen Jahren begleiten, mit Menschen, die mich auf meinem bisherigen Weg unterstützt haben. Ich wurde dreißig und ich wurde auch Mutter – gab es einen besseren Grund für eine Party?
Mein Fest hatte ein Motto: Rot und Glitzer. Ich wollte die Liebe feiern, und die Farbe der Liebe ist nun mal Rot, und der Glitzer, na ja, der war das kleine, aber feine i-Tüpfelchen obendrauf. Ich habe es ja immer schon gern ein bisschen glitzern und glamouren lassen, meine Familie kann davon ein Lied singen.
Die Gäste erfüllten den Dresscode mit Bravour. Mein Vater trug ein cooles rotes T-Shirt, meine Mutter eine rote Federboa. Die beiden sind seit 1982 verheiratet, darauf können sie wirklich stolz sein. Ich bin es jedenfalls. Sie sind, auch wenn jede Ehe Höhen und Tiefen durchschreitet, für mich das beste Beispiel, wie erfüllend eine lebenslange Beziehung sein kann. Und deswegen fand ich es besonders toll, dass sie gemeinsam mit mir feierten und sich dem Motto entsprechend in Schale schmissen.
Meine Kindheit war sehr behütet. Gemeinsam mit meinem Bruder Sebastian und meiner Schwester Vanessa wuchs ich in Unterschleißheim auf, einer Kleinstadt im Norden Münchens, und ich weiß noch, wie frei und leicht das Leben sich damals anfühlte. Wir drei haben immer etwas mit anderen Kindern unternommen, meine Mutter achtete darauf, dass wir viele andere Gleichaltrige um uns hatten, am liebsten spielten wir natürlich draußen. So etwas wie Langeweile jedenfalls gab es nicht. Und wann immer sich eine Gelegenheit ergab, packten uns unsere Eltern ins Auto und wir fuhren in die Berge, im Winter zum Skifahren, im Sommer zum Wandern. Meine Eltern waren begeisterte Camper, in den ersten Jahren haben wir gezeltet, später hatten wir einen Wohnwagen und wir verbrachten die Urlaube mit Freunden meiner Eltern auf Campingplätzen.
In den Sommerferien fuhren wir oft für mehrere Wochen an die Adriaküste ins damalige Jugoslawien. Aus dem Fernsehen kannten wir natürlich die alten Karl-May-Filme und waren begeistert, auf dem Weg ans Meer durch wilde »Westernlandschaften« zu fahren, dort, wo damals Winnetou gedreht worden war. Aus Kindersicht fühlten sich die Sommerferien an wie eine Ewigkeit. Der Gedanke, irgendwann sind die sechs Wochen rum und die Schule geht wieder los, der war unvorstellbar. Kroatien war immer wieder ein einziges großes Abenteuer. Später verbrachten wir die Ferien auch in Italien, weil wir Kinder uns mal einen Sandstrand wünschten. Meine Eltern bevorzugten zwar die Steinstrände der Adria, aber meine Geschwister und ich waren in der Überzahl und das ein oder andere Jahr konnten wir unseren Willen durchsetzen.
Zu Kroatien entstand damals, trotz der harten Kieselsteinstrände, eine innige Liebe. An der Küste von Posedarje in der Nähe von Zadar kauften wir vor ein paar Jahren ein Ferienhaus, hier finde ich Ruhe, wenn ich dem Alltagsstress mal entfliehen möchte, hier gebe ich auch Yoga-Retreats. Ein bisschen ist mir – auch dank der schönen Kindheitserinnerungen – Kroatien zur zweiten Heimat geworden.
Bei allen unseren Unternehmungen, seien es wochenlange Familienurlaube oder Tagesausflüge mit Tante und Cousinen, war meine Mutter eigentlich immer die treibende Kraft. Mein Vater, der beruflich sehr eingespannt war, überließ die Organisation gerne seiner Frau, er kümmerte sich im Gegenzug um Ausrüstung und Verpflegung. Ihr mangelte es auch nie an Ideen, mit welchem kleinen Abenteuer sie uns mal wieder überraschen könnte.
Meine Mutter, Marion Fischer, gebürtige Messmann, kam 1961 in München zur Welt. Ihre Eltern wohnten in Unterschleißheim, damals war der Ort noch mehr Dorf als Stadt, ein Krankenhaus gab es nicht, nur einen Arzt. Kindheit und Jugend verbrachte meine Mutter in Unterschleißheim, dort lebt sie, mit meinem Vater, bis heute. Eigentlich wäre sie gern mal woanders hingezogen, aber das ergab sich irgendwie nie.
Das Thema Rollenverteilung von Frau und Mann war für meine Mutter und ihren Werdegang immer ein ganz zentrales. Denn auf gar keinen Fall würde sie – wie ihre eigene Mutter und viele andere dieser Generation – später irgendetwas in Richtung Hauswirtschaft machen. Das Modell Mann, Kind und Haushalt, no way, sagte sich meine Mutter. Mann, Kind, Haushalt und Job, ja, das unbedingt. Sie wollte ihr eigenes Geld verdienen, auf eigenen Beinen stehen und von niemandem abhängig sein.
Um beruflich voranzukommen, wäre sie am liebsten aufs Gymnasium gegangen, aber der Rektor riet ab, schlimmer noch, er warnte gar, das Gymnasium sei nicht die richtige Lehranstalt für Mädchen. Das sei wenig sinnvoll, denn sie bekämen Kinder und das war’s, meinte er. Was für ein moderner, weitsichtiger Pädagoge … Meine Mutter durfte also nicht aufs Gymnasium wechseln, eine weiterführende Schule ließ sie sich aber nicht verbieten und bewarb sich heimlich an der Realschule. Dafür benötigte sie die Unterschrift ihrer Eltern, und die bekam sie auch, aber das ganze Prozedere hat sie letztlich allein durchgezogen.
Ich bewundere sie dafür, wie sie ihr Ding gemacht hat. Meine Mutter war schon immer eine taffe Frau. Dem Realschulabschluss folgte eine Banklehre, anschließend erwarb sie an der BOS die fachgebundene Hochschulreife, um an der LMU in München Steuerrecht und Revisions- und Treuhandwesen studieren zu können. Als Studienschwerpunkt entschied sie sich für Steuerrecht, um sich später mit eigenem Büro niederlassen zu können. Denn zu dem Zeitpunkt war die Familiengründung in vollem Gange. Mein großer Bruder Sebastian war schon auf der Welt, und meine Mutter nahm ihn gelegentlich mit zu den Vorlesungen. Nach der Uni machte sie wie geplant ihren Steuerberater und ging in die Selbstständigkeit.
Die Entscheidung für Familie plus Karriere, sagt sie heute, sei goldrichtig gewesen, und sie würde es jederzeit genauso wieder machen. In dieser Beziehung ist meine Mutter Vorbild für mich. »Nur« den Haushalt zu managen, wäre für sie auch schon deswegen nie infrage gekommen, da sie der Meinung war, der Job einer Hausfrau und Mutter werde gesellschaftlich zu wenig wertgeschätzt. Schon als Kind hatte sie sich in den Kopf gesetzt, sich nicht mit den typischen Mädchen-Dingen abspeisen zu lassen. Dass die Jungs in der Schule werken und basteln durften, während die Mädchen stricken mussten, das sah die kleine Marion nicht ein. Sie bestand darauf, das zu tun, was sie tun wollte, und nicht das, was andere für sie entschieden hatten. Zum Beispiel wollte sie auch Fußball spielen – und natürlich durfte sie auch das nicht. Für Mädchen gab es damals noch nicht mal einen Fußballverein!
Alfred Fischer, mein Vater, ist ein waschechter Münchner. Von Beruf Bauingenieur, aus Berufung Musiker. Seine Kindheit unterschied sich fundamental von der meiner Mutter. Hier die Messmanns, eine eher kleinbürgerliche Handwerkerfamilie in Unterschleißheim, dort die großbürgerliche, wohlhabende, aber auch – vor allem für damalige Zeiten – eher unkonventionelle Familie Fischer/Sieber in München.
Seine Mutter, meine Oma Hildegard Fischer, war Modedesignerin, und ihr Mann, Großvater Ludwig Sieber, ein bekannter Architekt in Nürnberg und München. Die beiden waren nie verheiratet und zum Zeitpunkt von Papas Geburt auch längst schon kein Paar mehr, vermutlich passte ein Kind auch gar nicht in ihr Leben. Ich mag darüber nicht urteilen, nachvollziehen kann ich ihre Entscheidung, das eigene Kind nicht selbst großzuziehen, sondern wegzugeben, nicht.
Mein Großvater arbeitete in den USA, als mein Vater – ein klassischer »Betriebsunfall« – in München zur Welt kam. Sein Beruf als Architekt brachte es mit sich, dass er mal hier, mal da lebte und Häuser für eine sehr reiche Klientel entwarf. Mein Vater war fast zwei Jahre alt, als sein Vater nach Deutschland zurückkehrte. Weil auch meine Oma berufstätig war, verbrachte der Kleine sein erstes Lebensjahr bei den Eltern seiner Mutter. Als gelernte Schneiderin und Schnittdirektrice hatte sich Hildegard im Modedesign spezialisiert. Sie arbeitete mit angesehenen Geschäftsleuten ihrer Branche zusammen und war beispielsweise mit Willy Bogner befreundet. Sie liebte die Modewelt und führte ein modebewusstes Leben. Für ihren Sohn hatte sie in jungen Jahren wenig Zeit. Damals hatte man es als ledige Mutter aber auch alles andere als leicht. Sie musste sich selbst durchs Leben schlagen. Schließlich wurde mein Vater krank. Vielleicht lag es an einer zu einseitigen Ernährung, das weiß niemand mehr so genau, die Ärzte diagnostizierten Tuberkulose bei ihm. Er brauchte professionelle Hilfe und kam für ein Jahr in ein Sanatorium in den Bergen, nach Achatswies. Man überlegte hin und her, wie man nach der Genesung des Kindes weiter vorgehen würde und ob es nicht das Beste wäre, ihn in ein Heim zu geben. Gott sei Dank kam es anders. Der Vater seines Vaters sprach ein Machtwort und er kam zu seinen Großeltern väterlicherseits. Jetzt hatte er endlich und zum ersten Mal ein richtiges Zuhause und blühte auf. Leider starb der Großvater, kurz bevor mein Vater eingeschult wurde. Danach war seine Oma die alleinige Erziehungsberechtigte. Seinen Großeltern ist er bis heute unendlich dankbar, nur durch sie sei etwas aus ihm geworden.
Trotzdem waren diese Kindheitsjahre sicherlich keine leichten für meinen Vater, er hat sich aber nie beklagt, für ihn war es »normal«. Im Alter von elf oder zwölf Jahren bekam er seine erste eigene Gitarre und fing an, Musik zu machen. Die Musik war seine Rettung, sein Weg, sich zu emanzipieren. Das finde ich ganz stark von ihm, und darauf kann er stolz sein. Er ist Autodidakt, brachte sich alles selbst bei. Unterricht war damals leider keine Option, obwohl er ihn sehr gern genommen hätte. Er war durchaus erfolgreich, spielte in München in einer Band, mit der er auf Veranstaltungen, Familienfesten und Hochzeiten auftrat. Mit der Musik verdiente er sein erstes eigenes Geld – er war ein richtiger Rock ’n’ Roller und tanzte auch gern Rock ’n’ Roll. Und dennoch entschied er sich, auf ein anderes Pferd zu setzen als nur auf die Musik, und studierte parallel Ingenieurwesen. Für diese Stärke und seine lebensbejahende Art bewundere ich meinen Vater.
Die Musik begleitet ihn bis heute. So ganz hat sie ihn nie losgelassen, und das ist auch gut so. Vor etwa zwei Jahren fing er wieder an, mehr zu spielen, und tat sich mit einem Akkordeonspieler zusammen. Gemeinsam treten die beiden auf, ihr Repertoire reicht von volkstümlicher Musik über Rock ’n’ Roll bis hin zu Schlagern. Eigentlich spielen sie alles, was die Leute hören möchten. Besonders hat mich gefreut, als mein Vater bei meiner Hochzeit spielte. Das hatte ich mir gewünscht. Gemeinsam mit seinem Freund Harry, der Keyboard spielt, übte er im Vorfeld wie wild, da die Songs nicht zu ihrem üblichen Repertoire zählten. Als wir nach dem Standesamt auf der Dachterrasse des Bayerischen Hofs ankamen, spielten sie »In the Mood« von Glenn Miller. Und kurz darauf »Ganz in Weiß« (das war der Vorschlag meiner Mutter, mein Vater hat es ja eher mit Rock ’n’ Roll und Swing). »Das hast du aber schön gedichtet«, meinte ich zu meinem singenden Vater. Meine Mutter musste lachen: »Schön wär’s, dann hätten wir ausgesorgt.« »Swinging Safari«, »Que Sera« oder »Mamor, Stein und Eisen bricht« – ihre Darbietungen verliehen der Feier einen persönlichen Touch. Später kam dann auch noch eine professionelle Band zum Einsatz.
Ich muss mir ein wenig auf die eigene Schulter klopfen, denn nachdem ich meinen Vater zum Spielen auf unserer Hochzeit animiert hatte, entflammte das Musikfieber wieder in ihm und er begann, seine große Leidenschaft zu reaktivieren. Bis heute hält die Spielfreude an, was ich natürlich toll finde.
Meine Eltern – frisch verliebt!
Meine Eltern lernten sich sehr jung kennen. Mama war achtzehn, Papa zweiundzwanzig Jahre alt. Sie lebte in Unterschleißheim, ging in Freising auf die Realschule und sehnte sich als Dorfkind nach dem Duft der großen weiten Welt. Sie wollte partout keinen Freund aus Unterschleißheim, lieber einen aus München oder von noch weiter weg. Jemanden, der ihren Horizont erweitern konnte. Eines Tages nahm eine Freundin sie mit zu einer Party, zu der auch Jungs aus München kommen sollten. An diesem Abend lernte sie meinen Vater kennen. Er war der Auserkorene und nach kurzer Zeit wurden die beiden ein Paar.
Die beiden studierten noch eine Zeit lang parallel, wobei Papas Ingenieursstudium schon weiter fortgeschritten war. In den Semesterferien nahm er Jobs an, um Geld für die junge Familie zu verdienen, während meine Mutter mit meinem Bruder zu Hause blieb. In dieser Zeit war sie dann »nur« Hausfrau. Bis heute betont sie, wie sehr sie diese Zeit genossen hat, wohlwissend, dass sie nach zwei, drei Monaten zurück an die Uni gehen und wieder etwas lernen würde. Wenn sie eine Klausurphase hinter sich gebracht hatte, freute sie sich wiederum auf ihre Familienzeit. Es waren zwei Leben, die sie nebeneinander führte und die ihr beide gleich wichtig waren. Sie sagte immer: »Wenn irgendwas im Job passiert, wird die Familie da sein und Halt geben.« Heute leitet sie ein eigenes Steuerbüro und ist auch mir beruflich eine große Hilfe. Wenn sie in ihrer Kanzlei einen komplizierten oder besonders herausfordernden Fall abgeschlossen hatte, berichtete sie uns zu Hause stolz von ihrem Erfolgserlebnis. Gleichzeitig wäre das ohne die Familie für sie nur halb so viel wert.
Nach dem Studium an der TU München arbeitete mein Vater kurz bei einer bekannten Münchner Bauunternehmung, um dann sein Referendariat beim Freistaat Bayern abzuleisten. Schlussendlich landete er bei einem Münchner Unfallversicherungsträger und arbeitete dort als Technischer Aufsichtsbeamter. Ein festes Grundeinkommen in der Familie war also gesichert. Für meine Mutter war das wichtig, da sie zu dem Zeitpunkt darüber nachdachte, sich selbstständig zu machen. Die Stelle meines Vaters gab ihnen Sicherheit. Meine Eltern konnten hier und da ein bisschen auf Risiko fahren, hatten aber immer die Sicherheit des Beamtengehalts. 2021 geht er in Pension, weil er sich mehr um die Familie kümmern möchte und weil es, wie er sagt, »irgendwann mal reicht«. Er ist jetzt dreiundsechzig, sein Vater war fünfundsechzig, als er an einem Herzinfarkt starb, und seine Priorität heute ist es, seine Zeit sinnvoll für die Familie zu nutzen und auch zu genießen. Ich selbst hatte als Kind einen engen Draht zu meinen Großeltern, und genau das wünsche ich mir auch für meinen Sohn.
Rückblickend betrachtet haben sich meine Eltern von Beginn an einfach perfekt ergänzt: Während meine Mutter als junge Frau der Enge ihrer Herkunft entfliehen wollte, suchte mein Vater das genaue Gegenteil. Ihm gefiel die Idee einer beständigen Familie, weil er genau das als Kind nie erlebt hatte. Für kurze Zeit wohnten sie in einer Mietswohnung in Moosach. 1982 heirateten sie, und als meine Mutter mit meinem großen Bruder schwanger wurde, zogen sie zurück nach Unterschleißheim. Ihre Eltern hatten dort in den Siebzigern ein Dreifamilienhaus gebaut, das Dachgeschoss wurde renoviert, und nach Sebastians Geburt zog die Kleinfamilie dort ein. Meine Mutter war nicht allzu froh darüber, wieder in Unterschleißheim gelandet zu sein, mein Vater hingegen fühlte sich zum ersten Mal in seinem Leben rundum wohl und heimisch. Meine Mutter hatte den Absprung aus der Heimat vielleicht nicht geschafft, aber sie hatte erreicht, wonach sie sich immer gesehnt hatte: frei zu sein, unabhängig und gleichzeitig familiär eingebettet.
1992, als alle drei Kinder da waren, kauften meine Eltern eine Doppelhaushälfte in Unterschleißheim, in der sie bis heute leben. Damals entstand eine neue Siedlung für junge Familien mit Kindern. Für mich und meine Geschwister war diese Siedlung das Paradies. In der Früh standen wir auf, gingen raus in den Garten und spielten mit den Nachbarskindern.
Mein Bruder Sebastian ist viereinhalb Jahre älter als ich, und meine kleine Schwester Vanessa und ich liegen zwei Jahre auseinander. Zu meinem großen Bruder hatte ich immer ein besonders inniges Verhältnis. Das hat sich bis heute nicht geändert. Ich habe ihn bewundert, egal, was er machte, ich fand alles toll. Ich wollte so sein wie er und wich ihm nie von der Seite. Einmal waren wir wieder im Skiurlaub, und Sebastian besuchte natürlich einen Skikurs einige Altersklassen über mir. Er war zehn und ich sechs, die kleine sture Cathy wollte aber unbedingt in seinem Kurs mitfahren. Weil ich schon ziemlich sicher auf den Brettern stand, hatte der Skilehrer nach langem Betteln ein Einsehen – und mein Bruder mich wieder an der Backe.
Sebastian tat oft genervt, aber ich glaube, eigentlich fand er es gar nicht so schlecht, der angehimmelte »große Bruder« zu sein. Es gab ein Bruder-Schwester-Ritual. Wir gingen auf den Trödelmarkt, um unser Taschengeld aufzubessern, und verkauften alte Sachen, die wir zu Hause nicht mehr gebrauchen konnten. Es gab verschiedene Märkte in der Nähe, beim Bahnhof in Unterschleißheim zum Beispiel oder beim McDonald’s um die Ecke. In Sachen Verhandlungen war mein Bruder eher vorsichtig und verkaufte zum Vorteil der Käufer, während ich immer die knallharte Geschäftsfrau gab, die tendenziell einen zu hohen Verkaufspreis für die angebotenen Produkte ansetzte. Wir machten alles zu Geld, was uns unter die Hände kam: altes Spielzeug, Kleidung, Bücher oder auch Dinge, die wir bei unseren Großeltern aus dem Keller ausgegraben hatten, wie beispielsweise eine alte Brotschneidemaschine oder Teppiche. Der Flohmarkt war für mich gleichzeitig eine Schatztruhe, weil ich als passionierte Schlümpfe-Sammlerin nach den kleinen blauen Figuren Ausschau halten konnte. Meistens mit Erfolg.
Aktionen wie der Flohmarktverkauf machten unheimlich Spaß und ich war auch ziemlich einfallsreich. Um die Zeit bis zum nächsten Termin zu überbrücken, kam ich auf die Idee, einen kleinen Shop in unserer Straße aufzubauen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Damals gründete ich sozusagen mein erstes Business zusammen mit einer Freundin: Für fünf Mark wuschen wir die Autos der Nachbarn. Ich war die treibende Kraft und für die Akquise verantwortlich, ging von Nachbarstür zu Nachbarstür und holte die Aufträge ran. Für die fünf Mark schufteten wir aber auch richtig, wienerten die Autos stundenlang, von innen, von außen, ließen keine Ecke aus. An einem guten Tag schafften wir auf diese Weise drei Wagen und waren abends um fünfzehn Mark reicher. Wir fühlten uns wie Krösus.
Mit siebzehn fing ich an, richtig zu arbeiten. Ich suchte mir Jobs im Einzelhandel und verkaufte Klamotten bei Pharo, später bei Closed und Diesel. Was auch nötig war, denn ich war nie der Spartyp, sondern gab das Geld, das reinkam, mit vollen Händen sofort wieder aus. Hier ein Wohnaccessoire für mein Zimmer, da ein Kleidungsstück, dann Schminke, Lippenstift – die schönen Dinge, die ich mir vom Taschengeld allein nicht kaufen konnte. Andere legten ihr Geld zur Seite, mein Bruder zum Beispiel, auf die Idee kam ich erst gar nicht.
Das Verhältnis zu meiner Schwester war ganz anders als zu meinem Bruder. Große Schwester, kleine Schwester. Wenn sie mich nachmachte und mir meine Sachen wegnahm, was kleine Schwestern halt gerne so machen, wurde ich zickig, das konnte die ältere Schwester gar nicht leiden. Jeder, der Geschwister hat, kennt das sicherlich. Als Sandwichkind, was ich ja bin, hat man es nicht immer leicht. Das älteste Kind hat sowieso seine Privilegien, dem jüngsten Kind stehen alle Türen offen, weil die älteren Geschwister sie über Jahre in etlichen Diskussionen geöffnet haben. Ich, als die Mittlere, hing dazwischen. Bei uns war es so, dass mein großer Bruder stets der Vorzeigesohn war. Er war extrem ehrgeizig. Ich wollte immer so sein wie er. Weil ich aber ein Mädchen war, durfte ich viele Dinge nicht machen, die ihm erlaubt waren. Da er als Kind und Jugendlicher (wie heute auch noch) eher introvertiert, vorsichtig und nicht so der Partytyp war, wurde er von meinen Eltern geradezu ermuntert, auf Partys zu gehen, und sie hatten auch kein Problem damit, wenn er länger wegblieb oder irgendwo übernachtete. Bei mir waren meine Eltern wesentlich strenger, ich musste darum kämpfen, abends länger wegbleiben zu dürfen. Das empfand ich schon einmal als unfair. Gleichzeitig wurde meiner kleinen Schwester, dem Nesthäkchen, später das erlaubt, was mir verboten worden war oder worum ich lange hatte betteln müssen. Sie durfte sich mit dreizehn ein Bauchnabelpiercing stechen lassen, ich erst mit fünfzehn oder sechzehn, und das nach einem langen Kampf mit meinen Eltern.
Ich fühlte mich immer ein wenig als Zwischenstation und die Lorbeeren meines Kampfes für mehr Rechte erntete eigentlich meine Schwester. Cathy boxte den Weg frei. Meiner Ansicht nach ist unsere Familie aber nur ein Beispiel für die meisten Dreierkonstellationen bei Geschwistern. Sandwichkinder haben es meiner Meinung nach immer etwas schwerer. Andererseits werden sie für das Leben stark gemacht. Ich für meinen Teil lernte damals, mich richtig durchzusetzen und mich so zu behaupten. Da bietet die Position des mittleren Kindes hervorragende Trainingsmöglichkeiten. Trotzdem litt ich unter dieser Position, das wurde mir erst später gewusst. Rückblickend verstehe ich, dass viele Verhaltensmuster, die ich heute habe, auf meine Kindheit zurückzuführen sind. Beispielsweise hatte ich lange Zeit das Gefühl, mich für alles rechtfertigen zu müssen. Für das, was ich tue, was ich sage oder wie ich entscheide. Und ich kämpfe immer für das, was ich möchte, obwohl ein Kampf oft gar nicht erforderlich ist.
In Unterschleißheim wohnten wir in einer ruhigen Spielstraße in einer Doppelhaushälfte mit rund hundert Quadratmetern Wohnfläche. Kein Luxus, aber der Platz reichte für uns aus, wobei es mit fünf Leuten auf einem Haufen manchmal ein bisschen eng werden konnte. Anfangs teilte ich mir ein Zimmer mit meiner Schwester, bevor ich mein eigenes Reich bekam, nur ein kleines zwar, aber es war mein eigenes. Auf eine schöne Einrichtung legte ich schon als Kind großen Wert, und ich hatte konkrete Vorstellungen, wie mein Zimmer aussehen sollte. Mein ganzer Stolz zum Beispiel war ein Glasschreibtisch, den hatte ich mir lange gewünscht und dann endlich bekommen, dazu eine grüne Hochglanzkonsole von Ikea in Wellenoptik, Bett, Kleiderschrank, ein bisschen Deko, und irgendwann bekam ich sogar einen eigenen Fernseher. Damit war aber auch jeder Quadratzentimeter optimal ausgenutzt.
In meinem Kaufmannsladen – schon damals geschäftstüchtig
Der Fernseher löste den Glastisch als mein persönliches Highlight ab. Das wirklich Allerwichtigste aber war, und daran hat sich bis heute nichts geändert: Es musste gemütlich sein. Ich liebte damals schon Rosa und Pink, egal in welcher Form und zu welchem Anlass, und ich besaß eine riesige Auswahl an Kuscheltieren. Pferde, Zebras, Teddybären und natürlich auch Puppen – sie alle fanden in meinem Nest ein Zuhause und es machte mir Spaß, alles schön herzurichten und sauber und ordentlich zu halten. Je älter ich wurde, desto mehr störte ich mich daran, dass die Wände dünn waren und unser Haus insgesamt recht hellhörig. Bei geschlossener Tür hörte ich, wenn mein Vater Musik machte oder mein Bruder Fernsehen schaute.
Hinter dem Haus gab es einen Garten, wo ich mit meiner damaligen und heute immer noch besten Freundin Steffi spielen konnte. Wir waren Nachbarskinder und lernten uns im Alter von drei Jahren kennen. Wahnsinn, wenn man sich das überlegt. Ich kenne ein Leben ohne sie überhaupt nicht. Und vor Kurzem wurde auch sie Mutter. Steffi arbeitet für eine Eventagentur und unterstützt mich manchmal bei meinen Projekten. Privates und Berufliches überschneiden sich bei uns bisweilen, und wir helfen uns gegenseitig in jeder Lebenslage. Steffi war auch meine Trauzeugin.
Ich habe nicht viele Freunde aus meiner Kindheit, aber die wenigen, die übrig geblieben sind, bedeuten mir unglaublich viel. Neben Steffi zählen auch noch Jessica, Maria und meine Schwester zu meinem Inner Circle. Jessica kenne ich jetzt auch schon seit acht Jahren, und Maria lernte ich vor gut zehn Jahren kennen. Unser aller Kontakt ist eng, auch wenn wir uns nicht jeden Tag sehen können. Aber wir telefonieren viel, schreiben uns über WhatsApp, schicken uns Fotos und Sprachnachrichten. Wenn die Zeit es zulässt, verreisen wir auch gerne gemeinsam. Für sie würde ich meine Hand ins Feuer legen, und ich bin mir sicher, umgekehrt gilt das ebenso.
In Sachen Freundschaft bin ich eine treue Seele, ich mag es, Menschen um mich zu haben, die mich bis aufs Mark kennen und denen ich mich nicht erklären muss. Darin besteht der Kern dessen, was Freundschaft auszeichnet. Immer füreinander da zu sein, den anderen genauso zu lassen, wie er ist, ihn zu akzeptieren und vor allem die Gewissheit zu haben, dass der andere da ist, auch wenn man mal ein paar Tage nichts voneinander hört. Es gibt Zeiten, in denen ich wegen Ludwig oder aus beruflichen Gründen für eine Weile abtauche und mich nicht melden kann. Keine von meinen Freundinnen würde in solchen Fällen beleidigt reagieren. Und selbst wenn wir uns mal für ein paar Monate nicht sehen, fühlt es sich beim nächsten Mal so an, als sei das letzte Treffen erst gestern gewesen.
Grundsätzlich war ich immer jemand, der schnell anderen sein Herz öffnet, ich glaube an das Gute im Menschen. Mittlerweile brauche ich ein bisschen Zeit, bis ich einem Menschen mein Vertrauen schenke. Das habe ich mir mit der Zeit angewöhnt. Auch aus Selbstschutz. Ich würde von mir behaupten, eine ganz gute Menschenkenntnis zu besitzen, trotzdem bin ich vorsichtig geworden. Ich musste auf die harte Tour lernen, dass es da draußen nicht nur Leute gibt, die es gut mit einem meinen. Wenn mich das Gefühl beschleicht, ein Kontakt könnte in die falsche Richtung abdriften, nehme ich schnell Abstand. So musste ich beispielsweise erst lernen, manche Journalisten richtig einzuordnen und nicht gleich wie Freunde zu behandeln. Ich erkannte nicht, dass ihre angeblich vertraute Art, ihre Späße und das nette Miteinander einzig beruflichen Zielen dienten. Ich möchte gar nicht alle Journalisten über einen Kamm scheren, mit den meisten komme ich gut zurecht. Aber es gibt eine gewisse Klientel unter ihnen, die sich gerne angesprochen fühlen dürfen.
Wir, die Fischers, zählten zu dem, was man als klassische Mittelschicht bezeichnen würde. Meine Eltern hatten ein gutes Auskommen, aber mit drei Kindern konnten sie auch keine allzu großen Sprünge machen. Dennoch hat es uns nie an etwas gemangelt, auch wenn am Ende des Monats nicht viel übrig blieb. Als Letztes gespart hätten unsere Eltern an unserer schulischen Bildung. Da machten sie wirklich alles möglich, um uns den bestmöglichen Start ins Leben zu verschaffen. Mein Bruder und ich gingen für ein Austauschjahr nach Amerika, und meine kleine Schwester besuchte eine Privatschule.
Werde ich gefragt, ob ich ein Mutter- oder Vaterkind war, fällt die Antwort differenziert aus. Momentan bin ich eher ein Vaterkind. Was daran liegt, dass mein Vater bedingungslos alles liebt, was ich derzeit mache. Er zeigt mir, wie stolz er ist, indem er sich für meine Aktivitäten interessiert und jeden Beitrag oder Medienbericht sammelt und aufbewahrt. Er verfolgt auch, was ich tagtäglich bei Instagram poste. Dazu muss ich sagen, dass er auch mehr Zeit hat als meine Mutter, die mich natürlich ebenso unterstützt, wo es nur geht. Aber sie steht noch komplett im Berufsleben, mein Vater hingegen geht bald in den Ruhestand.
Wir ähneln uns in vielen Dingen, können sehr gut ohne Halligalli auskommen, ziehen die Ruhe gerne mal dem Feiern vor und müssen nicht ständig im Austausch mit anderen sein. Das mag jetzt vielleicht überraschen, wenn man sieht, wo ich überall beruflich herumturne, was ich poste und wie viel ich von mir offenbare. Aber das gehört zum Job, den ich sehr genieße. Genauso wie die stillen Momente, wenn ich für mich bin, wenn ich Yoga mache, wenn ich abends das Handy weglege. In der Hinsicht sprechen mein Vater und ich also die gleiche Sprache. Ich habe aber auch viel von meiner Mutter mitbekommen. Mein Ehrgeiz zum Beispiel kommt eindeutig von ihr. Das Kämpferische, das Getriebene, das Perfektionistische – hier zeigt sich die genetische Handschrift meiner Mutter. Es ist schon interessant, wenn man mit der Zeit beginnt, Gemeinsamkeiten zwischen sich und seinen Eltern auszumachen, und merkt: Aha, da reagiere ich wie die Mama, das mache ich genau wie der Papa. Spannend und schön.
Um zu verdeutlichen, wer ich bin und warum ich bin, wie ich bin, möchte ich im Stammbaum meiner Familie noch ein wenig weiter zurückschauen. Meine Großeltern, sowohl väterlicher- als auch mütterlicherseits, hatten auf ganz unterschiedliche Weise Einfluss auf mich. Von der großbürgerlichen Herkunft meines Vaters habe ich schon berichtet. Die Eltern meiner Mutter hatten einen ganz anderen Hintergrund. Meine Großmutter, Annemarie Wald, kam 1935 in Ungarn zur Welt. Die Walds waren sogenannte Donauschwaben, sie gehörten der deutschstämmigen Minderheit in Ungarn an. Sie lebten in Majs, einem Nachbarort von Lippó nahe der serbischen Grenze. In der Endphase des Zweiten Weltkriegs floh die Familie vor dem Einmarsch der Roten Armee in den Westen. Fast alle Dorfbewohner – Frauen, Kinder und die Männer, die nicht im Krieg waren – machten sich auf den beschwerlichen Weg nach Deutschland. Annemaries Vater war zu dem Zeitpunkt in Frankreich an der Front. Viele Ungarndeutsche kehrten später in ihre Heimat zurück, nicht aber die Familie meiner Großmutter. Mein Urgroßvater, Johann Wald, hielt es für klüger, in Deutschland zu bleiben. In Ungarn waren sie wohlhabende Bauern gewesen, angesehene Leute, die auf einem großen Anwesen lebten. Nach dem Krieg hatte man sie, wie viele andere, enteignet. Von dem Besitz war ihnen nichts geblieben außer zwei Pferden, die sie mit auf die Flucht genommen hatten. Annemaries Familie wurde zunächst in Niederbayern sesshaft, in Osterhofen im Landkreis Deggendorf. Ein Bauer gab ihnen eine Unterkunft und stellte ihnen zur Bewirtschaftung ein Stück Feld zur Verfügung, im Gegenzug halfen sie auf dem Hof mit. Mein Urgroßvater, der in französische Kriegsgefangenschaft geraten war, stieß erst hier wieder zum Rest der Familie dazu. Die Wiedersehensfreude nach den Jahren der Trennung und der Ungewissheit kann man sich kaum vorstellen.
Lange blieben die Walds aber nicht in Osterhofen, denn Johann fand in der Gegend keine Arbeit. Deswegen ging er zunächst allein nach München, wo man händeringend Männer suchte, die beim Wiederaufbau mitanpackten. Mit seinem Lohn und etwas geliehenem Geld erwarb er schon bald ein kleines Grundstück in Unterschleißheim und holte die Familie nach. Annemarie machte dort in einem Kloster eine Hauswirtschaftslehre. Zwei Jahre blieb sie bei den Klosterschwestern und wurde zur perfekten Hausfrau ausgebildet. Mit siebzehn fing sie an, in der Weberei Alexander Pachmann in Unterschleißheim als angelernte Weberin zu arbeiten. Dort stellte man Textilprodukte her, die in die ganze Welt verkauft wurden.
Mein Großvater, Albert Messmann, stammte aus Burglengenfeld in der Oberpfalz und wurde, wie Annemarie, im Jahr 1935 geboren. Er war ein sehr talentierter, sehr leidenschaftlicher Fußballspieler, der im Nachkriegsdeutschland vielleicht Karriere als Profi hätte machen können. Zumindest machte man ihm einmal ein konkretes Angebot. Aber mein Großvater lehnte ab. Niemand aus seinem Umfeld konnte das nachvollziehen. »Warum machst du das nicht?«, fragten alle kopfschüttelnd. »Wie kannst du dir so eine Chance entgehen lassen?« Er hatte andere Prioritäten: die Familie. Er wollte nicht weg aus der Heimat, er wollte nah bei seiner Mutter bleiben. Später zog es ihn auf der Suche nach Arbeit dann doch in Richtung München, und so landete er in Unterschleißheim, wo er meine Großmutter kennenlernte. Albert wurde Heizungsmonteur und arbeitete in diesem Beruf bis zur Rente.
Opa Albert (li.) auf dem Fußballplatz
In der Freizeit spielte mein Großvater weiterhin Fußball, aber nur dann, wenn ihm der Sinn danach stand. Da war er ganz konsequent und ließ auch Mannschaftskollegen und Trainer vom SV Lohhof abblitzen, wenn sie mal wieder bei ihm auf der Matte standen und bettelten: »Bitte komm auf den Platz, wir brauchen dich.« Mein Opa spielte auf der Position des Mittelläufers, dem Äquivalent zum heutigen Spielmacher oder Zehner. Meine Mutter, die selbst ja nicht Fußball spielen durfte, musste am Wochenende oft mit auf den Fußballplatz, wenn ihr Vater seinen Einsatz hatte. Das missfiel ihr gewaltig. Damals nahm sie sich fest vor, nie im Leben würde sie einen Fußballer als Partner haben wollen. Das war tatsächlich ein Ausschlusskriterium bei der Partnerwahl. Bei ihr hat es geklappt – bei mir weniger. Ich war aber auch nicht vorbelastet wie sie.
Meine Großeltern Annemarie und Albert – ein Leben lang unzertrennlich
Sowohl zu Oma Annemarie als auch zu Opa Albert hatte ich als Kind ein enges Verhältnis. Die beiden wohnten in unserer Nähe, sodass ich sie häufig besuchen konnte. Oma Annemarie fuhr, solange sie es gesundheitlich konnte, fast jedes Jahr nach Ungarn, in ihre alte Heimat, und besuchte den Teil ihrer Familie, der dortgeblieben war. Mittlerweile ist sie leider zu alt für die Reise. Vor vielen Jahren habe ich sie einmal begleitet, ich war etwa sechs Jahre alt. Sie zeigte mir, wo ihre Vorfahren gelebt hatten, den Gutshof, der ihrer Familie gehört hatte, bevor sie vertrieben wurden. Ich erinnere mich noch an die unglaublich schönen weiten Felder rund um den Hof. Wir Kinder waren den ganzen Tag draußen, spielten in der Scheune und verbrachten Zeit mit den Tieren im Stall. Es stellte sich nur ein Problem heraus: Ich reagierte extrem allergisch auf den Staub. Aus diesem Grund konnte ich danach nie wieder mit meiner Großmutter nach Ungarn fahren. Die Gefahr, dass ich dort erneut gesundheitliche Probleme bekäme, war zu groß. Ja, und dann, vier Jahre später, starb ihr Mann, mein Opa Albert. Damals bekam meine kleine heile Welt einen gewaltigen Knacks …