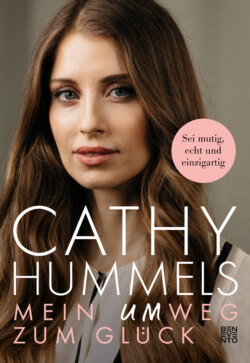Читать книгу Mein Umweg zum Glück - Cathy Hummels - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4 Als mir die Luft wegblieb
ОглавлениеMit Allergien kenne ich mich – leider – bestens aus. Viele Jahre waren sie meine treuen Begleiter. Zu jeder Jahreszeit und bei jeder Gelegenheit gab es etwas, das mein Körper nicht vertrug: von Hausstaub über Pollen bis zu Tierhaaren und manches mehr – ich könnte von allem ein Lied singen. Am stärksten schränkte mich im Alltag allerdings das Asthma ein.
Vor meinem sechsten Lebensjahr war mir – und auch meinen Eltern – überhaupt nicht bewusst, dass ich damit ein Problem hatte. Bis dahin war ich beschwerdefrei. Doch dann kam der Tag X – mein erster Asthmaanfall. Wir waren, wie ich erwähnte, mit meiner Oma zu Besuch in Ungarn. Urlaub auf dem Bauernhof. Es war Sommer, alles grünte, alles blühte. Wir wälzten uns auf den Wiesen und tollten im Heu herum. Das absolute Highlight war in der Scheune eine Maschine für Maiskolben. Man warf den Maiskolben oben hinein, und die Maschine trennte die Körner vom Kolben ab. Dabei staubte es gewaltig, machte aber einen irren Spaß. Wir wollten gar nicht mehr aufhören und schmissen immer wieder neue Maiskolben hinein. Natürlich gab es auch Tiere auf dem Hof, die wir zum Streicheln und Schmusen besuchten. Alles in allem ein Paradies für Kinder. Bis zu dem Zeitpunkt, als mir plötzlich die Luft wegblieb. Dazu war mir nur noch schwindelig. Im ersten Moment glaubten meine Eltern, ich hätte mir etwas eingefangen. Oder der Staub und die Tierhaare wären vielleicht nur ungewohnt für ein Stadtkind. Nachdem weder feuchte Tücher noch andere Hausmittelchen meinen Zustand verbesserten, brachen wir die Ferien verfrüht ab und fuhren nach Hause. Dort erholte ich mich bald. Gut, dachten sich meine Eltern, war wohl alles etwas viel für Cathy.
Wir hatten den Vorfall beinahe vergessen bis zu dem Tag, an dem meine Freundin Marina zu Hause ihren Geburtstag feierte. Eine typische Kinderparty. Wir tranken Cola, aßen Erdnussflips, spielten Sackhüpfen und Topfschlagen, hatten eine Menge Spaß. Ein Detail dieses Tages ist mir noch im Gedächtnis. Ich sah eine Schachtel rote Marlboro auf dem Tisch im Flur liegen. Dazu muss ich erklären, dass ich schon als Kind einen Ekel vor Zigarettenrauch hatte und Menschen mied, die rauchten. Nein, ich mied sie nicht nur, ich wollte sie am liebsten bekehren. Mein Urgroßvater hatte mit über achtzig Jahren eine Bypass-Operation überlebt, und ich weiß noch, dass der Arzt, während er meiner Mutter erläuterte, wie sie nun weiter verfahren würden, selbst eine Zigarette rauchte. »Wieso rauchst du? Davon wird die Lunge schwarz und der Bauch auch«, sagte ich altklug. Der Arzt schaute verdutzt, was denn die Kleine da redete, dann lächelte er, drückte die Zigarette aus und meinte: »Hast ja recht. Es ist nicht gut, dass ich rauche.« Mein Urgroßvater litt an einer Arterienverkalkung und natürlich hatte die Familie im Vorfeld ihre Bedenken bezüglich der OP geäußert, sie hatten Sorge, eines seiner Beine müsse möglicherweise abgenommen werden. Und dann war da seine schwarze Lunge von den Zigaretten, die er in seinem langen Leben inhaliert hatte. Alle diese Bilder prägten sehr früh meine Einstellung zum Thema Rauchen. Kein Wunder, dass ich jeden bekehren wollte. Meine Mutter gestand mir später, sie selbst habe sich kaum noch getraut, sich ab und an mal eine Zigarette anzustecken. Dass das bloß die Cathy nicht mitbekommt, hieß es. Ich machte alle um mich herum ganz kirre mit meiner direkten Art. Dabei hatte ich immer nur die Angst, einen Menschen zu verlieren.
An jenem Tag im Haus meiner Freundin Marina fiel mein Blick auf diese Zigarettenschachtel und sofort war ich darauf fixiert. Plötzlich roch ich überall Zigarettenrauch, der gar nicht vorhanden war, und mir gingen solche Gedanken durch den Kopf wie: »Wenn die Mama von Marina raucht, dann fängt die auch irgendwann damit an, und dann verliere ich sie …« Total blöd eigentlich, aber so dachte ich damals. Während wir gegen Nachmittag in Marinas Zimmer spielten, merkte ich, wie ich immer schlapper wurde, bis ich mich kaum mehr auf den Beinen halten konnte. Wie Kinder so sind, wollte ich natürlich nicht die Party verlassen. »Mir ist nur etwas schwindelig«, beruhigte ich meine Freundin. Und hatte keine Ahnung, was mit mir los war. Wir gingen in ein anderes Zimmer, um Marinas Meerschweinchen zu streicheln. Und das war’s dann, ich kippte einfach um.
Ich hatte eine extrem starke Tier- und Hausstaubmilbenallergie, die einen Asthmaanfall auslöste – was aber keiner bis dahin wusste. Mir blieb die Luft weg, ich konnte einfach nicht mehr atmen. Marinas Mutter war sofort zur Stelle, packte mich und brachte mich nach draußen an die frische Luft. »Atme«, rief sie, »atme tief ein.« Es ging nicht, mittlerweile war ich schon apathisch, die Lippen liefen blau an. Sie rief meine Mutter an, die in wenigen Minuten da war und mich umgehend zum Kinderarzt schleppte, dessen Praxis ganz in der Nähe lag. Dem war sofort klar, dass die Situation ernst war. Er spritzte mir zwei Ampullen Cortison in die Vene und rief einen Krankenwagen. Erst in der Klinik normalisierte sich mein Zustand. Ich war fix und fertig; ich lag in der Notaufnahme, an das meiste kann ich mich nicht erinnern, aber dass ich einen lilafarbenen Pullover mit dem Aufdruck »ABC« trug, komisch, dieses Detail weiß ich noch. Im Krankenhaus wurde ich rundum durchgecheckt. Die Diagnose lautete Asthma.
Insgesamt blieb ich drei Wochen in der Klinik. Man inhalierte mit mir, ich bekam Infusionen und diverse Untersuchungen. Nach zwei Wochen ging es mir eigentlich wieder ganz gut und ich wollte nach Hause. Die Ärzte entschieden jedoch, mich zur Beobachtung noch weiter dazubehalten. Zum Glück durfte meine Mutter von Anfang an mit in meinem Krankenzimmer übernachten. Es gab kein Bett für sie, aber das war ihr egal. Sie legte sich einfach zu mir und wich mir nicht von der Seite.
Als ich nach drei Wochen entlassen wurde, war ich das glücklichste Kind der Welt. Ich hätte anschließend noch eine Kur machen sollen, das kam aber nicht infrage. Ich wollte nur noch nach Hause – zu meinen Eltern, zu meinen Geschwistern, in mein eigenes Bett. Rückblickend gesehen wäre es vielleicht schlauer gewesen, weniger stur zu sein. Man hätte mir vielleicht geholfen, besser mit der Angst vor einem erneuten Asthmaanfall umzugehen. Genau das nämlich wurde zu meinem eigentlichen Problem. Das Asthma selbst war in den Griff zu bekommen, aber einige Zeit später wurde bei mir ein sogenanntes »psychogenes Asthma« diagnostiziert. Atemstörungen, ausgelöst in Belastungssituationen, durch Stress und Ängste. Ich hatte zum Beispiel schon Angst, wenn ich mal woanders war als in der mir vertrauten Umgebung. Zuhause fühlte ich mich safe, da waren mein Inhalator und das Asthmaspray immer griffbereit, auch Familienurlaube waren unproblematisch. Aber allein, wenn es darum ging, bei einer Freundin zu übernachten, wurde es für mich problematisch.
Dann kam die Klassenfahrt in der Vierten. Für fünf Tage sollten wir alle in ein Schullandheim in die Alpen fahren. Eine Woche voller Aktivitäten, Ausflüge, Zeit und Spaß mit den Freunden und – das Wichtigste – kein Unterricht, keine Eltern. Eigentlich genau das, worauf sich jedes Kind freut. Bei mir war es genau umgekehrt. In meinem Kopf entstanden die wildesten Szenarien: Ich bin irgendwo in der Fremde, kenne niemanden und plötzlich kann ich nicht mehr atmen und niemand ist da, der mir helfen kann.
Schon Tage vor der Klassenfahrt hatte ich eine panische Angst vor den fünf Tagen. Meine Mutter wusste nicht, wie sie damit umgehen sollte. Einerseits nahm sie mich ernst, andererseits wollte sie aber auch, dass ich an den Aktivitäten teilnahm. Sie fand eine Lösung, indem sie mit meinen Lehrern sprach, die sich bereiterklärten, die medizinischen Geräte für mich mitzunehmen, um im Notfall entsprechend reagieren zu können. Ich trat die Reise an und telefonierte täglich mit meiner Mutter. Ihre Entscheidung war goldrichtig. Und natürlich passierte auf der Klassenfahrt nichts von dem, was ich mir ausgemalt hatte. Ich musste lernen, meine Ängste in den Griff zu bekommen und erkennen, dass ich woanders sein konnte und mir trotzdem nichts passierte.
Meine Eltern belastete das alles natürlich sehr. Sie überlegten hin und her, wie sie mir am besten helfen könnten. War der Druck in der Schule vielleicht zu groß? War ich überfordert? Sollten sie mich lieber auf eine Montessori-Schule schicken? Ich hatte dazu eine klare Meinung: Auf keinen Fall würde ich die Schule wechseln, ich wollte nicht weg von meinen Freunden. Zu Hause hatten wir heftige Diskussionen darüber, wie es weitergehen sollte. Ich blieb stur, und am Ende setzte ich mich durch. Auch ohne Schulwechsel änderte sich einiges in meinem Alltag. Wegen des Asthmas durfte ich zum Beispiel keine Süßigkeiten mehr essen. Zucker war tabu. Das war als Kind hart. Heute lebe ich gut ohne Zucker, aber früher, wenn ich bei Freundinnen zu Besuch war, stürzte ich mich auf alles, was nach Schokolade und Gummibärchen aussah. Meine Mutter konnte die Uhr danach stellen, wann sie wieder den Anruf einer irritierten Mutter bekam. »Also, hören Sie mal, liebe Frau Fischer, die Cathy hat wirklich alle Süßigkeiten fast allein aufgegessen. So schnell hat man gar nicht schauen können. Ich hoffe, ihr wird nicht schlecht …« Das wurde es manchmal, war mir aber wurscht. Ich nahm, was ich kriegen konnte.
Und dann, wie gesagt, die Allergien. Die Frage lautete nicht, wogegen war ich allergisch? Sondern: Wogegen war ich nicht allergisch? Sobald es irgendwo nicht zu hundert Prozent sauber war, nur ein bisserl Staub und ich bekam Probleme. In die Nähe von Haustieren durfte ich schon gar nicht kommen. Bei Freundinnen übernachten bedurfte jedes Mal einer guten Vorbereitung. War alles eingepackt, was ich nachts gegebenenfalls brauchen würde? Klar war, vor dem Einschlafen musste ich immer ewig inhalieren. Der Inhalator wurde mein treuester Gefährte. Trotzdem blieb die permanente Sorge, beim nächsten Asthmaanfall zu ersticken.
Bis zu dem Tag, an dem ich endlich asthmafrei war. Das war dann aber auch erst zehn Jahre später. Durch eine konsequente Ernährungsumstellung hatte ich es geschafft, mich selbst zu sensibilisieren. Und die Angst ließ irgendwann nach, vielleicht allein aus dem Grund, dass mein Kopf nicht mehr so viel darüber nachdachte. Damit war der erste Schritt getan, und viele weitere folgten. Bis heute habe ich das Asthma und die Allergien im Griff. Diese Freiheit weiß ich zu schätzen, weil ich weiß, wie es sich anfühlt, diese Unbeschwertheit nicht zu haben.