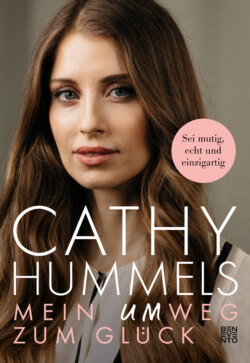Читать книгу Mein Umweg zum Glück - Cathy Hummels - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3 Und dann starb Gargamel
ОглавлениеIn den ersten Jahren sah ich alles nur in Rosarot, das Leben war unbeschwert. So soll es ja auch sein, wenn man Kind ist. Die glücklichsten Zeiten waren jene, in denen ich mit Eltern, Großeltern, Geschwistern, Tante und Onkel, Cousin und Cousine und meinen Freundinnen zusammen war. Es lag außerhalb meiner Vorstellungskraft, dass ein geliebter Mensch eines Tages nicht mehr da sein könnte. Und dann, plötzlich, verlor ich in relativ kurzer Zeit mehrere Menschen, die mir nahestanden.
Als ich zehn Jahre alt war, starb mein Großvater Albert. Diese Erfahrung verpasste mir einen Knacks. Opa Albert war für mich aber auch viel mehr als »nur« mein Großvater, ein bisschen sogar eine Art Vaterersatz, der mir das gab, was mein Vater mir zu dem Zeitpunkt nicht geben konnte. Heute ist unsere Beziehung, wie schon gesagt, eng und vertrauensvoll, aber so war es nicht immer. Meinem Vater fiel es anfangs nicht leicht, sich mit seiner Vaterrolle zu identifizieren, da er selbst ja ohne Vater aufgewachsen war. Woher sollte er es also wissen? In diese Rolle musste er erst hineinwachsen und sein Selbstverständnis als Vater finden. So entstand eine wahnsinnig enge Beziehung zu meinem Großvater Albert, der immer präsent war. Überhaupt hatte er einen guten Draht zu allen seinen Enkelkindern. Wenn einer von uns Sorgen hatte, dann ging man zu Opa Albert, der einen immer mit einem offenen Ohr, mit offenen Armen und verständnisvollen und weisen Ratschlägen empfing. Er unternahm auch gerne etwas mit uns. Nahm uns mit auf Spaziergänge in die Natur, auf denen er uns dann alles Mögliche erklärte. Er besuchte mit uns den Tierpark, wir schauten uns gemeinsam Filme an oder lasen eine Geschichte. Er war ein aufmerksamer und liebevoller Mensch, und ich sprach mit ihm über alles, was mich traurig oder glücklich machte. Wenn mich jemand geärgert hatte, teilte ich meine kindlichen Sorgen mit ihm.
Darüber hinaus hatten wir eine gemeinsame Passion: Wir liebten beide die Schlümpfe. Ich glaube sogar, dass es Opa Albert war, der mich für die kleinen blauen Wesen aus Schlumpfhausen einnahm. Seine Begeisterung jedenfalls färbte auf mich ab und ich sammelte Schlaubi, Schlumpfine & Co., und wie sie alle hießen, wie verrückt. Was meinen Opa an den Schlümpfen faszinierte, weiß ich nicht. Aber zusammen hockten wir im Fernsehzimmer im Keller meiner Großeltern und schauten uns jede Folge der Zeichentrickserie an. Und waren manchmal so vertieft, dass wir nicht einmal mitbekamen, wenn meine Großmutter uns zum Essen rief. Es sei denn, sie hatte ihre berühmten Schinkennudeln gekocht. Eines meiner Leibgerichte – bis heute. Zog der Duft der Schinkennudeln durchs Haus, vergaß ich sogar die Schlümpfe für einen Moment.
Albert war ein herzensguter Mensch. Weißes Haar, tiefe Geheimratsecken und auf der Nase immer eine Hornbrille mit dickem Glas, seine Augen waren ziemlich schlecht. Und er hatte nur noch einen einzigen echten Zahn. Wenn er also mal sein Gebiss nicht trug, blitzte in der unteren Zahnleiste dieser Zahn hervor, wie bei dem Zauberer bei den Schlümpfen. Er lachte dann und sagte: »Schau mal, Cathy, ich bin’s, der Gargamel.« Er wusste genau, wie er mich zum Lachen bringen konnte.
Neben den Schlümpfen war ich besessen von Wendy und Shelly, Zeitschriften über Pferde, die Mädchen meines Alters liebten. Weil ich aufgrund meiner Allergien selbst nicht reiten durfte, sammelte ich zumindest Sticker für meine Pferdehefte. Mein Opa überraschte mich hin und wieder mit einem Heft oder er steckte mir Geld zu. »Los, Cathy, hol dir Nachschub«, und das musste er mir nicht zweimal sagen.
Als mein Großvater starb, zerbrach etwas in mir. Zum ersten Mal wurde ich mit dem Thema Tod konfrontiert. Es war Herbst, Ende September, und ich ging in die fünfte Klasse des Gymnasiums. Bereits in der Früh wunderte ich mich, warum meine Mutter nicht zu Hause war. Dass sie das Haus vor uns Kindern verließ, kam eigentlich nie vor. Auf die Frage, wo Mama sei, antwortete mein Vater wortkarg, sie habe etwas zu erledigen, ich solle mir aber keine Sorgen machen. Aber ich spürte, irgendwas stimmte da nicht. Später erfuhren wir: Meine Mutter war am Abend ins Krankenhaus gerufen worden, wo sie die Nacht bei ihrem Vater verbracht hatte. Als ich mittags aus der Schule nach Hause kam, parkten die Wagen meiner Oma und meiner Tante vor unserer Einfahrt. Ich rannte ins Haus und fand meine Mutter in der Küche. Sie nahm mich in den Arm und sagte sanft: »Der Opa ist heute Nacht gestorben.« Ich dachte in dem Moment, sie meinte meinen lieben Uropa (er war damals schon achtundachtzig), und sagte: »Er war doch aber auch schon sehr, sehr alt, Mama.« – »Nein, mein Schatz, mein Papa ist gestorben. Nicht der Uropa. Dein Opa Albert hatte einen Herzinfarkt.« Das konnte doch nicht sein, dachte ich. Kurz zuvor noch hatte ich ihn besucht. Nein, bestimmt irrten sich alle. Es musste sich um meinen Urgroßvater handeln, er hatte einen Herzinfarkt, nicht mein Opa.
Mein Bruder Basti und ich (auf dem Arm meines Großvaters Albert)
Aber natürlich irrten sie sich nicht. Opa Albert, mein zweiter Vater, mein Heiligtum, war nicht mehr da. Er wurde nur zweiundsechzig Jahre alt. Meine Mutter war am Boden zerstört, ebenso meine Großmutter, wir alle konnten es nicht fassen. Das letzte Mal, dass ich ihn gesehen hatte, da saßen mein Cousin und ich bei den Großeltern im Keller, schauten fern und aßen die Honigpops von Kellogg’s, unsere Lieblingsnascherei. Unser Opa kam die Treppe herunter, schick angezogen, mit weißem Hemd, und fragte, was wir hier so spät noch machten. Und mein Cousin und ich riefen mit vollem Mund: »Opa, wir essen Popsies und gucken Schlümpfe.« Mein Großvater musste schmunzeln und schickte uns nach Hause. Wir lachten nur und versprachen, gleich weg zu sein. Stattdessen schlichen wir uns zur Vorratskammer und plünderten die Eistruhe. Großvater musste das mitbekommen haben, wollte uns den Spaß aber nicht verderben. Seitdem träume ich davon, dass er mir noch einmal begegnet und dass ich ihm Lebewohl sagen kann.
Solange ich zurückdenken konnte, schaute ich fast täglich bei meinen Großeltern vorbei, und sei es nur, um kurz Hallo zu sagen. Nach dem Tod meines Opas änderte sich das. Ich brachte es nicht mehr übers Herz, in ihrem Haus zu sein. Es tat weh. Es tut heute immer noch weh. Alles sah noch genauso aus, äußerlich hatte sich kaum etwas verändert. Aber mein Opa fehlte. Im Nachhinein tut es mir leid für meine Großmutter. Auch sie ist ein herzensguter Mensch und wenn ich sehe, dass sie nun langsam körperlich abbaut, wünschte ich, ich hätte damals die Stärke gehabt, sie weiterhin so oft zu besuchen. Heute bereue ich das, aber damals konnte ich mich einfach nicht überwinden.
Großvater Albert starb, da war ich zehn. Und nur zwei Jahre später verlor ich meinen anderen Opa. Obwohl ich ihn nicht so gut kannte und nicht so häufig sah, liebte ich auch ihn abgöttisch. Er war eine beeindruckende Persönlichkeit. Ein Kosmopolit, ein Lebemann und zeitlebens ein kleiner Casanova. Monaco Franze in real. Die Tendenz zu einem ausschweifenden Lebensstil war ihm vielleicht in die Wiege gelegt. Beispielhaft dafür ist die Geschichte, als der Urgroßvater meines Vaters einen seiner Söhne, den »schönen Sebastian«, während der Weltwirtschaftskrise nach Berlin schickte, um einen Traktor zu kaufen. Zwei Wochen später kehrte er unverrichteter Dinge zurück von der Reise, ohne Traktor und völlig abgebrannt. Daraufhin fuhren mein Uropa und sein Sohn gemeinsam nach Berlin, um den Traktor zu kaufen. Kurze Zeit später waren sie wieder zu Hause, ohne Traktor und ohne Geld. Nur wenige Tage später erschien ein Bild in einer Zeitung, darauf zu sehen waren Vater und Sohn auf dem Kurfürstendamm, neben ihnen eine Prostituierte, und beide tranken Champagner aus einem Damenschuh, welcher offensichtlich der Dame gehörte.
Ich weiß nicht, ob diese Geschichte wirklich stimmt, in unserer Familie zumindest galt sie immer als Beleg dafür, dass mein Opa für sein flamboyantes Auftreten ja gar nichts konnte. Hinzu kam, dass er ein sehr attraktiver Mann war. Mit ganz viel Charme. Ein echter Charmebolzen. Eine Geschichte, die ihn als Typ charakterisiert, spielte sich anlässlich der Taufe meines Vaters ab. Dieser sollte ursprünglich Alfredo heißen, inspiriert durch den Charakter irgendeiner Seifenoper. Das missfiel Opa Ludwig. Am Tag der Taufe wendete sich das Blatt. Mein Großvater zündete sich eine Zigarre an und brannte mit ihrer Glutspitze ganz nonchalant auf der Urkunde das »o« aus dem »Alfredo« heraus. So kam es, dass mein Vater ein Alfred wurde. Das war eine ganz typische Opa-Ludwig-Aktion.
Als Architekt baute mein Großvater wunderschöne Häuser und verdiente eine Menge Geld in Zeiten, in denen es in Deutschland wirtschaftlich immer nur bergauf ging. Er bewegte sich in den sogenannten »besseren Kreisen«, also bei denen, die das nötige Kleingeld besaßen, um seine Prachthäuser zu erwerben. Karl-Heinz Rummenigge zum Beispiel gehörte zu seinem Kundenstamm. Die meiste Zeit arbeitete er von Nürnberg aus, war aber, wie schon erwähnt, international tätig. Er besaß ein Boot und eine Villa in Spanien zwischen Valencia und Alicante, Moraira hieß der Ort, wo er seine letzten Jahre verbrachte. Das Haus war imposant, hatte diverse Gästezimmer und einen großen Pool. In der Garage gab es einen kleinen Fuhrpark.
Da Opa Ludwig nur noch selten nach Deutschland kam, sah ich ihn nicht häufig. Trotzdem hing ich an ihm – und er an mir. Ich erinnerte ihn an seine eigene Mutter, an meine Uroma Katharina. Ich sei ihr, meinte er, von den Gesichtszügen, aber auch vom Charakter her ähnlich. Vielleicht war ich deswegen ein bisschen sein Liebling. Wenn wir ihn in den Ferien in Spanien besuchten, wollte ich am liebsten Pizza essen gehen. Ja, ich weiß, das klingt verrückt. Fand auch seine neue Frau. »Wir sind in Spanien, also essen wir etwas Spanisches«, hielt sie mir vor. Ludwig schlug sich jedes Mal auf meine Seite. Ich gebe zu, er ließ sich schnell von seiner Enkelin um den Finger wickeln. Dann zwinkerte er mir zu und ich wusste: Meine Pizza war nicht weit.
Seine Frau und ich waren uns nicht grün. Ich schaffte es immer wieder, sie in Rage zu bringen. Legte ich es darauf an? Na ja, vielleicht ein bisschen. Mein Bruder und ich hatten zum Beispiel die Angewohnheit, aus den Liegestühlen am Pool eine Höhle zu bauen. Dazu schoben wir alle Liegen zusammen, stapelten darüber die Polster und zusätzlich die Kissen der Stühle – fertig war unser Eigenheim in bester Pool-Lage. Einmal hatten wir gerade alles schön aufgebaut, gingen essen (Pizza!) und ließen die Höhle zurück. Zwischenzeitlich zog eine Gewitterfront auf, und es fing furchtbar an zu regnen. Als wir zurückkehrten, hatte der Sturm unsere Höhle über das gesamte Grundstück verteilt. Die Sofagarnitur und die wertvollen handbestickten Kissen waren im Pool gelandet – und unbrauchbar geworden. Meine Stiefoma kochte vor Wut. Sie sah es auch mit Argwohn, wenn ich wieder mal zu viele Badetücher benutzt hatte. Am Pool gab es einen Schuppen, in dem die Handtücher akkurat und säuberlich sortiert gestapelt lagen. Wenn wir den ganzen Tag am Pool verbrachten, konnte es passieren, dass der Schuppen am Abend leer und alle Handtücher in Haus und Garten verteilt waren. Mein Bruder machte sich dann über mich lustig, dass ich mich verhielt wie eine kleine Diva. Ach ja, Spanien war immer ein Erlebnis.
Der Tag, an dem ich von Opa Ludwigs Tod erfuhr, ist mir noch sehr präsent. Wir hatten ihn schon seit mehr als einem Jahr nicht mehr gesehen, als ich meinen Vater fragte, ob wir demnächst mal wieder nach Spanien fahren würden. »Der Opa will euch bald mal wieder besuchen kommen«, sagte er nur. Einige Tage später klingelte das Telefon. Mein Großvater war dran und bat nur darum, meinen Vater zu sprechen. Mehr sagte er nicht. »Papa ist nicht da, aber wann sehen wir uns denn wieder?« – »Sehr bald, ich komme irgendwann zu euch«, antwortete er kurz angebunden. So hatte ich ihn bislang nie erlebt. Zwei Wochen später war er tot. Sein Herz hatte plötzlich aufgehört zu schlagen. Er war einfach fort aus unserem Leben, keiner von uns hatte die Gelegenheit, sich zu verabschieden.
Wieder zwei Jahre später starb dann mein Urgroßvater, Johann Wald. Er wohnte in Unterschleißheim direkt neben meiner Oma, seiner Tochter, die sich bis zum Schluss um ihn kümmerte, sein Essen kochte, mit ihm spazieren ging. Manchmal hatte er uns von seinen Kriegserlebnissen erzählt. Schon vor dem Krieg war er als Sanitäter für das Rote Kreuz im Einsatz gewesen, und später in Frankreich hatte er sich, obwohl nur einfacher Soldat, an der Front um die Verwundeten gekümmert. Einmal gerieten sie in einen Hinterhalt, einige flüchteten, um sich in Sicherheit zu bringen; er blieb zurück, weil er die verletzten Kameraden nicht ihrem Schicksal überlassen wollte. Dieser Mut rettete ihm das Leben. Sie waren noch nicht weit gekommen, da erfasste die Flüchtenden eine Granate. Keiner überlebte, nur mein Großvater und die zurückgebliebenen Verwundeten. Die Splitter verletzten ihn allerdings schwer, zeitweise verlor er sein Augenlicht, erst nach einem Jahr konnte er wieder sehen. Rückblickend glaube ich, dass das Erzählen dieser Geschichten seine Art war, die Kriegsgeschehnisse zu verarbeiten. Er zeigte uns die Narben, die die Granatsplitter in seinem Nacken hinterlassen hatten. Teilweise steckten noch Splitter in ihm. Im Alter kamen sie immer weiter zum Vorschein, einer nach dem anderen. Ich kann mir nicht einmal ansatzweise vorstellen, was er damals erlebt haben mag. Trotzdem hat er mich durch seine Erzählungen geprägt, und obwohl ich mit dem Thema Krieg kaum in Berührung kam, so war es mir durch ihn doch irgendwie nah.