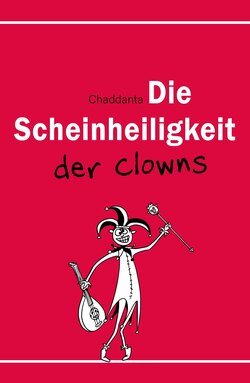Читать книгу Die Scheinheiligkeit der Clowns - Chaddanta . - Страница 7
ОглавлениеKapitel 3
Iduna und ich sitzen uns neben einer Garküche auf einfachen Holzbänken gegenüber. Wir haben Nudelsuppe mit Hühnerfleisch bestellt.
»Ich gehe jetzt einfach einmal davon aus, dass du recht hast und Reuben tatsächlich noch lebt«, beginne ich das Gespräch. »Es ist ganz einfach nicht in unserem politischen Interesse, eine solche Person zu liquidieren. Im Gegenteil, ich fühle mich vielmehr verpflichtet, das Leben dieser Person zu schützen, sodass er endlich seine Komplizen benennt und alle anderen offenen Fragen im Zusammenhang mit diesem Skandal klärt.«
»Das wird so nicht funktionieren. Es sind zu viele Prominente in diese Affäre verwickelt, die werden das niemals zulassen.«
»Warum ist er dann überhaupt noch am Leben? So gesehen wäre es einfacher gewesen, ihn spätestens in Haft zu töten. Warum sollte die Elite riskieren, dass Informationen ans Licht kommen, die ihre Existenz unweigerlich zerstören würden?«
Iduna kann geschickt mit Stäbchen umgehen. Sie hat damit eine Traube von Nudeln aus der Schale gehoben und saugt sie genüsslich ein. »Man nennt es den Reflex des toten Mannes«, erklärte sie, als sie runtergeschluckt hat. »Reuben war nicht dumm. Es gelang ihm, einen Mechanismus zu konstruieren, der im Falle seines Ablebens das gesamte kompromittierende Material an die Öffentlichkeit bringen würde. Das war und ist bis heute seine Lebensversicherung.«
»Woraus besteht das bloßstellende Material eigentlich genau?«
»Stell es dir als eine Videothek voll heimlich aufgenommener Pornografie vor, wobei die männlichen Darsteller aus Wissenschaft, Finanzen und Politik weltweit bekannt sind und die weiblichen Akteure bestenfalls Minderjährige oder in den meisten Fällen noch Kinder sind. Das alles ist zeitgemäß digitalisiert und vervielfacht.«
»Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Wenn wir auf das Angebot eingehen und ihn aus dem Spiel nehmen, dann wird genau dies geschehen.«
»Richtig, das ist auch der Sinn der Sache. Insbesondere ein Teil des politischen Establishments wird damit schwer desavouiert.«
***
Vielleicht ist es eher von nebensächlicher Bedeutung, aber ein Narzisst kann mit Enttäuschung nicht umgehen. Selbst kleinste Frustrationen lösen bei ihm einen emotionalen Sturm aus. Hat beispielsweise ein Kaufhaus ein bestimmtes Produkt nicht auf Lager oder ist ein Kleidungsstück nicht in der gewünschten Farbe erhältlich, so ist die Reaktion des Narzissten darauf von infantiler Unverhältnismäßigkeit geprägt. – Das gilt selbstverständlich nur, wenn seine persönlichen Erwartungen betroffen sind. Werden etwa öffentliche Verkehrsmittel seit Monaten bestreikt, so ist das für ihn ohne Bedeutung, hat jedoch sein Zug nur wenige Minuten Verspätung, so wird das zur Ungeheuerlichkeit. Das gilt auch auf politischer Ebene. Ein prominenter Künstler hatte vor einiger Zeit bei einem Auftritt eine blaue Kornblume am Revers. Das Symbol war vor mehr als 200 Jahren ein Zeichen für nationale Einheit und stand gegen die Willkür der Fürstenhäuser. Eigentlich hat es wenig mit den gegenwärtigen Zuständen zu tun. Trotzdem wurde es zum Eklat umfunktioniert. Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, warum so ein kleiner Fauxpas einen Sturm der Entrüstung auslöste. Die etablierte Politik betrachtet sich selbst als progressiv. Ihre Agenda soll als Fortschritt gelten und jeder noch so unbedeutende Missmut gilt als unverzeihliche Sünde. Es fehlt ihr die Gelassenheit, sich mit Kritik auseinanderzusetzen. Schon die Möglichkeit, dass der Bürger die Ziele des Regimes nicht teilt, löst Fassungslosigkeit aus. Der Narzisst ist seinem Wesen nach zur Demokratie nicht fähig. Sie ist in Wahrheit nur Fassade und dient der Legitimierung seiner selbstsüchtigen Absichten.
***
Wir sitzen schweigend im Auto, Iduna am Steuer. Das ist normal bei uns, ich fahre nicht gern.
»Paul, du bist ein Leugner!«, sagt Iduna schließlich.
Die Art und Weise wie sie mit dieser Frage unsere Ruhe stört, irritiert mich. Ich verstehe den Vorwurf nicht. »Ich habe noch nie etwas geleugnet. Wenn ich etwas in Abrede stellte, dann immer begründet.«
»So habe ich das nicht gemeint. Ich spreche von der allgemeinen Verweigerung der meisten Menschen, wenn es um den Tod geht. Wenn etwa von Schlafes Bruder die Rede ist, dann ist das eine Verleugnung des endgültigen Ablebens.«
»Vielleicht hast du sogar recht, aber wenigstens ist das noch nicht strafbar.«
»Ich merke regelrecht, wie dir unwohl wird«, seufzt sie. »Du hast dir noch nicht die angemessene Positivität zum Unabwendbaren erarbeitet. Beruflich habe ich fast täglich mit diesem Widerstand zu tun. Die Betroffenen müssen es nicht einmal aussprechen. Beispielsweise waren Särge früher sechseckig und deuteten damit die Silhouette eines menschlichen Torsos an. Heute sind es fast immer rechtwinklige Kisten, die hinuntergelassen werden.«
»Iduna, wir müssen das nicht dramatisieren. Belassen wir es bei dem Bewusstsein, dass wir beide bezüglich des Begriffs Leugnung unterschiedliche Schwerpunkte setzen.«
Wir kommen an einer Ampel zu stehen und sie dreht mir ihren Kopf zu. Ihr Blick ist durchdringend und ihr Lächeln verrät mir, dass sie mir auf die Schliche gekommen ist. »Du stehst in dieser Hinsicht ganz am Anfang. Mein Vater hatte bei bester Gesundheit in die versammelte Tischrunde gefragt, wer von uns den Stecker zieht, wenn er dereinst an diesen medizinischen Maschinen hängt. Alle haben stumm auf ihren Teller geschaut, bis ich mich meldete. Auf meine Iduna kann ich mich verlassen!, hat er dann laut gerufen und wir haben unsere Gläser erhoben.«
»Das ist natürlich von Familie zu Familie unterschiedlich«, gebe ich zu bedenken.
»Wir lebten damals an der Küste und meine Großmutter bat darum, an die Haie verfüttert zu werden. Sie sorgte sich sehr um diese Tiere, seit sie erfuhr, dass die Chinesen ihre Flossen als Delikatesse verzehren.«
Die Konversation ist mir unangenehm und ich behaupte, im Handschuhfach klappere etwas.
»Und dann erinnere ich mich noch an jenen Kunden mit enger Mutterbindung. Er bat um die Herstellung zweier Urnen in Form russischer Matroschkas. Du kennst doch diese hölzernen bunt bemalten Puppen, auch Babuschkas genannt, die ineinander verschachtelt werden. So sollte auch seine Asche eines Tages in der Urne seiner Frau aufgehoben sein.«
»Psychologisch sehr aufschlussreich!«, antworte ich, während Iduna links abbiegt und einem kulanten Verkehrsteilnehmer freundlich zuwinkt.
***
Mich treibt die Frage um, ob ein ungewöhnlicher Familienname Einfluss auf das Schicksal eines Narzissten hat. Ich denke dabei an Namen, die im Gegensatz zur beruflichen Empfehlung ihres Trägers stehen. Beispielsweise erzeugt es bei einem Patienten Stirnrunzeln, wenn er ausgerechnet an einen Herzchirurgen Dr. Zitterhand gerät oder ein Seelsorger sich als Helmut Hackebeil entpuppt. Ich erinnere mich an einen Jahrhundertbetrüger, der den Namen Madoff trug. Genau genommen war dieser Familienname einer der wenigen authentischen Aspekte seines Lebens. Seine Vorfahren waren damit auf der Flucht vor den Kosaken von Osteuropa nach Nordamerika ausgewandert. Sein Vater musste als Inhaber eines Sportgeschäfts zweimal Konkurs anmelden. Nach dem politikwissenschaftlichen Studium an einer unbedeutenden Universität verdingte er sich zunächst als Rettungsschwimmer und später als Experte für Gartenbewässerung. Wahrscheinlich wäre er genauso erfolglos wie sein Erzeuger geblieben, wenn er nicht plötzlich zu seiner Berufung gefunden hätte. Als Makler von Anteilsscheinen lokaler Unternehmungen brachte er zwar seine Kleinanleger nicht systematisch um ihr Geld, doch muss ihm bewusst gewesen sein, dass die in Finanzgeschäften unerfahrenen Leute die Risiken dieser Anlagen nicht realistisch einschätzen konnten. Einige Zeit später suchte er auf Golfplätzen gezielt Kontakt zu wohlhabenden Kunden und schaffte es schließlich auf dem Börsenparkett nach ganz oben. Zeitweilig war er sogar Mitglied des Aufsichtsgremiums. Sein oberflächlicher Charme begann sich mit Zurückhaltung zu verbinden. Jene, denen es vergönnt war, in seine Fonds zu investieren, betrachteten sich als Privilegierte. Diesen vermeintlich Auserwählten stand er dann als eine Art Mediziner in Finanzfragen zur Seite. Außerdem empfahl er sich Wohltätigkeitsorganisationen und gemeinnützigen Stiftungen als großzügiger Philanthrop. Diese wiederum überantworteten Anteile ihres Vermögens seiner Verwaltung. In Wirklichkeit beruhte sein Geschäft aber auf einem Ponzi-Schema, manche nennen es auch Schneeballsystem oder das Von-Peter-zu-Paul-Spiel: Was er Paul und anderen als Gewinn ausschüttete, hatte er zuvor von Peter als Einlage erhalten. Um kein Aufsehen zu erregen, pflegte er diese Erlöse nicht zu übertreiben. Tatsächlich ging aus seinen Investitionen aber keine Wertschöpfung hervor. Die Auszahlungen hatten ihre Ursache in der Anwerbung von Neukunden und der Aufstockung der Anlagen bereits rekrutierter Investoren. Eine globale Finanzkrise zwang große Teile der Geldgeber schließlich, ihre Anlagen abzuziehen – der Schwindel flog auf. Seiner Klientel entstand ein Schaden in astronomischer Höhe, denn über Jahrzehnte hinweg war er ein notorischer Betrüger gewesen, hatte Prüfberichte gefälscht und die Börsenaufsicht sehr geschickt hinters Licht geführt. Zu seinem manipulativen Wesen gehörte das interne Wissen um die Arbeit der internationalen Behörden. Er konnte darauf zählen, dass inländische Stellen den Aufwand scheuen würden, ausländische Institute zu kontrollieren und umgekehrt. Auf den Fall einer Aufdeckung seiner verbrecherischen Umtriebe hatte er sich zwar vorbereitet, doch die Polizei nahm ihn umgehend in Haft. Zahlreiche seiner Komplizen sowie viele seiner bankrotten Kunden nahmen sich das Leben. Der genaue Zeitpunkt und die Ursache seines Einstiegs in die Wirtschaftskriminalität sind bis heute ungeklärt. Es gibt dazu widersprüchlich Angaben. Unter Applaus des Publikums verurteilte das Gericht ihn zu einer Höchststrafe von 150 Jahren. Unter der Bedingung guter Führung sowie der Erfüllung von Auflagen könnte er damit rechnen, im Alter von 205 Jahren das Gefängnis zu verlassen. Ungeklärt bleibt auch die Frage, warum er nicht auf dem Zenit seines Erfolges das Weite gesucht hat und es versäumte, sich in jenen Staat abzusetzen, der kein Auslieferungsabkommen mit seinem Heimatland unterhielt. Er hätte zweifellos einen Anspruch auf Einbürgerung in Palästina gehabt. Der Grund ist vermutlich, dass er wenigstens auf einer kognitiven Ebene zur Empathie fähig war. Er konnte sich zwar nicht emotional in das Leid hineinversetzen, das er jenen zufügte, die in einer geschäftlichen Beziehung zu ihm standen, aber auf kognitiver Ebene hatte er dieses Verständnis. Diese narzisstische Schadenfreude wurde ihm zum Verhängnis.
Aber zurück zur Eingangsfrage: Nein, dem Namen Sich-davon-Gemacht ist er damit nicht gerecht geworden.
***
Iduna steht im Bad vor dem Spiegel und schminkt sich. Die Lidschatten lassen sie noch blasser aussehen. Ich stehe hinter ihr und wir beide blicken uns indirekt an.
»Du könntest deiner Natürlichkeit mehr Raum geben«, sage ich nach einer Weile.
»Es ist mir wichtig, mich selbst zu organisieren und so die Kontrolle über mich zu behalten«, antwortet sie, immer noch an ihren Augenbrauen zupfend.
»Warum?«
»Weil die Endlichkeit für mich ein wichtiger Aspekt meines Lebens ist. Verstehst du, eines Tages werden wir die Kontrolle über uns ein für alle Mal verlieren. Das gilt für jeden von uns. Auch für dich!« Lächelnd sieht sie mich an.
Sie weiß genau, dass ich das Lebensende nur allzu gern verdränge. Das verführt sie dazu, mich damit zu konfrontieren, und es gelingt ihr immer wieder aufs Neue. Die Art und Weise, wie sie sich in unsere Beziehung einbringt, macht sie so liebenswert. Sie nimmt Anteil an mir. Ihr Interesse an meiner Gedankenwelt und meinen Gefühlen ist nicht geheuchelt. Und abgesehen von dem bisschen Puder im Gesicht ist sie absolut authentisch. Sie ist so, wie man sie erlebt.
»Bist du frei von Vorurteilen?«, fragt sie unvermittelt.
»Wie kommst du auf diese Frage?«
»Ich prüfe gerade deine Ehrlichkeit.«
Wir lachen beide.
»Nun gut, ich gebe die Antwort so gewissenhaft wie möglich: Manche halten Stereotype für das Ergebnis exakter Beobachtung. Andere behaupten, sie enthielten zumindest ein Körnchen Wahrheit. Meine eigene Position dazu ist, dass sie die Mentalität einer Gruppe nur zu gut wiedergeben, allerdings bedeutet dies nicht, dass sie auf jedes einzelne Mitglied dieser Gruppe zutreffen.«
»An wen oder was denkst du gerade?«
»An den Wertekanon jener Schicht, die über uns herrscht. Sie ist so auf sich selbst zentriert, dass sie sich geradezu selbst absorbiert. Anders kann ich es nicht sagen.«
»Ich verstehe, was du meinst«, erwidert Iduna. »Eine Zeit lang gelingt es, ihnen sympathisch zu erscheinen, aber dann bricht es durch. Charakteristisch ist vor allem ihr Unwille zuzuhören. Sie sind gar nicht an einer aufrichtigen Kommunikation interessiert. Für sie gilt ausschließlich das als Wahrheit, was momentan ihren Interessen dient.«
»Es gibt ein zweites Charakteristikum, das ich erst spät bemerkte. Es ist die Art, wie sie Dank entgegennehmen.«
»Nämlich wie?«
»So als wollten sie sagen: Das verdiene ich doch so oder so!«
»Wenn man tatsächlich Schuld auf sich geladen hat, ist man dann gut beraten, sich bei einem Narzissten zu entschuldigen?«, will Iduna wissen.
»Natürlich nicht«, antworte ich. »Erstens empfindet er keinerlei Empathie für andere Menschen. Deshalb ist seine Umwelt ohnehin an allem schuld. Und außerdem wird er die ganze Hand nehmen, wenn ihm jemand den kleinen Finger reicht. Unsere eigene Schuld einzugestehen, ist ein effizientes Mittel, um Konflikte beizulegen, aber es setzt ein intaktes Gegenüber voraus.«
***
Wer von uns sich dem Schuldkult verweigert – und das sind immer größere Teile der Gesellschaft – der sieht sich schnell dem Vorwurf der Verdrängung ausgesetzt. Angesichts der Allgegenwärtigkeit des Mythos in Medien, Politik und Unterhaltung ist diese Bezichtigung absurd. Da die leiseste Kritik jedoch justiziabel ist und schwer sanktioniert wird, findet ein herrschaftsfreier Diskurs zu diesem Thema nicht statt. Die narzisstische Lufthoheit trägt manichäische Züge. Es gibt in Bezug auf die Schuld nur Schwarz oder Weiß. Die Täter sind entgegen den historischen Fakten nie Opfer und die Opfer trotz gegenteiliger Sachverhalte nie Täter. Das Ergebnis einer generationenübergreifenden Dauerbeschulung ohne Nuancen und Balance ist Langeweile. Es besteht kein Interesse daran, sich in Beschuldigungen zu vertiefen, die längst nicht mehr vorgebracht, sondern verhängt werden. Da sie immerzu mit einer Vorverurteilung verbunden sind, ist die Reaktion allenfalls defensiv. Man versucht, Ärger zu vermeiden, und macht das Spiel zum Schein weiterhin mit. Tatsächlich empfindet fast niemand mehr Empathie mit den ewigen Opfern. Es ist ein lebloser Kult. Seine Priester fordern Funktion und Konformität. Doch die wahrhaft Gläubigen sind selten geworden und ihre Teilnahme am Gottesdienst beruht nicht auf Anteilnahme, sondern Pflicht.
Eine gar nicht so seltene Art des narzisstischen Angriffs auf ein Opfer beruht auf dem Einsatz der Absurdität. Manchmal kommt das als etwas Widersinniges, in den meisten Fällen als etwas Unsinniges daher. Oft ist es ein seltsames Vorkommnis oder eine Situation, dem der Verstand des Einzelnen entgegen seiner Gewohnheit keine vernünftige Bedeutung zuordnen kann. Eine Patientin berichtete mir einst ein Erlebnis mit ihrem Ehemann, das sie ratlos zurückließ. Ihr Gemahl betrachtete sie längere Zeit kritisch, dann entspann sich folgender Dialog:
Gemahl: »Eigentlich könntest du etwas größer sein!«
Patientin: »Du meinst meine Körpergröße? Aber die entspricht doch für eine Frau in etwa dem Bevölkerungsdurchschnitt.«
Gemahl: »Warum sollte ich mich an Normen gebunden fühlen?«
Patientin: »Wir kennen uns nun seit mehr als zwölf Jahren. Ich habe dir nie etwas vorgemacht oder versucht, dich in dieser Hinsicht zu täuschen.«
Gemahl: »Das behaupte ich auch gar nicht.«
Patientin: »In meinem Reisepass ist meine Körpergröße mit ein Meter siebenundsechzig angegeben. Wie groß sollte ich denn deiner Ansicht nach sein?«
Gemahl: »Etwa einen Kopf größer, das wäre fein.«
Das Opfer einer absurden Offensive vermag diesen, dem gesunden Menschenverstand widersprechenden Anschuldigungen keinen logischen Widerstand entgegenzubringen. Da der Narzisst seine Maßstäbe absolut setzt, hat die Rationalität keine Aussicht auf Wirkung. Nicht selten lädt sich die Absurdität emotional zur Raserei auf. Es folgt dann ein Stakkato bösartiger Vorhaltungen, die sich immer mehr steigern. Ich erinnere mich an einen prominenten Vertreter einer bestimmten Opfergruppe, der behauptete, im Land der Täter würden bis auf den heutigen Tag spontan Blutfontänen von Ermordeten aus dem Boden und in den Himmel schießen. Das Blut von Toten gerinnt nachweislich sehr schnell, die Anklage ist also völlig haltlos und aus der Luft gegriffen. Als er mit äußerster Höflichkeit auf diesen Sachverhalt angesprochen wurde, änderte er das Thema. Nun ging es um sein Trauma, das entstand, als er beim Duschen erkannte, dass die Seife, die er verwendete, aus dem Körperfett seiner verschollenen Schwester produziert worden war. Selbstverständlich macht es keinen Sinn, mit solchen Leuten zu argumentieren. Sie kennen kein Wir, das auf einem gemeinsamen Nenner beruht. Man ist gut beraten, sie einfach stehen zu lassen und einen eigenen Weg einzuschlagen.
Jeder von uns nimmt gern Komplimente und Anerkennung entgegen. Das ist völlig normal. Das Problem des Narzissten besteht darin, dass er auf emotionale Zufuhr dieser Art existenziell angewiesen ist. Sein Grundsatz lautet nicht Ich denke, also bin ich sondern Ich werde bewundert, also bin ich. Gesunde Menschen verstehen dieses Bedürfnis nur schwer und sie neigen dazu, seine Intensität zu unterschätzen. Man stelle sich einen Taucher mit seinem Sauerstoffgerät auf dem Rücken vor. Zunächst atmet er ruhig und gleitet durch die Tiefe. Plötzlich wird ihm die Luft abgedreht und seine erste Reaktion wird schiere Panik sein. Er kann ohne das komprimierte Gasgemisch nicht überleben. Diese Analogie beschreibt recht treffend die Abhängigkeit des Narzissten von seiner gefühlsmäßigen Versorgung. Sie ist für ihn so elementar, dass er ohne sie unmöglich auskommen kann.
Ein weiterer Aspekt dieser Persönlichkeitsstörung ist ihre Einseitigkeit. Die Logistik ist gewissermaßen der Art, dass sich auf einer einspurigen Schnellstraße ein Transporter nach dem anderen auf den Weg macht, um die Anlieferung von Empathie aufrecht zu erhalten. All diese Fahrzeuge kommen leer zurück und bezahlt wird auch nichts. Auf internationaler Ebene kann man sich einen narzisstischen Staat als Privilegierten innerhalb der Völkerfamilie vorstellen. Er genießt Vorrechte, die anderen Nationen vorenthalten werden. So wird er beispielsweise nukleare Massenvernichtungswaffen besitzen dürfen und für seine wiederholten Verletzungen des Völkerrechts nicht zur Verantwortung gezogen werden. Er verbittet sich jede Kritik. Sein Existenzrecht ist die Staatsraison seiner Cheerleader. Deren Aufgabe besteht darin, ihn mit Finanztransfers und neuester Militärtechnik zu versorgen. Außerdem sollten sie aus eigenem Antrieb heraus bei jeder sich bietenden Gelegenheit seinen Siegelring küssen. Da all jene, die ihm treu ergeben sind, nicht genau wissen, wie viel Wohlgefallen Narkissos gerade benötigt, aber sehr wohl, dass eine Unterversorgung drastische Folgen hätte, kann diese Beziehung sehr erschöpfend werden. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich gezeigt, dass die historische Schuld, auf der diese Sonderrechte beruhen, mit Zunahme des zeitliche Abstandes zu den ominösen Geschehnissen nicht etwa abnimmt, sondern immer weitere Staaten einbezieht. Doch deren demografische Entwicklung wird in naher Zukunft in einer Katastrophe münden. Dann steht die Existenz des Narzissten selbst auf dem Spiel.
Zu den verschiedenen Spielarten des Narzissmus gehört die Triangulierung. Der Psychopath, der täglich die Stiegen in seinen geheimen Keller hinab schleicht und sich dort bei seinen eingekerkerten Opfern sadistische Zufuhr holt, ist entweder Kino oder ein seltener klinischer Fall. Narzisstische Beziehungen sind vielmehr ausgeklügelte Netzwerke, die in einer dynamischen wechselseitigen Relation zueinander stehen. Das Instrument der Triangulierung erlaubt dem gebrochenen Ich, konkurrierende Subjekte zu kontrollieren. Beispielsweise kann in einer Familie das eine Kind als vielversprechendes Talent gelten, das andere hingegen als schwarzes Schaf. Gewöhnlich spricht man in diesem Zusammenhang vom goldenen Kind und vom Sündenbock. Eltern können wiederholt auf die besseren Schulnoten eines Nachbarkindes verweisen und somit klarmachen, dass sie es sind, die die Maßstäbe setzen.
Bezogen auf gesellschaftliche Prozesse erscheint dieses Schema zu vereinfacht. Das Geflecht ist hier komplexer und die Resultate fallen schwerer ins Gewicht. Der Clown wird in dieser Situation mit ernstem Gesicht vor einem Schachbrett sitzen und sich jeden Zug gründlich überlegen. Grundsätzlich geht es ihm darum, Chaos zu erzeugen und gleichzeitig die Konkurrenten gegeneinander auszuspielen. Tatsächlich steht er selbst mit jeder der einzelnen Spielfiguren in Beziehung und beeinflusst deren Gefühle und Handlungen. Den einzelnen Akteuren ist dies kaum oder gar nicht bewusst. Jeder denkt an seinen eigenen Nutzen und vertritt scheinbar seine eigenen Interessen. Sein Nächster ist sein Wettbewerber und über längere Zeiträume hinweg hat mancher dem anderen unversöhnliche Wunden geschlagen. Jeder macht dem anderen Vorwürfe und sieht in ihm den Schuldigen. Der Narzisst hat hingegen einen Fuß in jeder Partei. Solange diese nicht miteinander koalieren können, hat er die Kontrolle inne.
Es gibt historische Stressperioden, in denen Zufälle oder individuelle Handlungen ein ganzes politisches System zum Einsturz bringen. Manchmal sind es aber auch persönliche Entscheidungen in einer eher stabilen geschichtlichen Situation, die die Zukunft maßgeblich beeinflussen.
Einer dieser Zeitpunkte war sicherlich die Konfrontation Jesu mit Pontius Pilatus am Morgen des Freitags vor dem Pessachfest des Jahres 30 oder – anderen Geschichtsschreibern zufolge – 31. Der römische Statthalter soll zu dem vom Hohen Rat des Tempels zu Jerusalem überstellten Gefangenen gesagt haben: »Weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich freizugeben, sowie die Macht, dich zu kreuzigen?« Dem Evangelisten Johannes zufolge soll der Verhaftete geantwortet haben: »Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre.«
Den Zeugnissen aller vier neu-testamentarischen Evangelien gemäß wollte Pilatus Jesus nicht verurteilen. Genau genommen war die Provinz Judäa nur eine Untergliederung der Provinz Syrien. Pontius Pilatus war im Jahre 26 von Lucius Aelius Seianus, einem Vertrauten des Kaisers Tiberius, zum fünften Präfekten Judäas ernannte worden.
Jener Prozess gehört zweifellos zu den Wendepunkten der Weltgeschichte und es stellt sich die Frage, ob Pilatus hätte anders handeln können und was die Folgen einer Freilassung Jesus gewesen wären. Bekanntlich folgte der Statthalter dem Wunsch des Sanhedrin unter dem Vorsitz des Hohepriesters Kaiphas und ließ den Angeklagten ans Kreuz schlagen. Allerdings sprach dieser selbst kein eigenständiges Urteil, sondern überließ die Entscheidung der aufgehetzten Menschenansammlung vor seinem Amtssitz. Diese entschied sich dafür, den Räuber und Aufrührer Barabbas freizubekommen. Pilatus wusch nach dem Beschluss demonstrativ seine Hände in Unschuld.
Nichts ist alternativlos und man ist versucht, darüber zu spekulieren, welche Szenarien denkbar wären, wenn der Statthalter Roms seine Macht anders eingesetzt hätte. Dem Zeugnis des Evangelisten Lukas zufolge machte er dem jüdischen Hohen Rat folgenden Vorschlag: »Darum will ich ihn geißeln lassen und umgehend freigeben.«
Die erste Möglichkeit besteht darin, dass in diesem Falle die historische Person Jesus in der Bedeutungslosigkeit verschwunden wäre. Pilatus hätte sein Urteil mit der Auflage verbinden können, dass Jesus ab nun seine Lehrtätigkeit untersagt sei. Wahrscheinlich wäre er dann nach Nazareth zurückgekehrt und hätte noch einige Jahre als Zimmermann gelebt. Da er schon vor seiner Festnahme im Garten Gethsemane seinen Jünger wiederholt sein Schicksal als Märtyrer angekündigt hatte, wäre er damit auch als falscher Prophet entlarvt worden. Das bewusste Opfer war der narzisstische Kern seiner Botschaft. Diese blasphemische Erkenntnis ist Gläubigen nicht zugänglich. Wären Jesus entgegen aller Erwartung dennoch einige Anhänger geblieben, dann wären die Nazarener, wie etwa die Sadduzäer oder die Caelicoli, eine der zahlreichen mehr oder weniger jüdischen Sekten ihrer Zeit gewesen.
Die andere Variante bezieht sich auf jene Textstellen, die so gar nicht zur Botschaft der Bergpredigt passen. Im Matthäusevangelium sagt Jesus: »Ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen sei, Frieden zu senden, sondern das Schwert.« Fünf Verse weiter steht geschrieben: »Wer sein Leben verliert meinetwillen, der wird es finden.« Ein weiterer unmissverständlicher Satz aus dem Evangelium des Lukas lautet: »Doch meine Feinde, die nicht wollen, dass ich über sie herrsche, bringt sie her und schlachtet sie vor meinen Augen.« Was wäre die Folge von Pontius Pilatus Milde und einem von Jesus angeführten Aufstand gewesen? Wahrscheinlich hätte der Präfekt selbst über die Mittel verfügt, die Rebellion niederzuschlagen. In diesem Fall wären die maßgeblichen Aufwiegler der Sekte und damit Jesus selbst getötet worden. Wären die unmittelbar in Judäa stationierten römischen Truppen dazu zu schwach gewesen, hätte eine Strafexpedition wie jene des Vespasian die Situation bereinigt. Ob sich aus diesem Szenario das Christentum mit seiner pazifistischen Botschaft entwickelt hätte, ist allerdings mehr als zweifelhaft.
Im Jahre 36 wurde Pontius Pilatus vom Legaten Syriens, Lucius Vitellius, abberufen. Verschiedene Vergehen, wie zum Beispiel der Bau einer Wasserleitung auf Staatskosten zu seinem Privathaus, wurden ihm zur Last gelegt. Dann verlieren sich seine Spuren. Weder das Jahr noch der Ort seiner Geburt sind bekannt, auch über das Datum und die Umstände seines Ablebens gibt es keine belastbaren Angaben. Nicht einmal sein Vorname ist überliefert. Aufgrund der schlechten Quellenlage wurde wiederholt behauptet, der Präfekt hätte als historische Figur gar nicht existiert. Jedoch bringen sich drei antike Münztypen und ein Siegelring mit der Amtszeit Pilatus in Verbindung und seit dem archäologischen Fund einer Inschrift in seiner palästinensischen Residenzstadt Caesarea gilt seine Existenz als gesichert. Das Lukasevangelium berichtet, dass Pilatus aufgrund der ungeklärten Zuständigkeit im Justizfall Jesus diesen an eine jüdische Autorität in Gestalt des Tetrarchen Herodes Antipas sandte. Herodes verhörte Jesus, trieb seinen Spott mit ihm und sandte ihn dann an den Präfekten zurück. Die Figur des Pontius Pilatus hat weder klare Ursprünge noch ist sein weiteres Schicksal bekannt. Er verdichtet sich in einer Situation, in welche er vermutlich wider Willen gestellt war. Zu der Entscheidung, die er fällen musste, war er vielleicht gar nicht befugt. Trotzdem hat er in diesem einen Moment Einfluss auf die Geschichte genommen wie sonst nur sehr wenige. Ohne es zu Lebzeiten zu ahnen, hatte er einen Religionsstifter inthronisiert.
***
Iduna hat sich eine Zigarette angezündet. Ich selbst habe das Laster schon vor Jahrzehnten aufgegeben. Es ist jetzt nicht mehr für mich als krebserregender Gestank. Andererseits kann ich mich an die netten Seiten dieser Gewohnheit noch erinnern. Auf dem Weg zum Erwachsensein war es für mich, wie für viele andere, ein Meilenstein.
»Wir hatten vor ein paar Tagen eine interessante Diskussion«, beginnt sie. »Es ging um unser Verhältnis zu einer fremden Kultur, mit der wir aus historischen Gründen verknüpft sind. Es fiel das Wort verhängnisvoll. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Ich stimme deiner Einschätzung dieses Volkes weitgehend zu, aber müssten wir die Wirkung einer solch unheilvollen Nähe nicht an uns selbst bemerken? Ich meine damit nicht die fatalen politischen Veränderungen in unserem Land. Mir geht es um unsere tagtäglichen Reflexe und spontanen Reaktionen.«
»Ich weiß, was du meinst. Es sind die alltäglichen Begegnungen jedes Einzelnen, die untrüglich sind. Sie legen das ungeschminkte Zeugnis ab, jenseits der wohlgefälligen Gedenkreden und immer gleichen Solidaritätsappelle.«
Wir schweigen eine Weile. Man könnte an dieser Stelle auf persönliche Erlebnisse und Anekdoten zurückgreifen, aber wie viel Allgemeingültigkeit steckt in ihnen?
»Wenn ich mich richtig erinnere, dann habe ich diese Kultur in unserem Gespräch keineswegs pauschal dämonisiert. Ich habe jedoch auf einige spezifische Merkmale verwiesen, die langfristig, in Verbindung mit einem Machtgefälle, auf all jene, die eine enge Verbindung zu ihr pflegen, eine negative – im Extremfall sogar zerstörerische – Wirkung haben. Auf der individuellen Ebene gibt der Narzisst seinem Opfer das Gefühl, gehasst zu werden. Es gilt als aussätzig und unrein. Wenn diese Abwertung verinnerlicht wird, dann beginnt die betreffende Person zu resignieren. In stummen Selbstgesprächen wird sie sich dahingehend äußern, ein unwerter Mensch zu sein. Die Abhängigkeit vom Narzissten wird sie ängstlich machen. Der kleinste Fehler wird ihren allgemeinen Makel bestätigen. Aus Sorge, dass eigenes Material gegen sie verwendet werden kann, wird sie beginnen, Informationen geheim zu halten. Ein verlässliches Zeichen für narzisstischen Missbrauch ist die Weigerung, dem Narzissten erbauliche Nachrichten zukommen zu lassen. Das Opfer weiß dann nur zu genau, dass der Empfänger sich nicht mit ihm freuen wird. Und ein eindeutiges Signal ist auch, wenn die Distanz zu der gestörten Person als Steigerung des eigenen Wohlbefindens empfunden wird.«
Iduna drückt ihre Zigarette aus und lächelt still in sich hinein. »Das klang wie ein Auszug aus einem Lehrbuch. Geht es nicht auch etwas konkreter?«
»Weißt du, Iduna, der Narzisst ist ein Wesen, das sich nur ungern als das zu erkennen gibt, was er tatsächlich ist. Lassen wir ihm also seine Privatsphäre.«
»Jetzt bist du wieder so nebulös!«, schmollte sie. »Dabei sind wir doch unter uns.« Sie sitzt mit angezogenen Knien auf dem Sofa und legt sich verschiedene Kissen zurecht. Im Moment wirkt sie auf mich wie ein Mädchen, das auf ihre Gute-Nacht-Geschichte wartet.
»Kannst du dich an den ehemaligen Premierminister erinnern, der beim Empfang mit militärischen Ehren die Hände zu Fäusten an der Naht seiner Hose ballte?«
»Ich weiß, wen du meinst«, kichert Iduna.
»Diesen kleinen Verstoß gegen das diplomatische Protokoll hätten die Medien leicht unter den Tisch fallen lassen. Aber das Essiggesicht dieses Staatsgastes war so unübersehbar, dass es selbst der etablierten Politik nur allzu recht war, als er wieder abreiste.«
»Sogar seine Pupillen sollen sich vor Feindseligkeit geweitet haben.«
»Das ist wissenschaftlich umstritten, aber die Mimik war wie aus dem Gruselkabinett.«
»Ein weiteres Beispiel für unverhohlenen Hass ist dieser Film mit den sogenannten ruhmlosen Bastarden. Einer der Schauspieler soll den Streifen als feuchten Traum seines Volkes bezeichnet haben.«
»Du meinst den Bären-Moses, wie er sich in der berühmten Szene selbst bezeichnet.«
»Ja, so oder ähnlich.«
Ich hatte mir damals den Film extra aufgrund seiner psychopathischen Natur im Kino angesehen. Er war quälend lang und jenseits der Gewaltexzesse durch und durch gewöhnlich.
»Wie man hört, ist der Produzent seit Jahren auf Montage.«
»Ja, allerdings nicht für sein Machwerk, sondern für die Vergewaltigung von mindestens sechs Frauen und dutzender weiterer sexueller Übergriffe. Ich will mich über diese Dinge jetzt nicht auslassen, aber er war pervers und in jeder Hinsicht eine ekelhafte Gestalt.«
»Ich bin mir nicht sicher, ob dieser kinematische Hassgesang nicht am Ende nach hinten losgehen wird«, meint Iduna nachdenklich. »Er setzt eine Parteinahme des Publikums für eine Soldateska voraus, auf die ich mich langfristig nicht verlassen würde. Der Film mag eine Legende sein, aber möglicherweise wird man ihn eines Tages mit anderen Augen sehen. Wer Wind sät, wird Sturm ernten.«
***
Wenn der Begriff pathologisches Lügen ins Spiel kommt, denken viele Menschen zunächst an den Lügenbaron Hieronymus Carl Friedrich von Münchhausen. Dessen Geschichten folgen jedoch einem anderen Muster. Der pathologische Lügner erzählt die Unwahrheit über Jahre hinweg. Die Art, seine Anekdoten vorzubringen, ist chronisch und impulsiv. Der Zweck, den er damit verfolgt, ist unergründlich. Es scheint, als sei er von einem internen Motiv angetrieben. Möglicherweise enthält es ein verdeckt narzisstisches Element. Es sind Tagträume und Fantasien mit einem bestimmten historischen Bezug, an dem er Anteil hat. Dabei wirkt er introvertiert und sein Überleben scheint an ein Wunder zu grenzen. Teilweise sind die Geschichten rational nicht nachvollziehbar. Sie halten wissenschaftlichen Überprüfungen nicht stand und da der Zeitzeuge unbeirrt daran festhält und sie bei jeder Gelegenheit zum Besten gibt, bewegt er sich nicht selten am Rande des Wahns. Da ihm sowohl aus Höflichkeit als auch wegen drakonischer Sanktionen niemand zu widersprechen wagt, scheint es nicht ausgeschlossen, dass der Überbringer der Mär am Ende selbst an seine Aussagen glaubt. Diese Form von Selbsttäuschung kann von Vorteil sein. Er wirkt bestimmter und fühlt sich zu neuen Ausschmückungen ermutigt. Am Ende entsteht daraus eine zeitgeschichtliche Parallelwelt mit ihrem schaurigen Trug und ihren irrwitzigen Absonderlichkeiten. Hier kommen wieder die hilfreichen Komplizen ins Spiel, die das Absurdeste unter den Tisch fallen lassen, das eine oder andere geradebiegen sowie jene Gewissheiten bevormundend immer aufs neue repetieren, die gar keine sind.
Manchmal lassen sich die Dinge nicht sinnvoll ordnen. Da ist beispielsweise diese völlig verfahrene Beziehung zwischen uns und einem Volk, das sich selbst völlig anders sieht. Vielleicht täte man gut daran, die Beziehungen zueinander für längere Zeit auf Eis zu legen und das wechselseitige Verhältnis neu auszuhandeln beziehungsweise für immer zu beenden. In einer vernetzten Welt mit ihren komplexen Machtstrukturen ist das nicht möglich. Man muss sich also miteinander arrangieren und an diesem Punkt kommt jenes Phänomen zum Tragen, das ich mystisches Denken nenne. Man bezeichnet die Beziehung als relativ gut und negiert einfach all jene dreisten Unverschämtheiten, haltlosen Forderungen und einseitigen Unterstellungen. Damit macht man sich etwas vor. Für eine Weile mag das gut gehen, auch wenn es anstrengend ist. Langfristig wird man sich einer unangenehmen Wahrheit stellen müssen. Das narzisstische Gegenüber ist kein ehrlicher Mensch. Für ihn steht nicht der offene Austausch im Vordergrund. Seine Freundschaft ist berechnend. Es geht ihm um seinen materiellen und affektiven Vorteil und nicht etwa um die betreffende Person. Sein Interesse ist nicht teilnehmend, sondern sammelt Informationen, um sie zu verwenden. Meist braucht es eine gewisse Zeit, um den selbstsüchtigen Charakter einer Person zu erkennen. In unserem Fall ist das nicht so. Die Berufung ist Programm und jeder ist gut beraten, die Privilegien unseres Partners nicht zu hinterfragen. Dass unsere eingespielte Dienstbarkeit keinen Dank erfährt, gehört zur Rollenverteilung. Der Narzisst mit seinem gebrochenen Selbst kann gar nicht anders. In Wirklichkeit ist er es, der auf seinen Part festgelegt ist.
Er wird sich sehr schwer damit tun, sich einst in eine neue Ordnung einzugliedern.