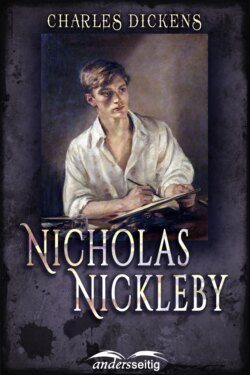Читать книгу Nikolas Nickleby - Charles Dickens, Чарльз Диккенс, Geoffrey Palmer - Страница 9
6. Kapitel: Der erwähnte Unfall gibt ein paar Herren Gelegenheit, einander Geschichten zu erzählen
Оглавление»Oha«, rief der Kondukteur, der im Augenblick wieder auf den Beinen war und zu den Vorderpferden eilte. »Ist denn neamd do, wo mit Hand anlegen kunnt! Ob'st her gehst, Mistviech. Oha.«
»Was ist geschehen?« fragte Nikolas verwirrt.
»Wos g'schegn is? Gnua für heut nacht«, versetzte der Kondukteur. »Der Teufi hol den einäugigen Schinder. Toll is er gworden und bild't sich was drauf ein a no, daß er d' Kutschn umgworfen hat. Da, können S' nöt Hand mit anlegen? Hols der Teufel, i täts, und wenn mir alle Knochen zerbrecheten.«
»Ich bin schon da«, rief Nikolas, sich auf die Beine helfend. »Meine Sinne waren nur noch nicht ganz beieinander. Das ist alles.«
»Ziagn S' fest an«, rief der Kondukteur, »ich will daweil die Sträng oschneiden. Gut so, Herr. Jetzt können S' es wieder fahrenlassen, Blitz und Hagel, die werden schnell gnua heimlaufen.«
Und richtig, kaum waren die Tiere befreit, als sie umsichtig wieder nach dem Stalle zurücktrabten, den sie erst vor ein paar Minuten verlassen hatten.
»Können So Hörn blasen?« fragte der Kondukteur, eine der Kutschenlaternen losmachend.
Nikolas bejahte.
»No, dann blasen S' amal in dös, wo dorten aufm Boden liegt. I will daweil dem Gekreisch drinnen a End mochen. Werden S' nöt bald stad sein, Sö da drinnen?«
Mit diesen Worten war es dem Manne gelungen, den nach oben gekehrten Kutschenschlag aufzureißen, und Nikolas weckte mit einer der außerordentlichsten Leistungen, die je von menschlichen Ohren auf einem Posthorn gehört wurden, das Echo auf weite Ferne hin. Die Töne taten auch ihre Wirkung, denn sie brachten nicht bloß die Passagiere, die sich nur allmählich von der betäubenden Wirkung ihres Falles erholten, auf die Beine, sondern riefen auch Beistand herbei; wenigstens sah man bereits Lichter immer näher kommen.
In der Tat galoppierte auch, noch ehe sich die Passagiere gehörig gesammelt hatten, ein Reiter heran, und bei einer sorgfältigen Untersuchung stellte sich heraus, daß die Dame im Innern ihre Laterne und der Herr seinen Kopf angestoßen hatte. Zwei Reisende auf dem vorderen Außensitz waren mit blauen Augen, einer mit blutiger Nase, der Postillion mit einer Beule an der Schläfe, Mr. Squeers mit einer Kontusion seines Gesäßes und die übrigen Reisenden, dank der Schneeschicht, auf die sie geschleudert worden, ohne alle Beschädigung davongekommen. Sobald man sich darüber Gewißheit verschafft, wollte die Dame in Ohnmacht fallen, aber man bedeutete ihr, daß man sie dann einem Herrn auf die Schulter laden und so nach dem nächsten Wirtshaus bringen würde, weshalb sie sich wohlweislich eines Besseren besann und mit der übrigen Gesellschaft auf ihren eigenen Beinen dahin zurückzugehen beschloß.
Als die Reisenden daselbst anlangten, fanden sie, daß es ein ziemlich einsames Haus war, das hinsichtlich der Räumlichkeiten keine sonderlichen Bequemlichkeiten gewährte. Als man jedoch ein großes Reisigbündel und eine hübsche Portion Kohlen zu einem Kaminfeuer aufgehäuft hatte, gewann das Ganze bald ein besseres Ansehen, und ehe man noch alle vertilgbaren Spuren des kürzlichen Unfalls wegwaschen konnte, war das Zimmer warm und hell. Eigentlich kein übler Tausch für die Nacht und Kälte im Freien.
»Nun, Mr. Nickleby«, sagte Squeers, der sich die wärmste Ecke ausgesucht hatte, »es war recht, daß Sie die Pferde gehalten haben. Ich hätte es auch so gemacht, wenn ich rechtzeitig dazu gekommen wäre. Es freut mich, daß Sie es getan haben. Es war gut so. Sehr gut.«
»So gut«, mischte sich der Herr mit dem freundlichen Gesicht, dem der Gönnerton, den Squeers Nickleby gegenüber anschlug, nicht sonderlich zu gefallen schien, »daß Ihnen wahrscheinlich kein Gehirn im Kopf geblieben wäre, mit dem Sie weiter hätten Unterricht erteilen können, wenn die Pferde nicht gerade im letzten Augenblick noch festgehalten worden wären.«
Diese Bemerkung entfesselte eine reichlich mit Komplimenten und Danksagungen gewürzte allgemeine Erörterung über die Gewandtheit, die Nikolas im kritischen Moment an den Tag gelegt hatte.
»Ich bin natürlich sehr froh, so davongekommen zu sein«, bemerkte Squeers, »denn jedermann freut sich, eine Gefahr glücklich überstanden zu haben. Wenn z. B. einer meiner Pflegebefohlenen Schaden genommen hätte und ich verhindert worden wäre, einen dieser kleinen Knaben seinen Eltern wieder gesund zurückzugeben, was hätten da meine Gefühle sein müssen? Es würde mir weit lieber gewesen sein, wenn mir selbst ein Rad über den Kopf gegangen wäre.«
»Sind es lauter Brüder, Sir?« fragte die Dame mit der Reise- und Grubenlampe.
»In gewissem Sinne sind sie es, Madam«, antwortete Squeers und suchte in seinen Überrocktaschen nach Karten herum. »Sie stehen alle unter der gleichen, liebevollen und väterlichen Hand. Mrs. Squeers und ich, wir beide sind jedem von ihnen Vater und Mutter. – Mr. Nickleby, geben Sie der Dame und den übrigen Herrschaften diese Karten. Vielleicht kennen sie einige Eltern, die sich gern meines Institutes bedienen würden.«
Mit diesen Worten legte Mr. Squeers, der keine Gelegenheit versäumte, seine Geschäftsanzeige unentgeltlich unter die Leute zu bringen, die Hände auf die Knie und blickte mit soviel Wohlwollen, als er aufzubringen vermochte, auf seine Zöglinge, während Nikolas schamrot dem Auftrag nachkam und die Karten verteilte.
»Ich hoffe, daß Sie bei dem Unfall keinen Schaden genommen haben, Madam?« wendete sich der freundliche Herr hastig an die zimperliche Dame, als sei sein sehnlichster Wunsch, von dem Thema loszukommen.
»Körperlich nicht«, versetzte die Dame.
»Wie! Ich will doch nicht hoffen; daß Sie geistig –«
»Der Gegenstand ist mir äußerst peinlich, Sir«, entgegnete die Dame in großer Aufregung, »und ich bitte Sie als einen Mann von Erziehung, das Thema fallenzulassen.«
»Du mein Himmel«, meinte der Herr mit dem freundlichen Gesicht lächelnd, »ich wollte doch bloß fragen.«
»Und ich hoffe, daß Sie weiter keine Fragen mehr an mich stellen werden«, sagte die Dame, »oder ich würde mich genötigt sehen, den Beistand der übrigen Herren anzurufen. Herr Wirt, ich bitte, lassen Sie einen Knaben vor der Türe achtgeben. Wenn eine grüne Equipage von Grantham her vorbeikommt, soll sie hier anhalten.«
Da der Kondukteur inzwischen nach Grantham geritten war, um eine andere Postkutsche zu holen, machte der Herr mit dem heitern Gesicht, als die Gesellschaft eine Weile schweigend um das Feuer gesessen hatte, den Vorschlag, eine Bowle Punsch zu trinken.
»Was meinen Sie dazu, Sir?« fragte er den Passagier, der sich im Innern der Kutsche den Kopf verletzt hatte und einen sehr vornehmen Eindruck machte.
Der Punsch wurde gebracht, und heitere Gespräche waren bald im Gang.
Auf den allgemeinen Vorschlag, es möge doch jemand, um die Unterhaltung zu erhöhen, irgendeine nette Geschichte erzählen, erklärte sich der Herr mit dem freundlichen Gesicht endlich lächelnd dazu bereit und begann ohne weitere Ziererei folgende Erzählung zum besten zu geben:
Der Freiherr von Saufaus
Der Freiherr von Saufaus auf Humpenburg in Deutschland war ein so liebenswürdiger junger Edelmann, wie man sich nur einen wünschen kann. Ich brauche wohl nicht zu sagen, daß er in einer Burg wohnte, denn das versteht sich von selber; auch brauche ich nicht zu bemerken, daß er in einer alten Burg lebte, denn welcher deutsche Baron hätte je in einer neuen gewohnt? Es hatte mit diesem ehrwürdigen Gebäude in vieler Beziehung so seine Bewandtnis, und es galt für auch weiter nicht besonders befremdlich oder geheimnisvoll, daß es, wenn der Wind blies, in den Schornsteinen rumorte und daß die Strahlen des Mondes durch gewisse kleine Öffnungen in den Mauern schienen und die weiten Hallen und Galerien teilweise hell erleuchteten, während die größere Hälfte der Gemächer in tiefem Schatten lag.
Es hieß, daß ein Vorfahre des Freiherrn, als es ihm an Geld gebrach, einen Wanderer, der ihn eines Nachts nach dem Weg gefragt, erdolcht habe, und man munkelte, die erwähnten sonderbaren Umstände seien eine Folge dieser Untat. Ich meinesteils kann mir das kaum denken, zumal der Ahnherr des Freiherrn ein sehr frommer Mann war und seine übereilte Tat dadurch sühnte, daß er aus dem Bauholz und den Steinen, die einem weniger wehrhaften Nachbarn gehörten, eine Kapelle errichtete und sich auf diese Weise eine Generalquittung für alle Forderungen, die der Himmel jemals an ihn stellen könnte, erwarb.
Auf wie viele Ahnen der Freiherr zurückblicken mochte, vermag ich leider nicht anzugeben; eines aber ist sicher, nämlich daß er deren mehr hatte als irgendein Adliger seiner Zeit, und ich wünschte nur, er hätte in unseren Tagen gelebt, dann würde er noch mehr gehabt haben. Es ist überhaupt ein Jammer für die großen Männer vergangener Zeiten, daß sie so früh geboren wurden, denn von einem Mann, der vor drei- oder vierhundert Jahren gelebt hat, kann man nicht erwarten, daß er so viele Vorfahren aufzuweisen hat wie einer in unseren Tagen. Der letzte Mensch, und wäre er auch nur ein Schuhflicker oder sonst ein armer Tropf, wird naturgemäß einen größeren Stammbaum haben als ein Mann von ältestem Adel in unsern Tagen; und das ist doch gewiß etwas, was von rechtswegen nicht sein sollte.
Also gut, der Freiherr von Saufaus auf Humpenburg war ein hübscher, dunkelhäutiger Mann mit schwarzem Haar und buschigem Schnurrbart, der in hellgrünem Wams und hohen Juchtenstiefeln, ein Horn über der Schulter, ähnlich dem der englischen Postkutschen-Kondukteure, auf die Jagd zu reiten pflegte. Wenn er in dieses Horn stieß, erschienen auf der Stelle vierundzwanzig Mannen von untergeordneterem Range in etwas gröberer grüner Tracht und etwas dicker besohlten Juchtenstiefeln und sprengten mit ihm, lange Spieße in den Händen, dahin, um Eber oder Bär zu hetzen; und wenn der Freiherr dem betreffenden Untier den Knickfang gegeben hatte, wichste er sich mit dem Fett seinen Schnurrbart.
Es war das ein lustiges Leben für den Freiherrn von Saufaus und ein noch lustigeres für seine Vasallen, die Nacht für Nacht Rheinwein tranken, bis sie unter den Tisch fielen, wo sie dann weiterzechten; und nie gab es wohl fröhlicher lärmende, scherzliebende Gesellen als Saufaus' lustige Schar.
Doch auch die Freuden an oder unter der Tafel fordern bisweilen eine kleine Abwechslung. Daher sah sich der Freiherr eines Tages nach etwas Anregenderem um, fing mit seinen Kumpanen Händel an und trat zum Zeitvertreib zwei oder drei von ihnen jedesmal nach dem Mittagessen mit Füßen. Aber auch das befriedigte ihn nicht viel länger als eine Woche; dann wich seine gute Laune, und er sah sich nach einer neuen Zerstreuung um.
Eines Abends nach der Jagd, auf der er wieder einen riesigen Bären zur Strecke gebracht hatte, saß er übelgelaunt an der Tafel und musterte mit mißvergnügten Blicken die rauchige Decke der Halle. Er stürzte einen Humpen Wein nach dem andern hinunter, aber je mehr er trank, desto finsterer sah er drein. Die Herren, die die bedenkliche Auszeichnung genossen, in seiner Nähe zu sitzen, suchten natürlich nach Möglichkeit, es ihm im Trinken und in mürrischen Mienen gleichzutun.
»Ich will's!« schrie der Freiherr plötzlich und schlug mit der Faust auf den Tisch. »Füllt eure Humpen auf das Wohl der Freifrau von Saufaus.«
Die vierundzwanzig Grünröcke erblaßten bis auf ihre Nasen, die unverändert rot glühten.
»Ich habe die Gesundheit der künftigen Freifrau ausgebracht«, wiederholte der Freiherr und blickte wild umher.
»Die Freifrau von Saufaus soll leben!« brüllten die grünen Mannen, und vierundzwanzig gewaltige Humpen, mit trefflichem altem Rheinwein gefüllt, ergossen ihren Inhalt durch vierundzwanzig Kehlen. Dann lautes Schnalzen von achtundvierzig Lippen und sehnsüchtiges neuerliches Blinzeln nach dem Faß.
»Die schöne Tochter des Freiherrn von Schwillenhausen!« rief Saufaus. »Wir wollen sie von ihrem Vater zur Ehe begehren, ehe noch die Sonne morgen in ihr Bett scheint. Und wenn er unsere Bewerbung zurückweist, so werden wir ihm die Nase abschneiden.« Die Tafelrunde ließ ein drohendes Murmeln hören, und jeder faßte mit schrecklicher Bedeutsamkeit zuerst nach seinem Schwertgriff und dann nach seiner Nasenspitze.
Es ist doch etwas Schönes um kindlichen Gehorsam. Hätte die Tochter des Freiherrn von Schwillenhausen erklärt, sie habe bereits ihr Herz verschenkt, oder sich ihrem Vater zu Füßen geworfen, um sie mit Tränen zu benetzen, oder wäre sie nur in Ohnmacht gefallen und dem alten Herrn mit Gefühlsausbrüchen zu Leibe gegangen, so hätte man eins gegen hundert wetten können, daß Burg Schwillenhausen flötengegangen und sein Herr aus dem Fenster geworfen worden wäre. Das Freifräulein verhielt sich jedoch, als am nächsten Morgen ein Bote das Gesuch des Freiherrn überbrachte, ganz gefaßt und zog sich sittsam in ihr Kämmerlein zurück und schaute von dort nach dem angekündigten Freier und seinem Gefolge aus. Sie hatte sich kaum überzeugt, daß der Reiter mit dem großen Schnurrbart der Freier sei, als sie sogleich zu ihrem Vater eilte und ihm ihre Bereitwilligkeit ausdrückte, sich für ihn und den Frieden des Hauses zum Opfer zu bringen; und der ehrwürdige alte Herr umarmte sein Kind und ließ Freudentränen aus seinen Augen rieseln.
Auf der Burg ging es an diesem Tage gar hoch her. Saufaus' vierundzwanzig grüne Mannen tauschten das Gelübde ewiger Freundschaft mit den zwölf Grünen derer von Schwillenhausen und schwuren dem alten Baron, nicht eher aufzuhören, von seinem Weine zu trinken, bis alles blau wäre; womit sie wahrscheinlich in erster Linie meinten: bis ihre Gesichter dieselbe Farbe erhalten hätten wie ihre Nasen. Als die Zeit des Aufbruchs herankam, schlugen alle einander auf die Schulter, und der glückliche Bräutigam ritt mit seinem Gefolge frohen Mutes nach Hause.
Sechs lange Wochen hatten die Bären und Eber Feiertag. Die Häuser derer von Saufaus und Schwillenhausen waren vereinigt, die Spieße rosteten und das Horn des Freiherrn wurde heiser, weil es gar nicht mehr geblasen wurde.
Das waren glückliche Tage für die vierundzwanzig. Aber ach, diese herrliche Zeit hatte bereits ihre Siebenmeilenstiefel angezogen und war im Schwinden begriffen.
»Mein Bester –« sagte die Freifrau.
»Meine Liebe?« sagte der Freiherr.
»Diese rohen, lärmenden Menschen –-«
»Welche?« fuhr der Freiherr auf.
Die Freifrau deutete aus dem Fenster, an dem sie mit ihrem Gemahl stand, in den Hof hinunter, wo die nichtsahnenden Grünröcke, den Fuß bereits im Steigbügel, um den Eber zu hetzen, noch einen guten Schluck zu sich nahmen.
»Mein Jagdgefolge?« fragte der Ritter.
»Entlasse sie, mein Gemahl!« flüsterte die Freifrau.
»Sie entlassen?« fragte der Freiherr erstaunt.
»Mir zuliebe, mein Gemahl!« schmeichelte die Dame.
»Dem Teufel zuliebe«, antwortete der Baron.
Die Freifrau aber stieß einen lauten Schrei aus und sank ohnmächtig zu den Füßen des Freiherrn nieder.
Was konnte der Freiherr tun? Er rief nach der Kammerfrau, eilte in den Hof hinunter, gab zweien der Grünröcke, die es am meisten gewöhnt waren, einen Tritt, verwünschte die übrigen der Reihe nach und hieß sie, sich zum Henker scheren.
Dies war der erste Sieg der Freifrau über ihren Gemahl, und ich brauche hier wohl weiter nichts mehr zu sagen, als daß er allmählich immer mehr und mehr bei strittigen Fragen den Kürzeren zog oder mit List aus dem Sattel irgendeines alten Steckenpferdes geworfen wurde.
Mit der Zeit wurde er ein wohlgenährter Achtundvierziger mit Herzverfettung und hielt weder Gelage noch Jagden ab oder sonst etwas, was ihm früher Freude gemacht. Er war zwar immer noch unbändig wie ein Löwe und starr wie Erz, aber fürchterlich unter dem Pantoffel.
Und das machte noch nicht einmal sein ganzes Mißgeschick aus. Ungefähr ein Jahr nach seiner Vermählung kam ein junges, lustiges Freiherrlein auf die Welt, dem zu Ehren ein großes Feuerwerk abgebrannt und eine Unmasse von Wein getrunken wurde. Im nächsten Jahr erschien ein kleines Freifräulein, das Jahr darauf wieder ein junger Freiherr, und so ging es abwechselnd weiter, bis der Herr Baron Vater einer kleinen Familie von zwölf Kindern war. Bei einem jedem solchen Jahresfeste war die alte Freifrau von Schwillenhausen immer wieder in tausend Ängsten um das Wohl ihres lieben Kindes, der Freifrau von Saufaus; und obwohl man nicht behaupten konnte, daß sie zur Förderung der Genesung ihrer Tochter wesentlich beitrug, so machte sie sich's doch jedenfalls zur Pflicht, auf dem Schlosse Humpenburg so bekümmert wie möglich zu tun und ihre Zeit zwischen spitzigen Bemerkungen über ihres Schwiegersohnes Haushalt und Klagen über das harte Schicksal ihres unglücklichen Kindes zu teilen. Wenn sich dann der Freiherr von Saufaus, dadurch ein wenig gekränkt, zu der Bemerkung aufraffte, seine Gattin sei zum mindesten nicht übler daran als die Frauen anderer Edelleute, so rief die Baronin von Schwillenhausen die ganze Welt zum Zeugen auf, daß niemand als sie Mitgefühl für die Leiden ihrer Tochter empfinde, worauf natürlich sämtliche Verwandten und Freunde bestätigten, daß sie jedenfalls weit mehr Tränen vergieße als ihr Schwiegersohn und daß es keinen hartherzigeren Menschen gäbe als den Freiherrn von Saufaus.
Der arme Ritter ertrug dies alles, so gut es ging. Und als es nicht mehr ging, verlor er Appetit und Heiterkeit und setzte sich düster und niedergeschlagen in eine Ecke. Aber noch Schlimmeres stand ihm bevor, und als es kam, steigerte sich seine Schwermut. Nach und nach geriet er in Schulden; in seinen Truhen, die die Familie Schwillenhausen für unerschöpflich gehalten hatte, ging es zur Neige, und als seine Gemahlin im Begriffe war, den Stammbaum des Hauses mit einem dreizehnten Reis zu schmücken, machte er die betrübende Entdeckung, daß es mit seinen Mitteln zu Ende sei.
»Ich sehe nicht«, sagte sich der Freiherr, »wie ich mir weiterhelfen könnte. Es wird wohl das beste sein, ich bringe mich um.«
Das war ein glorreicher Gedanke. Der Freiherr nahm ein altes Jagdmesser aus einem Wandschrank, wetzte es an seiner Stiefelsohle und fuhr sich damit nach der Kehle.
»Hm«, sagte er dann und hielt inne, »vielleicht ist es nicht scharf genug.«
Abermals wetzte er es und wiederholte seinen Versuch, aber diesmal störte ihn das Kindergeschrei, das aus dem Turmzimmer über dem seinen herabtönte.
»Wäre ich Junggeselle«, seufzte der Freiherr, »so hätte ich es wohl fünfzigmal ausführen können, ohne dabei unterbrochen worden zu sein. »Heda, man bringe mir einen Humpen Wein und die längste Pfeife in das kleine Zimmer hinter der Halle!«
Einer der Diener kam dem Befehl unterwürfig im Verlauf einer halben Stunde oder darüber nach, und als der Freiherr sich nach dem gewölbten Zimmer verfügte, dessen schwarzgetäfelte und polierte Wände von dem Feuer des im Kamin lodernden Holzstoßes widerstrahlten, standen Humpen und Pfeife bereit, und der Ort sah im ganzen recht behaglich aus.
»Laß die Lampe da!« befahl der Freiherr.
»Befehlen sonst noch etwas, gnädiger Herr?« fragte der Diener.
»Abfahren«, brummte der Freiherr, jagte den Diener hinaus und verschloß die Türe.
»Ich will noch meine letzte Pfeife rauchen«, seufzte er dann, »ehe ich der Welt Lebewohl sage.«
Mit diesen Worten legte der Freiherr von Saufaus sein Messer auf den Tisch, goß ein ziemliches Quantum Wein hinunter, warf sich in seinem Stuhl zurück, streckte seine Füße vor dem Feuer aus und blies mächtige Rauchwolken in die Luft.
Er machte sich dabei allerlei Gedanken über seine gegenwärtige Trübsal, über die entschwundenen Tage seines Junggesellenlebens und über die vierundzwanzig Grünröcke, die sich seitdem nach allen Himmelsrichtungen zerstreut hatten, ohne daß man weiter etwas von ihnen gehört hätte. Sein Geist war mit Bären und Wildschweinen beschäftigt, und er hatte eben das Glas angesetzt, um es bis auf den Grund zu leeren, als er plötzlich zu seinem grenzenlosen Erstaunen bemerkte, daß er nicht allein sei.
Er war auch wirklich nicht allein, denn ihm gegenüber am Kamin saß mit verschränkten Armen eine runzlige, greuliche Gestalt mit eingesunkenen blutunterlaufenen Augen und einem langgezogenen Leichengesicht, in das das verfilzte schwarze Haar wild herabhing. Der Mann trug eine Art Tunika von dunkler, ins Bläuliche spielender Farbe, die, wie der Freiherr zu seinem Erstaunen bemerkte, von oben bis unten mit Sarggriffen verziert und zusammengehalten war. Die Beine staken in Sargschildern, ähnlich den Schienen einer Rüstung, und über der linken Schulter trug die Erscheinung einen kurzen, dunklen Mantel, der aus den Überresten eines Sargtuches angefertigt zu sein schien. Das Phantom schenkte seinem Gegenüber nicht die geringste Aufmerksamkeit und blickte nur unablässig ins Feuer.
»Hallo!« rief der Freiherr und stampfte mit dem Fuße auf, um sich bemerkbar zu machen.
»Nun, was gibt's?« fragte die Erscheinung und drehte ihre Augen dem Ritter zu.
»Was es gibt?« fuhr der Freiherr auf, dem die hohle Stimme und die glanzlosen Augen keine Furcht einzujagen vermochten. »Diese Frage steht, dächte ich, eigentlich mir zu. Wie bist du hierhergekommen?«
»Durch die Türe.«
»Wer bist du?« forschte der Freiherr.
»Ein Mensch wie du.«
»Das glaube ich nicht.«
»Dann laß es bleiben«, höhnte die Gestalt.
»Auch recht«, brummte der Freiherr.
Das Phantom blickte den unerschrockenen Ritter eine Weile lang an und lenkte dann ein:
»Ich sehe wohl, daß man dir nichts weismachen kann. Ich bin kein Mensch.«
»Also, was bist du denn?«
»Ein Engel.«
»Du siehst mir gerade nicht wie ein solcher aus«, meinte der Freiherr verächtlich.
»Ich bin der Engel der Verzweiflung und des Selbstmordes«, sagte die Erscheinung. »Jetzt kennst du mich.«
Mit diesen Worten wandte sich das Gespenst zu dem Freiherrn, als habe es dringend mit ihm zu sprechen. Höchst auffallend war, daß es dabei den Mantel zurückschlug und einen Pfahl sehen ließ, der ihm mitten durch den Leib getrieben war. Mit einem Ruck zog es ihn heraus und legte ihn so kaltblütig auf den Tisch, als ob er ein Spazierstock gewesen wäre.
»Nun«, sagte das Gespenst und schielte dabei nach dem Jagdmesser, »bist du bereit?«
»Noch nicht ganz«, antwortete der Freiherr. »Ich muß zuvor noch diese Pfeife ausrauchen.«
»Also mach schnell«, drängte das Gespenst.
»Du scheinst es ja sehr eilig zu haben«, meinte der Freiherr.
»Allerdings. In Frankreich und England geht augenblicklich das Geschäft so stark, daß meine Zeit sehr in Anspruch genommen ist.«
»Trinkst du?« fragte der Freiherr und berührte den Humpen mit der Pfeife.
»In neun Fällen unter zehn, aber dann tüchtig.«
»Niemals mit Maß?«
»Niemals«, erwiderte die Gestalt mit einem Schauder, »das würde doch Fröhlichkeit erzeugen.«
Der Freiherr betrachtete seinen seltsamen Gast abermals von Kopf bis zu Fuß und kam zu dem Schluß, daß es wirklich ein kurioser Kauz wäre. »Nimmst du denn an allen Fällen, wie dem meinigen, so tätigen Anteil?« fragte er endlich.
»N-nein«, sagte das Gespenst ausweichend, »aber ich bin immer zugegen.«
»Um zu sehen, ob alles in Ordnung ist? Was?«
»Ja«, gab das Phantom zu, mit dem Pfahle spielend, dessen Eisenbeschlag es sorgfältig untersuchte. »Aber mach schnell jetzt. Ich wittere, daß ein junger Herr, der zuviel Geld und freie Zeit hat, gegenwärtig meiner dringend bedarf.«
»Was? Einer will sich umbringen, weil er zuviel Geld hat?« rief der Ritter, nicht wenig erheitert. »Ha, ha, ha, das ist eine kuriose Idee.« Es war seit langer Zeit, daß der Freiherr wieder einmal lachte.
»Ich rate dir«, verwies der Geist ernstlich gekränkt, »laß das in Zukunft.«
»Warum denn?«
»Weil es mir durch Mark und Bein geht. Seufze lieber. Das tut mir wohl.«
Der Freiherr seufzte unwillkürlich, und das Gespenst war sofort wieder heiter und reichte ihm mit ausgesuchter Höflichkeit das Jagdmesser hin.
»Hm. Kein übler Gedanke, sich den Hals durchzuschneiden, weil man zuviel Geld hat«, brummte der Freiherr und prüfte die Schneide des Messers.
»Nicht schlimmer, als wenn sich jemand umbringt, weil er wenig oder gar keins hat«, meinte das Phantom.
Sprach der Geist aus Unvorsichtigkeit so, oder hielt er den Entschluß des Freiherrn für so fest gefaßt, daß er nicht mehr umzustoßen sei? Ich weiß es nicht, aber jedenfalls hielt der Freiherr in seinem Vorhaben plötzlich inne, riß die Augen weit auf und sah ganz so aus wie jemand, dem mit einem Male ein Licht aufgeht.
»Eigentlich«, überlegte er, »ist nichts so schlimm, daß es sich nicht wiedergutmachen ließe.«
»Leere Truhen ausgenommen«, sagte das Gespenst.
»Na, die ließen sich schließlich vielleicht doch wieder füllen«, meinte der Freiherr.
»Keifende Weiber«, murrte der Geist unwirsch.
»Die könnte man zähmen«, entgegnete der Ritter.
»Dreizehn Kinder«, brüllte der Geist.
»Können unmöglich alle mißraten.«
Der Geist war augenscheinlich gräßlich wütend auf den Freiherrn, der auf einmal seine Ansichten so ganz und gar geändert hatte, aber er versuchte es, seinen Grimm unter einem Lächeln zu verbergen, und sagte, er würde sich dem Herrn Baron ungemein verpflichtet fühlen, wenn dieser mit seinen Scherzreden endlich aufhören wolle.
»Es ist mir nicht im geringsten eingefallen, zu scherzen«, versetzte der Freiherr.
»Nun, das freut mich«, sagte der Geist mit äußerst grämlicher Miene, »denn Scherz und gute Laune gehen mir furchtbar auf die Nerven. Also rasch, gib sie auf, diese traurige Welt!«
»Ich weiß wirklich nicht«, überlegte der Freiherr, mit dem Messer spielend; »sie ist allerdings sehr traurig, aber ich glaube nicht, daß die deine viel besser ist. Dein Aussehen wenigstens ist nicht besonders tröstlich. – Und welche Sicherheit habe ich schließlich, daß ich besser daran sein werde, wenn ich diese Welt verlasse?!« rief er und sprang auf. »Das habe ich wahrhaftig noch gar nicht bedacht.«
»Beeile dich!« drängte das Gespenst zähneknirschend.
»Hebe dich weg von mir!« rief der Freiherr. »Ich will nicht länger über meinem Unglück brüten. Vielmehr eine gute Miene dazu machen und es wieder mit der frischen Luft und der Bärenjagd versuchen. Hilft das nicht, so will ich ein Wörtchen mit meiner Gnädigen sprechen und die Schwillenhausens totschlagen.«
Mit diesen Worten warf sich der Ritter in seinem Stuhl zurück und lachte so laut, daß das Zimmer dröhnte.
Das Gespenst wich ein paar Schritte zurück und sah ihn mit einem Blick des größten Entsetzens an. Dann griff es wieder nach seinem Pfahl, stieß ihn sich mit aller Macht durch den Leib, heulte fürchterlich auf und verschwand.
Baron Saufaus sah das Phantom nie wieder. Da er wirklich entschlossen war zu handeln, brachte er die Freifrau und die von Schwillenhausen bald zur Vernunft und starb viele Jahre nachher als glücklicher, wenn auch nicht allzu reicher Mann, obschon ich in dieser Hinsicht keine bestimmte Auskunft zu geben vermag. Jedenfalls hinterließ er eine zahlreiche Familie, die unter seiner persönlichen Leitung zur Bären- und Eberjagd herangebildet worden war.
Mein Rat ist nun der, daß alle Männer, die aus ähnlichen Ursachen kopfhängerisch geworden sind, beide Seiten der Medaille betrachten mögen und die bessere an ein Vergrößerungsglas halten sollten. Fühlen sie sich dann noch versucht, ohne Sang und Klang aus der Welt zu scheiden, so sollten sie jedenfalls vorher noch eine lange Pfeife rauchen, eine Flasche Wein leeren und aus dem lobenswerten Beispiel des Freiherrn von Saufaus– –«
»Der Wagen steht bereit, meine Herrschaften!« rief der Postillion in das Zimmer. »Einsteigen! Einsteigen!«
Die Punschgläser wurden in aller Eile geleert und die Reise wieder fortgesetzt. Nikolas schlief gegen Morgen ein, und als er wieder erwachte, fand er zu seinem großen Leidwesen, daß während seines Schlummers beide, der Baron von Saufaus und der grauhaarige Herr, ausgestiegen und auf und davon waren.
Der Tag schleppte sich langsam genug hin, und abends, ungefähr gegen sechs Uhr, wurden Mr. Squeers, sein Hilfslehrer, die Knaben und das gesamte Gepäck vor dem neuen Gasthaus zum »Heiligen Georg« in Greta Bridge abgesetzt.