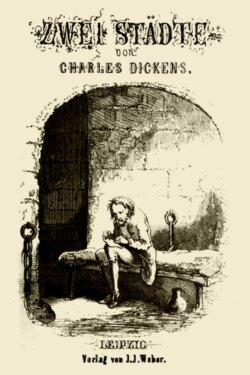Читать книгу Zwei Städte - Charles Dickens - Страница 10
Fünftes Kapitel.
Der Weinschank.
ОглавлениеEin großes Faß Wein war auf die Straße gefallen und geplatzt. Der Unfall war beim Abladen geschehen; das Faß war mit großer Raschheit heruntergerollt, die Reifen waren gesprungen und es lag auf dem Pflaster, unmittelbar vor der Thür des Weinschanks, zertrümmert wie eine zerknackte Nuß.
Alle Leute der Nachbarschaft hatten ihre Beschäftigung oder ihr Nichtsthun unterbrochen, um herbeizueilen und den Wein zu trinken. Das holprige, aus unregelmäßigen Steinen zusammengesetzte Pflaster der Straße, das mit seinen nach allen Seiten gerichteten Spitzen, wie man hätte meinen sollen, ausdrücklich bestimmt war, jedes lebendige Wesen, das ihnen zu nahe kam, lahm zu machen, hatte den Wein in kleine Pfützen vertheilt; und um diese standen, je nach der Größe, größere oder kleinere Gruppen. Einige Männer knieten nieder, schöpften mit beiden zusammengehaltenen Händen die Flüssigkeit auf, und schlürften oder versuchten es, Frauen, die sich über ihre Achseln vorbeugten, von dem Getränk mitzutheilen, ehe es ganz durch die Finger lief. Andere Männer und Weiber tauchten in die Pfützen halbzerbrochene Obertassen oder sogar Kopftücher der Weiber, die dann in dem Munde von Säuglingen trocken ausgequetscht wurden; andere legten kleine Dämme von Straßenschlamm an, um den Wein aufzuhalten; andere, von aus hohen Fenstern Zuschauenden benachrichtigt, schossen hierhin und dorthin, um kleinen Nebenströmen, die sich neue Richtungen eröffneten, den Weg abzuschneiden; noch andere widmeten sich den von Wein gesättigten und von Weinhefen gefärbten Dauben des Fasses und leckten oder zerkauten selbst die am meisten durchfeuchteten Bruchstücke mit heißer Begierde. Ein Abzugscanal, um den Wein ablaufen zu lassen, war nicht vorhanden, aber dennoch ward er vollständig aufgeschlürft, freilich mit einer tüchtigen Portion Straßenkoth vermischt.
Gellendes Lachen und fröhliches Plaudern — Stimmen von Frauen, Männern und Kindern durch einander — durchschallte die Straße, so lange dieser Weinscherz dauerte. Es war wenig Rohheit in dem Spiele und viel gute Laune. Es war etwas besonders Gemüthliches darin, eine sichtliche Neigung bei einem Jeden, sich zu einem Andern zu gesellen, was vorzüglich bei den Glücklichern oder Leichtblütigern zu lustigen Umarmungen, Händeschütteln und selbst Reihentänzen von einem Dutzend auf einmal führte. Als der Wein aufgetrunken war und die Stellen, wo er am reichlichsten geflossen hatte, von Fingern mit einem Gittermuster durchzogen waren, hörten diese Demonstrationen ebenso plötzlich auf, als sie angefangen hatten. Der Holzmacher, der seine Säge in dem Brennholz, das er sägte, hatte stecken lassen, setzte sie wieder in Bewegung; die Frau, die auf einer Hausthürstufe den Topf mit heißer Asche hatte stehen lassen, mit dem sie versucht hatte, ihre abgezehrten Hände oder Füße oder die ihres Kindes zu erwärmen, kehrte zu ihm zurück; Männer mit nackten Armen, verwirrten Locken und leichenfarbigen Gesichtern, die aus Kellern an das Wintertageslicht getreten waren, suchten wieder ihre unterirdischen Wohnungen auf und ein Düster verbreitete sich über die Umgebung, das ihr natürlicher zu sein schien, als Sonnenschein.
Der Wein war Rothwein gewesen und hatte das Pflaster der engen Straße in der Vorstadt St. Antoine in Paris, wo er vergossen worden, gefärbt. Er hatte viele Hände und viele Gesichter und viele bloße Füße und viele Holzschuhe gefärbt. Die Hand des Holzmachers ließ rothe Zeichen auf den Scheiten, die er zersägte, zurück; und die Stirn der Frau, die ihr Kind säugte, war gefärbt von dem alten Fetzen, den sie sich wieder um den Kopf gewickelt hatte. Die gierig an den Dauben des Fasses genagt hatten, hatten einen tigerhaften Blutmund; und ein so beschmierter langer Lustigmacher, dessen Kopf mehr außerhalb eines langen schmutzigen Sackes von einer Nachtmütze saß, als darin, malte mit seinem in die schmutzigen Weinhefen getauchten Finger an eine Wand — Blut.
Die Zeit war im Anzuge, wo auch dieser Wein auf dem Pflaster verspritzt werden und die Flecken desselben manchen Stein röthen sollten.
Und jetzt, wo das Düster sich wieder über St. Antoine sammelte, welches ein rasch vorübergehender Sonnenschein von seinem heiligen Gesicht verjagt hatte, wurde die Finsterniß gar schwer und Kälte, Schmutz, Krankheit, Unwissenheit und Mangel waren die Kammerherren, die den hohen Heiligen bedienten — lauter Edelleute von großer Macht, vornehmlich aber der letztgenannte. Musterstücke von einem Volke, das sich ein schreckliches Mahlen und wieder Mahlen in der Mühle hatte gefallen lassen, aber gewiß nicht in der märchenhaften Mühle, welche Alte wieder zu Jungen macht, standen vor Frost schüttelnd an jeder Ecke, gingen in jedem Thorweg aus und ein, sahen aus jedem Fenster heraus, flatterten in jedem Lumpenkleid, das der Wind in Bewegung setzte. Die Mühle, welche sie zu Schanden gemahlen hatte, war die Mühle, welche junge Leute alt mahlt; die Kinder hatten alte Gesichter und ernste Stimmen; und auf den Gesichtern der Erwachsenen und tief eingeprägt in jeder Falte des Alters war das Wort Hunger zu lesen. Es herrschte überall vor. Hunger ragte aus den hohen Häusern hervor in den jämmerlichen Kleidungsstücken, die auf Stangen und Stricken hingen; Hunger war in die Häuser selbst mit Stroh und Lumpen und Holz und Papier geflickt; Hunger wiederholte jedes Stückchen des Bettelrestes Brennholz, welches der Holzmacher zersägte. Hunger stierte hernieder von den rauchlosen Schornsteinen und sprang empor von der schmutzigen Straße, unter deren Kehricht sich kein Abfall von etwas Eßbarem befand. Hunger war die Firma des Bäckerladens, niedergeschrieben von jedem kleinen Laib seines kärglichen Vorraths von schlechtem Brod und in dem Wurstladen von jeder Zubereitung von Hundefleisch, das zum Verkauf angeboten ward. Der Hunger klapperte mit seinen dürren Knochen unter den Kastanien, die in dem Blechcylinder geröstet wurden; Hunger wurde in kleine Theilchen in jeden Dreierteller Suppe, in winzigen Kartoffelstückchen, geröstet von ein Paar widerwilligen Tropfen Oel, hinein geschnitten.
Seine Heimath war in allen Dingen für ihn geeignet. Eine enge, krumme Straße, voll ekelhaften Schmutz und Gestank, von der andere enge krumme Straßen ausliefen, alle bevölkert von Lumpen und Nachtmützen, und alle nach Lumpen und Nachtmützen riechend, und alle sichtbaren Dinge von einem unheimlich brütenden Aussehen, das Unheil ahnen ließ. In der abgehetzten Miene des Volkes lauerte noch ein Raubthiergedanke auf die Möglichkeit, sich gegen den Verfolger zu stellen. Obgleich die Leute gedrückt und gedemüthigt waren, fehlte es doch auch nicht an feurigen Augen unter ihnen; noch an zusammengepreßten Lippen, weiß von dem, was sie niederdrückten; oder an Stirnen, mit langen Runzeln, ähnlich den Galgenstricken, von denen sie träumten, als Dulder oder als Rächer. Die Schilder (und es gab deren fast so viele, als Läden waren) lauter schauerliche Bilder der Noth. Der Fleischer malte nur die magersten Knochenenden; der Bäcker die gröbsten, allerwinzigsten Brode. Die rohgemalten Zecher in den Weinläden raisonnirten über ihr knappes Maaß dünnen Weins oder Biers, und flüsterten unheimlich vertraulich mit einander. Nichts war in gutem und blühendem Zustande dargestellt, als Werkzeuge und Waffen; die Messer und Beile des Messerschmieds waren scharf und funkelnd, die Hämmer des Schmieds waren schwer und die Vorräthe des Büchsenmachers mörderisch. Die lahmmachenden Steine des Pflasters mit ihren vielen kleinen Pfützen von Schlamm und Wasser duldeten keine Bürgersteige, sondern gingen bis unmittelbar an die Hausthüren. Um das wieder gut zu machen, lief die Gosse die Mitte der Straße herab, wenn sie überhaupt lief, was aber nur nach schwerem Regen geschah, und dann lief sie mit vielen launenhaften und unberechenbaren Stößen in die Häuser. Quer über die Straße hingen in weiten Zwischenräumen schwerfällige Laternen an einem Strick und einem Flaschenzuge; Nachts, wenn der Laternenwärter diese heruntergelassen und angezündet und wieder hinaufgewunden hatte, wackelte eine Reihe düster brennender Dochte in schwächlicher, Schwindel erregender Weise hoch oben, als ob sie auf dem Meere wären. Und sie waren auch wirklich auf dem Meere und das Schiff und seine Mannschaft war von einem schweren Sturme bedroht.
Denn die Zeit war im Anzuge, wo die abgezehrten Vogelscheuchen dieser Region dem Laternenmann in ihrem Nichtsthun und ihrem Hunger so lange zugesehen hatten, daß sie auf den Gedanken kamen, seine Methode zu verbessern und an diesen Stricken und Flaschenzügen Menschenkinder hinaufzuwinden, um ein grelles Licht auf die Finsterniß ihres Zustandes zu werfen. Aber gekommen war die Zeit noch nicht, und jeder Wind, der über Frankreich wehte, setzte vergebens die Lumpen der Vogelscheuchen in Bewegung, denn die Vögel, gar schön von Gesang und Gefieder, ließen sich nicht warnen.
Der Weinschank lag an einer Ecke und war seinem äußeren Ansehen und seinen Gästen nach besser als die meisten andern, und der Herr des Weinschanks stand in gelber Weste und grünen Beinkleidern vor seiner Thür und sah dem Kämpfen um den verschütteten Wein zu. „S’ist nicht meine Sache,“ sagte er zuletzt mit einem Achselzucken. „Die Leute vom Markt haben’s verschüttet. Sie mögen ein anderes Faß bringen.“
Jetzt fielen seine Augen zufällig auf den langen Lustigmacher, der seinen Spaß an die Wand schrieb und er rief ihm über die Straße zu: „Heda, Gaspard, was machst Du da?“
Der Bursche wies mit prahlerischer Bedeutsamkeit, wie es Leute seines Gelichters oft machen, auf seinen Witz. Aber er verfehlte sein Ziel und machte gar keinen Eindruck, wie es ebenfalls oft Leuten seines Gelichters geht.
„Was soll das heißen? Bist Du ein Candidat für’s Irrenhaus?“ sagte der Weinwirth, indem er auf die andere Seite der Straße ging und den Witz mit einer Hand voll Straßenschlamm, nach dem er sich zu diesem Zwecke gebückt, auslöschte und überstrich. „Warum schreibst Du auf offener Straße? Giebt es keinen andern Ort, um solche Worte zu schreiben, he?“
Während er so sprach, ließ er seine andere, reine Hand (vielleicht zufällig, vielleicht nicht) auf das Herz des Spaßmachers fallen. Der Spaßmacher schlug mit seiner Hand darauf, machte einen hurtigen Luftsprung und kam wieder auf die Beine in einer phantastischen Tänzerstellung, den einen seiner Schuhe, den er beim Springen vom Fuße geschleudert, in der Hand und vor sich ausgestreckt haltend. Unter diesen Umständen nahm er sich wie ein Spaßmacher von äußerst, um nicht zu sagen grausam, praktischem Charakter aus.
„Ziehe ihn wieder an, ziehe ihn wieder an,“ sagte der Andere. „Nenne Wein, Wein und mache der Sache ein Ende.“ Mit diesem Rath wischte er sich seine schmutzige Hand auf dem Aermel des Spaßmachers ab — ganz überlegt, da er sich die Hand seinetwegen beschmutzt hatte; und ging dann wieder über die Straße und trat in die Weinschenke.
Dieser Weinwirth war ein kriegerisch aussehender Mann von dreißig Jahren mit einem Stiernacken, der heißes Blut haben mußte, denn obgleich es bitter kalt war, hatte er doch keinen Rock an, sondern hatte ihn über die Schulter geworfen. Auch die Hemdärmel hatte er aufgestreift und die braunen Arme waren bis an die Ellbogen bloß. Ebenso wenig trug er auf dem Kopfe etwas Anderes, als sein eigenes kurzgelocktes und kurzgeschnittenes, schwarzes Haar. Er war überhaupt ein schwarzer Mann mit guten Augen und einer guten offenen Breite zwischen ihnen. Im Ganzen von gutmüthigem, aber auch unerbittlichem Aussehen; offenbar ein Mann von starkem Entschluß und festem Willen; ein Mann, dem man nicht begegnen möchte, wenn er durch einen engen Paß, mit einem Abgrund an jeder Seite, eilt, denn Nichts würde ihn zum Umkehren bewegen.
Madame Defarge, seine Frau, saß im Laden hinter dem Ladentisch, als er eintrat. Madame Defarge war eine wohlbeleibte Frau von ungefähr demselben Alter wie er, mit einem aufmerksamen Auge, das selten etwas Bestimmtes anzusehen schien, einer großen, mit vielen Ringen geschmückten Hand, einem gefaßten Gesicht, starken Zügen und großer Ruhe im Benehmen. Aus dem Aussehen der Madame Defarge war man geneigt zu prophezeien, daß sie sich sehr selten in den Rechnungen, die sie zu besorgen hatte, zu ihrem Schaden irrte. Da Madame Defarge empfindlich gegen Kälte war, war sie in Pelz eingewickelt und hatte einen großen bunten Shawl um den Kopf gewunden, der aber immer noch ihre großen Ohrringe sehen ließ. Ihr Strickzeug lag vor ihr, aber sie hatte es weggelegt, um sich mit einem Zahnstocher die Zähne zu stochern. So beschäftigt und den rechten Ellbogen in die linke Hand gestützt, sagte Madame Defarge Nichts, als ihr Eheherr eintrat, sondern ließ nur ein kaum hörbares Husten vernehmen. Dies und das kaum eine Linie breite Emporziehen ihrer scharfgezeichneten schwarzen Augenbrauen sagten ihrem Manne, daß er gut thun würde, sich im Laden unter den Gästen nach etwaigen neuen Gästen umzusehen, welche gekommen waren, während er draußen auf der Straße gestanden hatte.
Der Weinwirth ließ demgemäß seine Blicke umherschweifen, bis sie auf einem ältlichen Herrn und einer jungen Dame haften blieben, die in einer Ecke saßen. Auch noch andere Gesellschaft war da: zwei Kartenspieler, zwei Dominospieler, drei, die am Ladentisch standen und einen kleinen Rest Wein zögernd austranken. Als er hinter den Ladentisch trat, bemerkte er, daß der ältliche Herr mit einem Blick zu der jungen Dame sagte. „Das ist unser Mann.“
„Was zum Teufel wollt ihr in dieser Galeere!“ sagte Monsieur Defarge zu sich; „ich kenne euch nicht.“
Aber er stellte sich, als ob er die beiden Fremden nicht beachtete und ließ sich mit den drei Gästen, die am Ladentisch tranken, in ein Gespräch ein.
„Wie geht es, Jacques?“ sagte einer von den Dreien zu Monsieur Defarge. „Ist der verschüttete Wein alle aufgetrunken?“
„Bis auf den letzten Tropfen, Jacques“, antwortete Monsieur Defarge. Als die Beiden mit diesem Austausch der Taufnamen fertig waren, ließ Madame Defarge, die sich immer in den Zähnen stocherte, ein anderes kaum hörbares Husten vernehmen und zog ihre Augenbrauen um eine andere Linienbreite in die Höhe.
„Nur selten,“ sagte der Zweite von den Dreien zu Monsieur Defarge, „haben diese elenden Lastthiere Gelegenheit, den Geschmack von Wein, oder von etwas Anderem als schwarzem Brod und Tod kennen zu lernen. Nicht wahr, Jacques?“
„Freilich, Jacques,“ entgegnete Monsieur Defarge.
Bei diesem zweiten Austausch des Taufnamens ließ Madame Defarge, immer noch mit ruhigster Fassung ihren Zahnstocher gebrauchend, wieder einen kaum hörbaren Husten vernehmen und zog ihre Augenbrauen noch um eine Linie empor.
Der Letzte von den Dreien kam jetzt an die Reihe, zu sprechen, wie er das leere Glas hinsetzte und mit den Lippen schmatzte.
„Ach, um so schlimmer! Ewig haben diese armseligen Lastthiere einen bittern Geschmack im Maule und ein beschwerliches Leben müssen sie führen. Nicht wahr, Jacques?“
„Freilich, Jacques“, war die Antwort Monsieur Defarge’s.
Dieser dritte Austausch des Taufnamens war eben vollzogen, als Madame Defarge den Zahnstocher weglegte, die Augenbrauen noch weiter in die Höhe zog und sich kaum merklich auf ihrem Stuhl bewegte.
„Ja so! Richtig!“ brummte der Mann vor sich hin. „Meine Herren — meine Frau —“
Die drei Gäste zogen vor Madame Defarge die Hüte ab und machten einen Kratzfuß. Sie nahm die Huldigung durch ein Neigen des Kopfes an und warf einen raschen Blick auf sie. Dann sah sie sich wie zufällig einmal im Laden um und nahm mit großer Ruhe und Fassung ihr Strickzeug her und vertiefte sich ganz in dasselbe.
„Guten Tag, meine Herren!“ sagte ihr Mann, der sie mit seinem hellen Auge aufmerksam beobachtet hatte. „Das möblirte Zimmer für ledige Herren, das Sie zu sehen wünschten und nach dem Sie sich erkundigten, als ich hinausging, ist im fünften Stock. Der Thorweg zur Treppe ist in dem kleinen Hofe, dicht nebenan, links — er wies mit seiner Hand nach dieser Richtung — gleich bei dem Fenster meines Ladens. Aber ich besinne mich jetzt, Einer von Ihnen ist schon dort gewesen und kann den anderen Herren den Weg zeigen. Leben Sie wohl, meine Herren!“
Sie bezahlten ihren Wein und verließen den Laden. Die Augen Monsieur Defarge’s beobachteten seine Frau beim Stricken, als der ältliche Herr aus seiner Ecke hervorkam und ihn um ein paar Worte bat.
„Sehr gern“, sagte Monsieur Defarge und trat ohne Weiteres mit ihm an die Thür.
Ihre Unterredung war sehr kurz, aber sehr entschieden. Fast bei dem ersten Worte fuhr Monsieur Defarge auf und zeigte die tiefste Aufmerksamkeit. Es hatte noch keine Minute gedauert, so nickte er und ging hinaus. Der Herr winkte dann der jungen Dame und auch sie ging hinaus. Madame Defarge strickte mit hurtigen Fingern und unbeweglichen Augenbrauen und sah Nichts.
Als Mr. Jarvis Lorry und Miß Manette in dieser Weise die Weinschenke verlassen hatten, gesellten sie sich Monsieur Defarge in dem Thorweg bei, nach welchem er soeben erst die anderen Gäste gewiesen hatte. Es war der Ausgang eines stinkenden, kleinen, finstern Hofes und der allgemeine Zugang zu einer großen Häusermasse, in der eine Unzahl Leute wohnte. In dem dämmerdunkeln, mit Ziegeln gepflasterten Eingang zu der dämmerdunkeln, mit Ziegeln gepflasterten Treppe ließ sich Monsieur Defarge auf ein Knie vor dem Kinde seines alten Herrn nieder und drückte ihre Hand an seine Lippen. Es war ein sanftes Beginnen, aber durchaus nicht sanft gethan; binnen wenigen Secunden war eine sehr merkwürdige Umwandlung mit ihm vorgegangen. Es war keine Gutmüthigkeit oder Offenheit mehr in seinem Gesicht zu sehen, sondern er war ein heimlicher, zorniger, gefährlicher Mann geworden.
„Es ist sehr hoch und schwer zu steigen. Besser, wir fangen langsam an,“ so sprach Monsieur Defarge in hartem Tone zu Mr. Lorry, wie sie anfingen, die Treppe zu ersteigen.
„Ist er allein?“ flüsterte Letzterer.
„Allein! Gott helfe ihm, wer sollte bei ihm sein?“ entgegnete der Andere in demselben gedämpften Tone.
„Er ist also immer allein?“
„Ja.“
„Nach eigenem Wunsch?“
„Aus eigener Nothwendigkeit. Wie er damals war, als ich ihn zuerst sah, nachdem sie mich aufgefunden und gefragt hatten, ob ich ihn zu mir nehmen und auf meine Gefahr verschwiegen sein wollte — so ist er jetzt noch.“
„Hat er sich sehr verändert?“
„Verändert!“
Der Weinwirth blieb stehen, um mit der Hand an die Mauer zu schlagen und einen fürchterlichen Fluch auszusprechen. Eine directe Antwort hätte nicht denselben Eindruck gemacht. Mr. Lorry’s Gemüth fühlte sich immer gedrückter, wie er und seine beiden Gefährten höher und höher stiegen.
Eine solche Treppe mit ihren Beigaben in dem ältern und stärker bevölkerten Theile von Paris wäre jetzt schlimm genug; aber damals war sie für ungewohnte und nicht abgehärtete Sinne geradezu abscheulich. Jede kleine Wohnung in diesem großen schmutzstrotzenden Haufen von einer hohen Gebäudemasse — das will sagen, das Zimmer oder die Zimmer innerhalb jeder Thür, die sich auf die allgemeine Treppe öffnete — ließ ihrem eigenen Kehrichthaufen auf ihren eigenen Treppen Platz, außer daß sie noch andern Kehricht zum Fenster hinauswarfen. Die dadurch erzeugte, gar nicht mehr zu beherrschende und hoffnungslose Fäulnißmasse hätte die Luft verpestet, selbst wenn Armuth und Entbehrung sie nicht mit ihren unfaßbaren Unreinigkeiten erfüllt hätten; diese beiden bösen Quellen im Verein machten sie fast unerträglich. Durch eine solche Atmosphäre, einen steilen, dunklen Schacht voll Schmutz und Gift hinauf, führte der Weg. Seiner eigenen und seiner jungen Gefährtin Aufregung nachgebend, die mit jedem Augenblicke größer wurde, machte Mr. Jarvis Lorry zweimal Halt, um zu rasten. Bei jedem dieser Ruhepunkte öffnete sich ein enges Fenstergitter, durch welches die wenigen guten Lüfte, die vielleicht noch unverdorben vorhanden waren, zu entweichen und alle verdorbenen und garstigen Dünste hereinzuschleichen schienen. Zwischen den verrosteten Stäben konnte man in einzelnen Streifen den Anblick der in wüster Unordnung übereinandergehäuften Gebäude erhaschen; und Nichts im Bereich des Auges, das näher oder tiefer war, als die Spitzen der beiden großen Thürme von Notredame, verrieth eine Spur von gesundem Leben oder gedeihlicher Zukunft.
Endlich war die letzte Stufe der Treppe erreicht und sie ruhten zum dritten Male aus. Noch eine Treppe, die noch steiler und schmäler war, mußte erstiegen werden, ehe sie das Dachgeschoß erreichten. Der Weinwirth, der immer ein Wenig vorausging, und immer auf der Seite, wo sich Mr. Lorry befand, als ob er fürchtete, daß die junge Dame eine Frage an ihn richten möchte, drehte sich hier um, fühlte in den Taschen des Rockes herum, den er über die Achsel geworfen hatte, und brachte einen Schlüssel heraus.
„Die Thür ist also verschlossen, Freund?“ sagte Mr. Lorry überrascht.
„Jawohl“, war die bitterernste Antwort Monsieur Defarge’s.
„Sie halten es für nothwendig, den Unglücklichen so einsam zu lassen?“
„Ich halte es für nothwendig, ihn einzuschließen.“ Monsieur Defarge flüsterte es ihm, sich dichter an ihn andrängend, ins Ohr und zog finster drohend die Stirne zusammen.
„Warum?“
„Warum! Weil er so lange eingeschlossen gelebt hat, daß er sich fürchten — wüthen — sich in Stücke zerreißen — sterben — ich weiß nicht, zu welchem Schaden kommen würde — wenn man seine Thür aufließe.“
„Ist es möglich?“ rief Mr. Lorry aus.
„Ist es möglich?“ wiederholte Defarge mit Bitterkeit. „Ja, und in einer schönen Welt leben wir, wenn es möglich ist und wenn viele andere solche Dinge nicht nur möglich sind, sondern auch geschehen — wirklich geschehen! — Unter diesem Himmel, und zwar jeden Tag. Lange lebe der Teufel! Vorwärts!“
Dieses Zwiegespräch war in so leisem Flüstern gehalten worden, daß kein Wort davon das Ohr der jungen Dame erreicht hatte. Aber sie zitterte jetzt von so starker Aufregung, und auf ihrem Gesicht drückte sich so tiefe Seelenangst aus und vor Allem solches Grauen und Entsetzen, daß Mr. Lorry sich verpflichtet fühlte, ihr mit ein paar Worten Beruhigung zuzusprechen.
„Muth, liebe Miß! Muth! Geschäft! Das Schlimmste wird in einem Augenblick vorbei sein. Wir brauchen blos die Zimmerthür hinter uns zu haben und das Schlimmste ist vorbei. Dann fängt alles Gute, aller Trost, alles Glück an, das Sie ihm bringen. Unser guter Freund hier wird Sie auf der andern Seite unterstützen. So ist’s recht, Freund Defarge. Nun vorwärts. Geschäft! Geschäft!“
Sie stiegen langsam und vorsichtig hinauf. Die Treppe war kurz und sie waren bald auf der letzten Stufe. Weil sie sich dort kurz wendete, standen sie auf einmal vor drei Männern, deren Köpfe dicht nebeneinander an eine Thür herabgebeugt waren und die durch ein paar Spalten oder Löcher in der Wand mit gespannter Aufmerksamkeit in das Zimmer blickten, zu welchem die Thür gehörte. Als sie dicht hinter sich Fußtritte vernahmen, drehten sich die Drei um, richteten sich auf und ließen sich als die drei Gäste Eines Namens erkennen, die unten im Weinschank getrunken hatten.
„Ueber der Ueberraschung Ihres Besuches habe ich sie ganz vergessen“, erklärte Monsieur Defarge. „Geht jetzt, Ihr guten Freunde, wir haben Geschäfte hier.“
Die Drei glitten an ihnen vorüber und gingen still hinunter.
Da keine andere Thür auf diesem Flur zu erblicken war und der Besitzer der Weinschenke gerade auf diese eine zuging, als sie wieder allein waren, fragte ihn Mr. Lorry halblaut mit einiger Schärfe:
„Lassen Sie Monsieur Manette wie eine Merkwürdigkeit sehen?“
„Ich zeige ihn in der Weise, wie Sie gesehen haben, einigen wenigen Auserwählten.“
„Ist das gut?“
„Ich glaube, es ist gut.“
„Wer sind die Wenigen? Wie wählen Sie sie aus?“
„Ich wähle sie als echte Männer meines Namens — Jacques ist mein Name —, denen das Schauspiel wahrscheinlich nützlich sein wird. Genug; Sie sind Engländer; das ist etwas Anderes. Warten Sie gefälligst hier einen Augenblick.“
Mit einer sie zum Zurückbleiben mahnenden Geberde bückte er sich und guckte durch einen Spalt in der Mauer. Bald richtete er sich wieder auf und schlug zwei- oder dreimal an die Thür — offenbar zu keinem andern Zweck, als ein Geräusch zu machen. In derselben Absicht strich er drei- oder viermal mit dem Schlüssel darüber, ehe er ihn mit derber Hand in das Schloß stieß und so geräuschvoll als möglich umdrehte.
Die Thür ging langsam nach innen auf, er blickte in das Zimmer hinein und sagte Etwas. Eine schwache Stimme gab eine Antwort zurück. Wenig mehr als eine einzige Silbe konnte von beiden Seiten gesprochen worden sein.
Er blickte über die Achsel zurück und winkte den beiden Anderen, einzutreten. Mr. Lorry umschlang die Tochter fest mit seinen Armen und hielt sie; denn er fühlte, daß sie zusammensinken werde.
„Eh — Eh — Eh — Geschäft — Geschäft!“ sprach er ihr zu, mit einer Feuchtigkeit auf den Wangen, die durchaus nicht geschäftsmäßig war. „Treten Sie ein, treten Sie ein!“
„Ich fürchte mich“, antwortete sie zusammenschauernd.
„Wovor? Vor wem?“
„Ich meine vor ihm. Vor meinem Vater.“
Durch ihren Zustand und durch die Mahnungen seines Führers gewissermaßen zur Verzweiflung gebracht, legte er den Arm, der auf seiner Schulter zitterte, sich um den Hals, hob sie empor und trug sie in das Zimmer. Er setzte sie gleich innerhalb der Thür wieder hin und unterstützte sie, während sie sich an ihn anklammerte.
Defarge zog den Schlüssel aus dem Schlosse, machte die Thür zu, verschloß sie inwendig, zog den Schlüssel wieder heraus und behielt ihn in der Hand. Alles dies that er methodisch und mit so lautem und klirrendem Lärm, als ihm hervorzubringen nur möglich war. Zuletzt ging er mit schwerem Tritt quer über die Stube nach dem Fenster hin. Dort blieb er stehen und drehte sich um.
Die Dachkammer, zu einer trockenen Niederlage für Brennholz und Aehnliches bestimmt, war eng und dunkel. Denn das Fenster, ein Giebelfenster, war eigentlich eine Thür im Dache mit einem Krahnbalken darüber, um das Holz von der Straße heraufzuwinden, ohne Glasscheiben und in der Mitte mit zwei Flügeln schließend, wie andere Thüren nach französischer Einrichtung. Um die kalte Luft hinauszusperren, war der eine Flügel dieser Thür fest zugeschlossen und der andere stand nur ein ganz klein Wenig auf. Ein so dürftiges Licht ward auf diese Weise hereingelassen, daß es beim ersten Hereintreten schwierig war, überhaupt Etwas zu sehen, und nur lange Gewohnheit konnte langsam in einem Menschen die Fähigkeit ausbilden, in solcher Dunkelheit eine die Augen in Anspruch nehmende Arbeit zu verrichten. Und doch wurde Arbeit dieser Art in der Dachkammer verrichtet; denn mit dem Rücken gegen die Thür und mit dem Gesicht nach dem Fenster, von wo der Besitzer des Weinschankes ihm zusah, saß ein Mann mit weißem Haar auf einer niedrigen Bank, über einen Schuh gebückt, an dem er fleißig nähte.