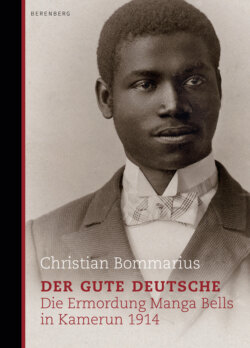Читать книгу Der gute Deutsche - Christian Bommarius - Страница 8
II.
ОглавлениеKAMERUN IST EINE KOKOSNUSS. Wer die Frucht genießen will, muss die Schale sprengen. Und das geht nun einmal nur mit Gewalt. Zumal die Duala kein Entgegenkommen zeigen und ihr Handelsmonopol hartnäckig verteidigen. Sie kaufen europäische Produkte in den Faktoreien von Woermann, Jantzen & Thormählen oder der englischen Händler auf Kredit und bezahlen mit Kautschuk, Palmöl oder Elfenbein, das sie von anderen Stämmen im Landesinnern beziehen, die häufig ihrerseits nur Zwischenhändler sind, ebenfalls für ihr Gebiet auf ihrem Monopol bestehen und den Durchzug von Handelskarawanen mit allen Mitteln verhindern. Weil die ins Inland führenden Flüsse für größere Schiffe unpassierbar sind und der Urwald, der gleich hinter dem Küstenstreifen beginnt, für Karawanen ohne kundige Führung undurchdringlich ist, haben die Agenten von Woermann und Jantzen & Thormählen ein Problem. Aber schon bald haben sie auch eine Idee. Sie erhöhen die Preise für die europäischen Waren und setzen die der Landesprodukte herab. Um das durchzusetzen, verabreden sie mit den englischen Händlern eine gemeinsame Handelssperre. Die Duala antworten mit einer Gegensperre und stellen den Verkauf von Lebensmitteln, Trinkwasser und Feuerholz ein. Eine Pattsituation, die zum Vorteil der Deutschen aufzulösen Julius von Soden, dem ersten deutschen Gouverneur in Kamerun, trickreich gelingt. Soden, von Kaiser Wilhelm I. persönlich im März 1885 zum Gouverneur ernannt, ist Jurist und ein erfahrener Diplomat, zuletzt war er in Sankt Petersburg im Einsatz. Sein Plan benachteiligt zwar die Duala, aber weil die deutschen Agenten – wie vom Gouverneur gewünscht – lauthals zum Schein protestieren, wähnen die Duala sich als Gewinner. Soden meldet nach Berlin: »Ohne diese Komödie wäre es mir nicht gelungen, die Eingeborenen zur Nachgiebigkeit zu bewegen.«
Die Duala versuchen, die niedrigen Preise an ihre Handelspartner im Landesinnern weiterzugeben, stoßen jedoch auf Widerstand. Als Häuptling Money in Bimbia den Deutschen zudem die Gefolgschaft verweigert, schickt der Gouverneur das Kanonenboot Cyclop. Bimbia wird niedergebrannt, Money abgesetzt und ein neuer Oberhäuptling ernannt, der den gouverneurtreuen King Bell als Oberherrn anerkennt. Den Abo und Wuri, die ebenfalls »fortgesetzte[n] offene[n] Ungehorsam« an den Tag legen, ergeht es nicht besser. Auf Befehl von Sodens Stellvertreter, Jesko von Puttkamer, beschießt das Kanonenboot ihr Dorf Banambasi eine Stunde lang, bevor es vom Landungskorps »in Brand gesteckt und vernichtet« wird; einen Tag später wird ein zweites Dorf niedergemacht. Das sind nicht nur erste Erfolge der deutschen Kolonialverwaltung und der deutsch-kamerunischen Handelsbeziehungen. Auch der deutsche Wortschatz profitiert. Der Euphemismus »Strafexpedition« – zutreffend wäre Feldzug oder Überfall – wird zu einem der bedeutsamsten Substantive der deutschen Kolonialpolitik.
Der Zwischenhandel aber ist damit noch nicht ausgeschaltet, noch reicht die Macht des Gouverneurs nicht weiter als ein Geschützrohr des Kanonenboots. Und nicht nur die deutschen Händler fordern unermüdlich, »den Zwischenhandel der Eingeborenen militärisch wegzumanövrieren«. Auch die Gesellschaft für deutsche Kolonisation (GfdK) propagiert eine expansive Kolonialpolitik. Mit ihrem Präsidenten Carl Peters, dem Gründer Deutsch-Ostafrikas, einem fanatischen Rassisten, hat sie einen angemessenen Repräsentanten. Seine Verbrechen – unter anderem lässt er seine schwarze Konkubine und seinen Diener, die ein Verhältnis miteinander hatten, aufhängen und ihre Heimatdörfer niederbrennen – werden ihm später in Afrika den Rufnamen mkono wa damu (»blutige Hand«) eintragen, in Deutschland wird er als »Hänge-Peters« berüchtigt. In Blättern wie der Kölner Zeitung finden die Forderungen den gewünschten Widerhall: Mit einer »kleinen Schutztruppe ließe sich der ganze Widerstand der Duala brechen, der die Entwicklung unserer wertvollsten Kolonie in Fesseln schlägt.« Der Vertrag mit den Duala, heißt es in einer Denkschrift aus dem Handelshaus Jantzen & Thormälen, sei ohne Bedeutung, und die Deutschen seien nicht nur berechtigt, sich darüber hinwegzusetzen, sondern sogar verpflichtet: »Unsere Stellung zu den Dualas muß eine völlig andere werden. […] Es widerstreitet also dem Grundgedanken der Schutzverträge nicht, wenn wir als Heilmittel der traurigen Lage der Dinge in Kamerun das gewaltsame Durchbrechen des Zwischenhandels der Dualas und ihre durch moralische und physische Machtmittel durchgeführte Erziehung zur Arbeit hinstellen. Der durchzuführende Plan würde etwa folgender sein: Man errichte eine Schutztruppe«. Die Truppe würde Stationen aufbauen, um die Handelswege freizuhalten. »Sobald diese Organisation in die Wege geleitet, wird sich dem Handel ein ganz ungeahnt großes neues Gebiet erschließen.« Mit anderen Worten: Die Handelswege sollen freigeschossen werden.
Noch ist Berlin dazu nicht bereit. Insbesondere der Reichstag zögert, Geld für die militärische Eroberung der Kolonie bereitzustellen. Und auch Gouverneur von Soden – er beschäftigt sich zeit seines Lebens mit Dante und Homer und fühlt sich von Immanuel Kant inspiriert – möchte vor dem Handelsnetz, das die deutschen Kaufleute in ihren hochfliegenden Plänen bereits über ganz Kamerun spannen, lieber zunächst ein Netz von Schulen über Küste und Urwald legen, Missions-, aber auch Regierungsschulen. Und so betritt nach ruhiger Fahrt an Bord der Ella Woermann im Januar 1887 Theodor Christaller, seit wenigen Tagen 24 Jahre alt, als erster deutscher Reichsschullehrer in Kamerun den Boden Dualas. Als Sohn eines Missionars der Basler Mission hatte Christaller selbst einige Jahre im Basler Stammhaus unterrichtet, bis er wenige Monate zuvor von einem Stuttgarter Prälaten gefragt wurde, ob er die Stelle in Kamerun im Dienst der Reichsregierung antreten wolle. Sein erster Gedanke war »Afrika – ein Todesland!«, kein abwegiger Gedanke, denn nicht nur ein Inspektor der Mission war erst vor kurzem an der afrikanischen Westküste an Malaria gestorben, auch Christallers Mutter war dort von der Krankheit hinweggerafft worden, sein Vater schwer krank nach Deutschland zurückgekehrt. Schließlich aber hatte der junge Mann eingewilligt, erfüllt – wie sein Schwager nach Christallers Tod in einer Lebensbeschreibung beteuerte – »von dem hohen Ziel, deutsche Bildung und Sitte, deutsche Sprache und Glauben in den dunklen Erdteil hinauszutragen, bereit, für dieses hohe Ziel Bequemlichkeit, Gesundheit, ja, wenn es sein soll, das Leben zu opfern.« Tatsächlich wird Christaller neun Jahre später an Schwarzwasserfieber sterben.
Doch jetzt, im Januar 1887, benötigt der junge Reichsschullehrer erst einmal eine Unterkunft. Und siehe da, in der Basler Mission ist soeben ein Zimmer frei geworden: Ein Missionar und Freund Christallers ist an Malaria gestorben. Im Übrigen aber ist nichts für den jungen Lehrer vorbereitet, kein dauerhaftes Quartier und erst recht keine Schule, und so unterrichtet Christaller anfangs in einer verfallenen Hütte aus Palmrippen und Matten. Unter seinen Schülern sind sieben Söhne King Bells (sieben von siebzig, wie Christaller vermutet) und mindestens ein Enkel: Manga Bell. Christaller, der während der Schiffsreise Duala gelernt hat, zögert nicht, die Kinder mit dem Kernbestand deutscher Kultur bekannt zu machen. Als ein deutscher Offizier eines Tages den Unterricht besucht, singen die Kinder »mit ungeheurer Begeisterung«, wie Christaller bemerkt, zuerst »Lobe den Herren, o meine Seele«. Danach fragt der Lehrer die muntere Schar: »Was wollt ihr singen?« Und wie aus einem Munde erwidern die jung-deutschen Duala: »Ich hatt’ einen Kameraden!« Der kleine Manga Bell singt sicherlich mit. Denn erstens zahlt sein Großvater Schulgeld – er wird auch das hölzerne Fertighaus bezahlen, das Christaller als Schulgebäude in Deutschland bestellt hat –, und zweitens empfiehlt es sich, den Lehrer nicht zu verärgern. Vor allem für enttäuschtes Vertrauen pflegt sich der Schulmeister nachhaltig zu revanchieren. Das bekommt der kleine Konrad zu spüren, den er als Hausjungen zu sich genommen hat. Als er ihn beim Diebstahl erwischt, schleppt Christaller ihn ins Gericht, wo Konrad zu fünfzehn Hieben mit der Nilpferdpeitsche verurteilt wird, danach persönlich ins Gefängnis, wo der Junge gefesselt und derart geprügelt wird, dass ihm »die Haut in Fetzen vom Leibe flog«. Aber er kann unmöglich mehr gelitten haben als sein Lehrer: »Ich hatte ihn so sehr geliebt, geliebt, wie ein deutsches Herz nur lieben kann, und nun ist’s aus.« An Kaisers Geburtstag holt Christaller den Jungen aus dem Gefängnis, nimmt ihn wieder bei sich auf und verspürt das gute Gefühl, verzeihen zu können und nach drei Wochen zum ersten Mal wieder »ausgezeichnet zu schlafen, weil Konrad neben mir auf dem Boden schlief, zwar noch blutig, aber doch neben mir«.
Zumindest anfangs zweifelt Christaller nicht am Motiv der kleinen »faulen Neger«, die deutsche Sprache zu lernen: »Die Leute zeigten sich begierig, etwas zu lernen, aber wie der Gouverneur mit Recht vermutete, nicht aus Wissensdurst, sondern nur, um andere nachher besser betrügen zu können.« August Manga Ndumbe Bell allerdings hat für seinen Sohn Manga Bell andere Pläne. Der Junge soll in wenigen Jahren nach Deutschland gehen und dort Rechtswissenschaften studieren. Wie wichtig es ist, im Umgang mit den Deutschen das Recht zu kennen, erläutert ihm sein Neffe Alfred Bell in ausführlichen Briefen. Ein Polier der Altonaer Firma Franz Schmidt, die die Fertigteile für das Regierungsgebäude und das Gefängnis in Duala lieferte, hatte Alfred auf Bitten King Bells 1886 mit drei anderen Duala zur Ausbildung mit nach Deutschland genommen. Dort ist Alfred anscheinend mit sozialdemokratischen Gedanken in Berührung gekommen, berichtet davon in den Briefen an seine Familie und zieht sich damit erst den Argwohn, dann den Unmut der Behörden – die seine Post offensichtlich kontrollieren – in Kamerun und Deutschland zu. Aus einem Schreiben des Kameruner Gouvernements an Reichskanzler Bismarck vom 1. Juli 1889: »Euerer Durchlaucht beehre ich mich auf den hohen Erlass vom 29. Mai dieses Jahres Nummer A-21, betreffend Deckung etwa für Alfred Bell infolge seiner jetzigen Unterbringung entstehender bzw. Deckung früher für ihn entstandener Kosten, ganz gehorsamst zu berichten, dass, soviel mir bekannt, der Herr Gouverneur Freiherr von Soden bisher häufig erhebliche Zahlungen für Alfred Bell aus eigener Tasche gemacht, dieselben aber eingestellt hat, als der Knabe Alfred anfing, ihm fürchterlich zu werden, indem er seinen Wohltäter in seinen an die Familie gerichteten Briefen in der Euerer Durchlaucht nunmehr auch bekannten Weise auf das Schamloseste zum Gegenstand seiner Schmähungen machte. Ob der Herr Gouverneur von Soden weiterhin dem Alfred Bell etwas zukommen lassen will bzw. ob andere Mittel eventuell zur Verfügung stehen könnten, darf ich ganz gehorsam bitten, dessen eigener Berichterstattung zu überlassen.«
Was aber hat Alfred seinem Wohltäter so »fürchterlich« werden lassen? Der junge Duala hat verglichen – die Gerichtsbarkeit, die die Deutschen für die Duala in Kamerun errichtet haben, mit der Justiz, wie sie im kaiserlichen Deutschland funktioniert. In diesem Augenblick hat er den Unterschied von Willkür und Recht erkannt und war zugleich für seinen Wohltäter zum Feind geworden, was ihn folgerichtig nur mehr mäßig interessiert: »Der Gouverneur kann mir nichts thun, weil mich niemand binden kann und nach K.[amerun] schicken, wenn er was von mir will, muß er einen Prozeß anfangen, er kann mich nicht in das Gefängnis thun, außer wenn ich den Prozeß verliere. Er kann einen in Kamerun ins Gefängnis thun wann er will, aber nicht in Deutschland.« Allerdings unterschätzt er die Neigung des in Deutschland geltenden Rechts, sich in Willkür zu verwandeln, wenn es einen aufmüpfigen Duala betrifft. Gegen seinen Willen reist Alfred 1890 mit der Woermann-Linie zurück nach Kamerun, wo er sich sogleich von der Richtigkeit seiner neu erworbenen Erkenntnisse überzeugen kann. Zwar wird Alfred nicht eingesperrt, sondern in deutsche Dienste genommen, um seine in Deutschland angehäuften Schulden zurückzuzahlen. Aber seinen Onkel August Manga Ndumbe Bell hat der Gouverneur wegen Alfreds »schlechten Einflusses« kurzerhand in das deutsche Schutzgebiet Togo verbannt.
Die Duala machen es aber den Deutschen auch wirklich nicht leicht. Begnügt man sich damit, ihnen ein wenig Deutsch beizubringen, gerade genug, um die Weisungen ihrer Herrschaften zu verstehen, klagen sie wie ein Schüler der Basler Missionsschule: »Um das Gebiet des Wissens, das uns die Weissen bringen, ziehen sie eine enge Grenze, denn sie wollen nicht, dass wir so viel wissen als sie.« Was den Duala also der Zwischenhandel, ist den Deutschen die Bildung – ein Monopol von unschätzbarem Wert. Und wie die Agenten der Hamburger Handelshäuser Woermann und Jantzen & Thormählen nicht genug bekommen können von Elfenbein und Kautschuk, und zwar möglichst viel möglichst günstig und möglichst auf direktem Weg, halten es die Duala mit der Bildung: Sie wollen – allerdings ohne Gewalt – davon möglichst viel möglichst direkt, also in Deutschland. Ein Unding in den Augen der Deutschen. Denn ein Duala, der als Alfred nach Deutschland zur Ausbildung geschickt wird, kommt als Herr Bell zurück, ist also als Kolonialbewohner verdorben. Reicht man ihnen den kleinen weißen Finger, greifen sie nach der ganzen Hand, ein unangenehmes Gefühl, das Reichsschullehrer Christaller so ausdrückt: »Da steht immer in der Zeitung: Die Erziehung des Negers zur Arbeit. Kommt aber einmal einer nach Deutschland und will Schreiner werden, gleich ist er ein Prinz, so nackt er vorher ging und so hungrig er war.«
Aber ein »Prinz« ist Manga Bell ohnehin, und Schreiner will er auch nicht werden, als ihn sein Vater – aus der Verbannung zurückgekehrt – 1891 nach Deutschland schickt. Er reist in Begleitung Tube Meetoms aus Akwa-Town, dessen Vater als Übersetzer für die Deutschen arbeitet, und des kaiserlichen Finanzrats Gustav Pahl. Ziel ist Pahls Heimatort Aalen in Württemberg. Echte »Negerbuben« sind bisher allenfalls bekannt durch die Völkerschauen des Zoo-Unternehmers Carl Hagenbeck, der fünf Jahre zuvor »Prinz Samson Dido of Didowown« – einen Schwager King Bells – zusammen mit zwei Ehefrauen, einem Sohn und vier Gefolgsleuten in Hamburg, Leipzig, Dresden und in Berlin-Charlottenburg im Vergnügungsetablissement Flora als »neue schwarze Landesleute« ausgestellt hat. Aber Hagenbeck gastierte nicht in Aalen. Also Blaskapelle, Menschenauflauf, kolossale Begeisterung, Vivat-Rufe, als die beiden Jungen im Aalener Bahnhof eintreffen und in der Kutsche verschwinden, die sie in die Friedhofstraße bringt zur Familie des Lehrers Gottlob Oesterle, bei der sie die nächsten Jahre verbringen werden. Und sie leben gar nicht schlecht. Natürlich erregen sie Aufsehen, wenn sie das Hirschbergbad besuchen. Aber es kann auch Vorzüge haben, als Exoten zu gelten und im Kreis der Mitschüler im Mittelpunkt zu stehen: Um ihre Freundschaft wird gebuhlt. Sie werden getauft und konfirmiert, sie besuchen die Volks- und später die Lateinschule, Tube Meetom lernt Koch in einem Offizierskasino, Manga Bell besucht das Gymnasium in Ulm. Er verlässt es mit der Mittleren Reife und unternimmt Reisen nach Frankreich und England. Es ist möglich, dass er in Bonn auch Vorlesungen zum Recht der Kolonialverwaltung hört und sich dabei mit dem späteren Bezirksamtmann von Duala, Hermann Röhm, anfreundet. Aber der Universitätsbesuch ist nicht gesichert, fest steht nur die Freundschaft mit Röhm, der Jahre später nichts unversucht lassen wird, um Manga Bell an den Galgen zu bringen.
Vorläufig aber kann sich Manga Bell nicht beklagen. Deutschland gefällt ihm, und er gefällt den Deutschen. Dabei müsste sein Bildungseifer ihn den deutschen Behörden eigentlich verdächtig machen. Ganz so, wie sich Julius von Soden in seinem Gouverneursgebäude in Duala mit Dante und Homer beschäftigt, sucht Manga Bell im Kreis der Lehrerfamilie Oesterle die Bekanntschaft mit Goethe, Lessing und Schiller. Doch vom Misstrauen der Behörden, wie es Alfred entgegenschlug, ist nichts zu spüren, im Gegenteil: Ohne zu murren zahlt die deutsche Kolonialregierung seine Ausbildungskosten. Und bis auf weiteres hat sie auch keinen Grund zur Klage. Von Manga Bell kommt keine aufrührerische Post nach Kamerun, und Manga Bells Vater erweist sich nach seiner Verbannung als gehorsamer Untertan, nicht zuletzt um den Erfolg des Sohnes in Deutschland nicht zu gefährden.
Gleichwohl wird die Geduld der Familie Bell zunehmend auf die Probe gestellt. Denn mit dem Zwischenhandel der Duala geht es bergab. Dabei scheitern bis Ende der 1880er Jahre noch fast alle Versuche der deutschen Handelshäuser, mit Expeditionen ins Hinterland vorzustoßen und sich dort mit Faktoreien festzusetzen. Zwar schaffen es sogenannte Forschungsreisende vereinzelt, Stationen zu errichten, Jaunde etwa, Forschungsstation und Basislager für den Elfenbeinhandel, angelegt 1889 von Richard Kund und Hans Tappenbeck, zwanzig Tagesmärsche von der Küste entfernt. Aber ohne Truppen erreichbar ist Jaunde für die Händler nicht. Denn auch die Bakoko, in deren Territorium die Deutschen vorgedrungen sind, verstehen beim Schutz ihres Zwischenhandelsmonopols keinen Spaß. Immer ungeduldiger verlangen daher die Handelshäuser und auch das deutsche Gouvernement »militärischen Schutz«. Und tatsächlich bewilligt der Reichstag in Berlin schließlich 1891 ein Budget für den Aufbau einer Polizeitruppe in Kamerun und beauftragt Hauptmann Karl Freiherr von Gravenreuth. Der Offizier, mit 33 Jahren durch zahlreiche Gemetzel bei der Niederwerfung von Aufständen in Deutsch-Ostafrika gestählt und mit dem röhrenden Kampfnamen Simba ja Mrima (»Löwe von Afrika«) versehen, misstraut den Einheimischen Kameruns und bedient sich günstig am Hof des Königs von Dahomey, heute Benin: Er kauft 370 Sklaven, à 320 Mark für jeden Mann, à 280 Mark für jede Frau, und lässt sie einen sogenannten Arbeitsvertrag unterschreiben, in dem sie sich verpflichten, in Kamerun jede Arbeit zu verrichten, »wie es der Arbeitgeber für passend und gut befinden wird«. Der Vertrag läuft über fünf Jahre, Verpflegung wird gestellt, der Lohn jedoch mit ihrem Kaufpreis verrechnet, und auch nach dem Auslaufen des Kontrakts dürfen sie Kamerun nicht verlassen. Die Chance, vertragsuntreu zu werden, haben nur wenige von ihnen – drei Monate nach ihrer Ankunft ist ein Drittel an Pocken oder Unterernährung gestorben. Bald darauf kommt Gravenreuth selbst auf einer seiner »Strafexpeditionen« ums Leben, zu denen er die kräftigsten Überlebenden als Träger und Söldner versammelt hatte, so auch beim Feldzug gegen die Bakwiri am 5. November 1891 in Buea. Ein bezaubernder Flecken am Kamerunberg – Mongo ma Loba (»Berg der Götter«) –, dem höchsten Berg Westafrikas, milde Temperaturen, kein Vergleich mit der schwülheißen Luft Dualas, schon der frühere stellvertretende Gouverneur Puttkamer hatte ein Auge auf Buea geworfen. Das ist nun kein Grund für einen Überfall, den Vorwand liefert das »recht rohe und dreiste Verhalten« der hier lebenden Bakwiri, so dass Gravenreuth seine in Deutsch-Ostafrika bewährte Strategie versucht und das Maxim-Maschinengewehr in Stellung bringen lässt, um die Bakwiri kollektiv zu massakrieren. Doch das Geschütz hat Ladehemmung, der Soldat am Gewehr wird schwer verwundet, und Hauptmann von Gravenreuth, den »Löwen von Afrika«, trifft der tödliche Giftpfeil des Bakwiri-Kriegers Mondinde Mw Ekeke.
1892 wird Eugen von Zimmerer neuer Gouverneur von Kamerun, Heinrich Leist sein Stellvertreter, Ernst Wehlan Chef der Polizeitruppe. Kaum im Amt, liegt Zimmerer die erste schriftliche, in englischer Sprache abgefasste Beschwerde der Duala seit Unterzeichnung der Schutzverträge auf dem Tisch. Die Duala beklagen sich über die immer aggressiveren Versuche der deutschen Kaufleute, ihr Zwischenhandelsmonopol zu zerschlagen, über die unwürdige Behandlung der Duala-Oberen durch die deutsche Kolonialverwaltung, über die exzessiven Prügelstrafen und darüber, dass Leist die Duala mit »Vieh« und »Schweine« anzureden pflegt. Zimmerer, noch vor wenigen Jahren Landgerichtsrat in München, kennt den Schutzvertrag, weiß von den täglich verhängten Prügelstrafen und ist mit den Bezeichnungen, die Leist für die Duala findet, bestens vertraut. Der Beschwerdekatalog umfasst zwölf Punkte. Alle zwölf Punkte weist Zimmerer zurück und schickt Assessor Wehlan auf Strafexpedition.
Ernst Wehlan ist dafür der richtige Mann. Die Grausamkeit, mit der er auf seinen Feldzügen gegen die Bakoko oder die Mabea vorgeht, ist in der Kolonie bis dahin ohne Beispiel; der Terror, den er in den folgenden Monaten an den Ufern der Flüsse Sanaga und Kampo verbreitet, um deutschen Händlern einen konkurrenzlosen Markt zu erschließen, ist selbst für Sadisten nur schwer zu ertragen. Aus Wehlans Bericht über seinen Überfall auf Toko-Dorf am 6. Oktober 1892: »Es wurde total zerstört, kein Haus blieb stehen, sämtliche Bananen, Planten, Zuckerrohr, Yams, Koko, Kassada und sonstige Nährpflanzen wurden vernichtet, die meisten Kokospalmen niedergehauen.« Aus Wehlans Gefechtsbericht vom 30. November 1892: »Viele Hundert Bakokos wurden aus ihren provisorischen Unterschlupfen im Busche verjagt, zahlreiche Gegner nach kurzer Gegenwehr niedergeschossen, viele Weiber und Kinder niedergehauen. Bei Yadibo wurden einige Kinder erbeutet […] Die Gegner setzten sich verzweifelt zur Wehr; die blutdürstigen Soldaten warfen sie aber über den Haufen, schossen und schlugen Männer, Weiber und Kinder unterschiedslos nieder […] Fast jeder Soldat brachte zum Andenken ein Bakokohaupt nach der Beach.« Doch ist das nur die für den Dienstgebrauch bestimmte Darstellung. Es fehlen einige interessante Details, mit denen der Regierungsbeamte Wilhelm Vallentin, der sich im Auftrag des Auswärtigen Amtes in Kamerun befindet, aushelfen kann: »Aus dem unter Führung des Assessor Wehlan unternommenen sogenannten ›Bakokofeldzuge‹ erfahre ich heute wieder verschiedene Einzelheiten. Es soll wirklich grauenhaft gewesen sein. Die Gefangenen sind tagelang in der glühendsten Hitze auf dem Schiffe […] an die Reelings derartig festgeschnürt worden, dass in die blutrünstigen und aufgeschwollenen Glieder Würmer sich eingenistet hatten. Und diese Qual tagelang in der Tropenhitze und ohne jede Labung! Als dann die armen Gefangenen dem Verschmachten nahe waren, wurden sie einfach wie wilde Tiere niedergeschossen.«
Sofern Häuptlinge der massakrierten Stämme Wehlans Kriegsführung überleben, müssen sie sich nicht nur in »Friedensverträgen« unterwerfen, sondern sich verpflichten, eine bestimmte Menge Elfenbein, Kanus und »Strafarbeiter« zu liefern. Denn Arbeiter sind knapp in der deutschen Kolonie. So schreitet die Erschließung des Landesinnern für Woermann und Jantzen & Thormählen und die Ausschaltung des Zwischenhandels langsam voran.