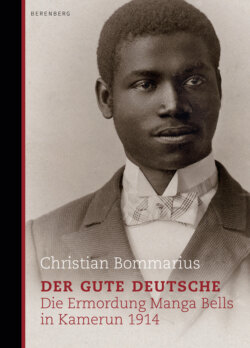Читать книгу Der gute Deutsche - Christian Bommarius - Страница 9
III.
ОглавлениеAUS BROCKHAUS’ CONVERSATIONS-LEXIKON VON 1885: »Neger, in der volkstümlichen Sprache Mohr (entstanden aus dem lat. Maurus, wie im Altertum die dunkelfarbigen Bewohner Nordwestafrikas hießen), nennt man die schwarzen, wollhaarigen Bewohner Afrikas. Dieselben werden in allen ethnogr. Systemen als eine Hauptrasse von anderen abgesondert und stehen als schiefzähnige Langköpfe (prognathe Dolichocephalen nach Retzius) neben den Papuas auf der niedersten Stufe der Rassenentwicklung.« Der deutsche Gesetzgeber hat nicht an die »schwarzen, wollhaarigen Bewohner Afrikas« gedacht, als er 1871 die Prügelstrafe aus dem Reichsstrafgesetzbuch strich. Zum einen gilt das Reichsstrafgesetzbuch in den deutschen Kolonien ohnehin nur für die Weißen. Zum anderen gehören die Afrikaner – unabhängig von Alter und Lebenswandel – nach Ansicht der Deutschen naturgemäß einer der Gruppen an, gegen die auch im Kaiserreich der Einsatz von Rohrstock und Peitsche weiterhin erlaubt ist: Kinder und Verbrecher. Der Rohrstock als Erziehungsmittel ist im Klassenzimmer und im Elternhaus ebenso gebräuchlich wie Lederpeitsche und Ochsenziemer zur Aufrechterhaltung der Ordnung im Zucht- und Arbeitshaus. Wohlmeinende Deutsche, zu denen zum Beispiel Reichsschullehrer Christaller zählt, betrachten »die Neger« als Kinder, ganz gleich, ob sie als Schüler vor ihnen sitzen oder ihnen als ergraute Boys im Haushalt dienen, faul zwar und zuweilen verschlagen, aber mit twenty five on backside problemlos zu dressieren. Hält man sie jedoch, wie zum Beispiel Jesko von Puttkamer die Duala, für »das faulste, falscheste und niederträchtigste Gesindel, welches die Sonne bescheinet, und es wäre sicher am besten gewesen, wenn sie bei der Eroberung des Landes wenn nicht ausgerottet, so doch außer Landes verbracht worden wären«, ist der Gebrauch der Nilpferdpeitsche ein Gebot der Kultur, wie auch ein zeitgenössisches juristisches Lehrbuch bestätigt: »Je niedriger das Kulturniveau, desto mehr Anwendung der Prügelstrafe.« Weil nicht nur die Kolonialbeamten in Duala die Prügelstrafen in schöner Regelmäßigkeit – übrigens von schwarzen Gerichtshelfern – vollziehen lassen, sondern auch die Agenten von Woermann und Jantzen & Thormählen, die Expeditionsführer und Forschungsreisenden sie tagtäglich züchtigen, ist den schwarzen Bewohnern des deutschen Schutzgebiets die Peitsche schon nach wenigen Jahren in Fleisch und Blut übergegangen und Kamerun selbst bei anderen Kolonialmächten als twenty-five country verschrien. Denn fünfundzwanzig Hiebe mit Tauende oder Nilpferdpeitsche sind die Regel.
Reichsschulmeister Christaller hat schon länger damit gerechnet, dass die Afrikaner eines Tages zurückschlagen könnten. Als am 15. Dezember 1893 kurz nach der Abendandacht Schüsse den häuslichen Frieden der Familie Christaller stören – seit ein paar Monaten gehört dazu Sohn Rudolf –, vermutet er deshalb sofort den Beginn einer »allgemeinen Erhebung« der Duala, und er weiß, wie sein Schwager berichtet, »wenn es einmal ein Gemetzel gebe, haben sie ihn zuerst«. Denn das Haus der Christallers liegt ein wenig abseits, vom Gouvernementsgebäude durch eine Schlucht getrennt, von der Basler Mission durch einen Sumpf. Aber da eilt unbewaffnet Manga Ndumbe Bell herbei, Sohn des alten King Bell. Er beruhigt Christaller, nicht seine Duala hätten sich erhoben, sondern siebenundvierzig der von Gravenreuth gekauften fünfundfünfzig überlebenden Dahomey-Soldaten und ihre Frauen. Sie haben den Munitionsschuppen aufgebrochen, das Regierungsgebäude angegriffen, einen in der Kantine beim Abendessen sitzenden Beamten erschossen – einen jungen Assessor, den sie mit Vizegouverneur Leist verwechselten – und alle Weißen zur Flucht auf die in der Bucht ankernden Schiffe Nachtigal und Soden getrieben. Obwohl von Manga Ndumbe gewarnt, entkommt auch die Familie Christaller mit ihrem neuen Hausjungen Ngoso nur mit knapper Not in eine englische Faktorei. Unter Lebensgefahr, im Kugelhagel der Dahomey-Soldaten, kehrt Christaller zweimal ins Schulhaus zurück, um Verpflegung und Kleidung für seinen Sohn zu holen, beide Male besteht Adolf Ngoso Din darauf, ihn zu begleiten: »Das war hoch anzuschlagen, denn es bedarf schon eines großen Maßes von Liebe und Dankbarkeit, um die dem Neger angeborene Feigheit zu überwinden.« Adolf Ngoso Din ist elf Jahre alt.
Am Morgen hatte der stellvertretende Gouverneur Heinrich Leist die Dahomey-Frauen zur Arbeit auf der Kaffeeplantage befohlen. Einige waren vorzeitig zurückgekehrt, um für die Männer das Essen zuzubereiten. Leist tobte und gab Weisung, »die Weiber der schwarzen Soldaten öffentlich peitschen zu lassen, weil sie zu wenig gearbeitet haben«. So berichtet es wenige Wochen später in seinen anonym veröffentlichten Tagebuchblättern der Regierungsbeamte Wilhelm Vallentin: »Während die Soldaten zum Zuschauen in Reih und Glied angetreten waren, erhielten ihre Weiber jedes 10 Hiebe mit der Flußpferdpeitsche, und Herr Leist stand dabei und sah der Exekution zu. Weithin tönte das Geschrei und Geheul der Gezüchtigten.« Leist habe mit dem Ruf »runter mit dem Zeug« angeordnet, »dass die Streiche auf das entblößte Gesäß fielen«, wobei die Frauen »über ein leeres Zementfaß gelegt, an Händen und Füßen gefesselt und mit der einfachen Flußpferdpeitsche gehauen wurden.«
Christaller vermutet richtig, dass die »höchste Erbitterung« der Dahomey-Soldaten nicht erst durch das Auspeitschen der Frauen bewirkt worden ist, sondern ganz allgemein durch ihre brutale Behandlung, die der Vizegouverneur für angemessen hält. Sie werden nicht bezahlt, ständig misshandelt, ihre Frauen vom Vizegouverneur, Assessor Wehlan und anderen Vertrauten Leists regelmäßig vergewaltigt. King Bell und sein Sohn Manga Ndumbe hatten die Lage der Dahomey zwar bedauert, aber Unterstützung aus Furcht verweigert, die Deutschen gegen sich aufzubringen. Alfred Bell jedoch, der seit seiner Zeit in Hamburg nicht nur Deutsch spricht, sondern sich den Deutschen ebenbürtig fühlt, hatte für die Dahomey im März 1893 einen Protestbrief an Leist aufgesetzt, in dem sie zumindest ein wenig Entlohnung verlangt hatten: »Euer Hochwohlgeboren. Wie Euer Hochwohlgeboren selbst wohl weist [sic], wir alle Dammeleute [Dahomey-Soldaten] sind Ihrer Eigentum. Wir haben keine Eltern und keine Verwandten hier, und wir sind seit zwei Jahren hier und haben bis jetzt niemals Taschengeld bekommen. So bitten wir alle Euer Hochwohlgeboren aufrichtig zu sagen, daß wir sind Ihrer Eigentum, und deshalb bitten wir Ihnen ganz gehorsamst, ob Sie uns nicht mitleiden können und uns etwas Taschengeld geben«. Nachdem Leist den Brief aus den Händen Wehlans empfangen hatte, verwarnte er Alfred Bell und den Sprecher der Dahomey-Soldaten scharf und kürzte anschließend die Tagesrationen (600 Gramm Reis, 200 Gramm Fleisch, 62 Gramm Hartbrot) für die Dahomey.
Erst acht Tage nach dem Aufstand, am 23. Dezember, und nur mit Hilfe des eilig herbeigerufenen Kanonenboots Hyäne gelingt es, die Dahomey-Soldaten niederzukämpfen. Überlebende werden festgenommen und am Neujahrstag 1894 hingerichtet, die Frauen werden zu Zwangsarbeit auf den Plantagen verurteilt. Die Schäden durch deutsche Granaten sind beträchtlich, Christallers Schulgebäude ist zerschossen, die Joßplatte wieder einmal verwüstet. Das lässt sich in Berlin nur schlecht als erfolgreiche Bilanz deutscher Kolonialverwaltung verkaufen, und so hatte man den Kaiser bislang über den Aufstand nicht informiert. Am Abend des 23. Dezember wird Wilhelm II. bei einer festlichen Gesellschaft von dem Telegramm Heinrich Leists überrascht: »Jossplatte durch Hyäne, Gouvernement und deutsche Kaufleute zurück erobert. Fünf Verwundete.« Sofort diktiert der Kaiser seinem Flügeladjutanten eine Eilnachricht an das Auswärtige Amt: »Seine Majestät erhalten soeben Depeschen aus Kamerun, aus denen hervorgeht, dass die Jossplatte zurückerobert ist. Da darüber hier nichts bekannt, lassen seine Majestät nachfragen, was das alles zu bedeuten hat.« Aber auch dort hat kein Beamter etwas von der Eroberung und Rückeroberung der Jossplatte gehört. Zwei Tage später erreicht den Hamburger Kaufmann Adolph Woermann von seinem Niederlassungsleiter in Kamerun die Nachricht: »Jossplatte gestürmt. Wohnhaus Woermann jetzt Hospital.« Und als Woermann wie der Kaiser das Auswärtige Amt um Auskunft über Einzelheiten bittet, erfährt er nur so viel: Man bitte dringend um Diskretion und Verschwiegenheit zur Sache. Aber die Bitte kommt zu spät.
In den nächsten Tagen und Wochen berichten deutsche Zeitungen über den ersten Kameruner Kolonialskandal. Der Berliner Volksmund kreiert für Leists und Wehlans Umgang mit der Peitsche den Begriff »Tropenkoller«, während die Berliner Beamten vor allem versuchen, die Identität jenes Anonymus zu lüften, der im Berliner Tageblatt mit seinen Tagebuchblättern eines in Kamerun lebenden Deutschen die Öffentlichkeit mit blutigen Details aus der Kolonialverwaltung versorgt. Es ist nicht so, dass der 31 Jahre alte Wilhelm Vallentin grundsätzliche Einwände gegen die koloniale Eroberung Afrikas hätte. Im Gegenteil, einige Jahre später wird der Nationalökonom und Forschungsreisende Die Buren und ihre Heimat, so der Titel seiner Studie, als hoher Beamter der südafrikanischen Republik Transvaal literarisch und als Artillerist gegen Lord Kitchener verteidigen. Aber offensichtlich ist Vallentin – anders als Leist und Wehlan – der Auffassung, dass die effiziente Herrschaft der Peitsche maßvollen Umgang voraussetzt. In seinen Tagebuchblättern berichtet er über Gerichtstage unter dem Vorsitz Wehlans: »Am 4. V. 93 […] Eine Frau (Schwarze) verklagt ihren Mann, weil er sie schlecht behandle. Ohne irgend welche Beweisaufnahme und Zeugenverhör wird der Mann zu 50 Hieben verurteilt und die Strafe sogleich vollstreckt. Ein Schwarzer, Aug. Bell, ist beschuldigt, eine Uhr gestohlen zu haben. Er wird vorgeführt. Das erste, was ihm vorgehalten wird, ist: es giebt zweierlei Wege, entweder, er gesteht, er habe den in Frage stehenden Diebstahl begangen, oder er bekommt 50 Hiebe. Bell sagt aus: ›Nein, ich habe die Uhr nicht gestohlen‹. Sofort wird er abgeführt und erhält 50 Hiebe mit der Rhinocerospeitsche. Wieder vorgeführt gesteht er auf weiteres Befragen, dass er die Uhr gestohlen habe. Er wird darauf zu 6 Jahren Gefängnis […], 100 Mk Geldstrafe, und 15 Hieben am ersten Sonnabend jeden Monats verurteilt. Aug. Bell soll während jener vorerwähnten Verhandlung ca. 80 Hiebe bekommen haben […] Ein rohes, gehacktes Beafsteak ist nichts dagegen! Ein weiterer Fall! Herr Assessor Wehlan vermutet, dass sein Boy ihm Cigarren gestohlen habe. Auf Grund dieser Vermutung wird der Boy von ihm zu 20 Hieben verurteilt.«
Es sind die Veröffentlichungen Vallentins – seine Tagebuchblätter werden von mehreren Zeitungen nachgedruckt –, die den Stoff für die Reichstagsdebatte über die koloniale Praxis im deutschen Schutzgebiet Kamerun liefern, die im Februar 1894 beginnt. Die Mitteilungen der Reichsregierung sind es jedenfalls nicht. Zwar hat sie sogleich einen Regierungsrat für Ermittlungen nach Kamerun entsandt, im Übrigen aber hält sie sich mit Informationen zurück und warnt vor Vorverurteilungen. Vorsorglich stellt Kolonialdirektor Paul Kayser schon zu Beginn der Debatte fest, unabhängig von künftigen Erkenntnissen über die Praxis der Prügelstrafe in Kamerun halte er sie für unentbehrlich. Die hartnäckigsten Gegner der Kolonialpolitik im Reichstag sind die Sozialdemokraten, deren Sprecher August Bebel die Peitschen als »Kulturwerkzeuge«, die Prügelstrafe als »Produkt der sogenannten europäischen Zivilisation« verspottet und grundsätzlich zur deutschen Kolonialpraxis bemerkt: »Überhaupt ist die Prügelstrafe in großem Umfange allerwärts in unseren Kolonien im Schwange; sie kommt täglich, ich möchte sagen, stündlich als Hauptzuchtmittel zur Anwendung.« Und da sich etliche Abgeordnete »in vollständiger Unkenntnis der Sitten und Lebensgewohnheiten« der Afrikaner befänden, kündigt er an, am nächsten Sitzungstag einige Flusspferdpeitschen auf den »Tisch des Hauses« zu legen. Zwar versichert Reichskanzler Leo von Caprivi, im Bericht des Gouverneurs Zimmerer werde die Anwendung der Peitsche überhaupt nicht erwähnt, und er selbst, Caprivi, halte ihren Gebrauch auch für »unwahrscheinlich«. Doch löst Bebel sein Versprechen in der nächsten Reichstagssitzung ein und verteilt einige Flusspferdpeitschen unter den Abgeordneten. Allerdings ist damit für die Regierung nur die Existenz der Peitschen bewiesen, nicht aber ihr Einsatz auf Rücken und Gesäßen der Afrikaner. Kolonialdirektor Kayser erklärt die Misshandlungen zum Gerücht; er könne mit den »allgemeinen Redensarten« von der Prügelstrafe in den deutschen Schutzgebieten nichts anfangen und verbitte sich im Übrigen Verdächtigungen von »ehrenwerten Beamten«. Die Bereitschaft der Reichsregierung, die Vorwürfe aufzuklären, bleibt gering. Entsprechend sind die Konsequenzen.
Zwar neigt die Budgetkommission des Reichstags zur Ansicht, dass die »zugegebenen Thatsachen vollständig hinreichen, um hier einen scharfen Tadel zu motivieren«. Allerdings können sich die Abgeordneten – nach ausführlicher Beratung – nicht dazu entschließen, die Prügelstrafe grundsätzlich in Frage zu stellen: »Bei Expeditionen oder unter solchen Verhältnissen, wo eine Bestrafung durch Geld oder Haft entweder nicht ausführbar, oder nicht wirksam ist, da mag zu diesem Mittel geschritten werden, das ja in allen Kolonien üblich ist.« Am 22. April 1896 ergeht schließlich die »Verfügung des Reichskanzlers wegen der Ausübung der Strafgerichtsbarkeit und der Disziplinargewalt gegenüber den Eingeborenen in den deutschen Schutzgebieten von Ostafrika, Kamerun und Togo«. Danach ist die Prügelstrafe nur noch mit einem amtlich abgenommenen Züchtigungsinstrument zu vollstrecken und auf zweimal fünfundzwanzig Hiebe zu beschränken, die Züchtigung von Indern, Arabern und Frauen verboten. Allerdings regelt die Verfügung nicht, für welche Straftaten wie viel Prügel verabreicht werden dürfen. Ohnehin aber ändert sie an den Zuständen in Kamerun nichts – die Zahl der von der Kolonialverwaltung verhängten Prügelstrafen steigt mit jedem Jahr.
Diese Verfügung reagiert weniger auf den Leist-Wehlan-Skandal als vielmehr auf die deutsche Justiz. Heinrich Leist, noch Ende 1892 vom Großherzog von Sachsen mit dem »Ritterkreuz Zweiter Klasse des Ordens der Wachsamkeit und des Weissen Falken« dekoriert, muss sich am 16. Oktober 1894 vor der Kaiserlichen Disziplinar-Kammer Potsdam in öffentlicher Sitzung verantworten, nach der »für Recht erkannt wurde, dass der Angeschuldigte des Dienstvergehens schuldig und deshalb mit Versetzung in ein anderes Amt von gleichem Rang, jedoch mit Verminderung des Diensteinkommens um ein Fünftel zu bestrafen sei und die Barauslagen des Verfahrens ihm zur Last zu legen sind.« Das Urteil kommt einem Freispruch gleich, Reichstag und Öffentlichkeit protestieren, die Reichsregierung sieht sich genötigt, Rechtsmittel beim Reichsdisziplinarhof einzulegen, der am 6. April 1896 immerhin auf Dienstentlassung Leists erkennt, da sich »die Beamten in Afrika gemäß deutschen Sittlichkeitsvorstellungen einzurichten hätten«. Assessor Wehlan kommt mit einer Geldstrafe von 500 Reichsmark davon. Strafrechtlich aber werden weder der eine noch der andere von der Justiz behelligt. Kolonialdirektor Kayser begründet das folgendermaßen: »Ebenso [wie im Fall Leist] liegt es in dem Fall Wehlan wegen der von ihm begangenen Körperverletzung. Der Herr Abgeordnete Bebel sagte: wenn ihr ihn nicht als Richter bestrafen könnt, so bestraft ihn doch als Menschen! Das geht eben nicht. Wenn er nicht Richter gewesen wäre, so hätte er nach der Auffassung der Staatsanwaltschaft sich einer Körperverletzung schuldig gemacht. Da aber bis dahin das Verfahren gegen Eingeborene im Kamerun nicht geregelt war, da er als Richter eine Körperverletzung begangen hat, so kann er nach Auffassung der Staatsanwaltschaft nicht bestraft werden.« Prügelt ein Deutscher in Kamerun als Privatperson, kann er sich unter Umständen strafbar machen, wird allerdings von der Kolonialverwaltung nicht verfolgt; handelt er als Beamter, kann er sich gar nicht erst strafbar machen.
Am 13. März 1896 spricht Bebel noch einmal im Reichstag zum Leist-Wehlan-Skandal, zu den Ursachen und dem brutalen Ende des Dahomey-Aufstands und ruft dem Kolonialdirektor zu: »Wenn Ihre Kolonialpolitik solche Folgen gebiert, dann haben Sie alle Ursache, so rasch wie möglich mit derselben aufzuräumen, dem ganzen Afrika den Rücken zu kehren und Ihre Zivilisations- und Kulturarbeit hier in Deutschland zu vollenden.« Aber für den Kolonialdirektor sind die Akten des Skandals zu diesem Zeitpunkt längst geschlossen, vor allem ist sein vermeintlicher Urheber beseitigt: Der emphatische Kolonialbeamte Wilhelm Vallentin, der Whistleblower avant la lettre, hat den Dienst quittieren müssen.