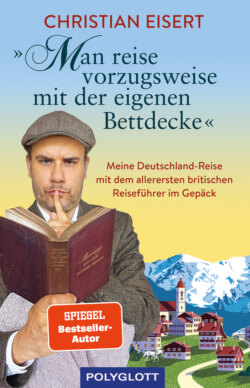Читать книгу "Man reise vorzugsweise mit der eigenen Bettdecke" - Christian Eisert - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
BERLIN – KÖLN I
GEPÄCK, GEFÄHRT, GARTENZWERGE
Оглавление»Auszug oder Urlaub?«, fragte mein Nachbar, als ich am folgenden Tag vor dem Haus meine Kutsche belud. Die Frage war aus zwei Gründen berechtigt.
Zum einen, weil mein Gepäck neben Taschen und Kisten einen Sonnenschirm, einen Campingtisch, eine Schreibtischlampe, einen 3-in-1-Tintenstrahldrucker und einen Router für mobiles Highspeed-Internet umfasste. Zum anderen wegen des Aussehens meines Gefährtes. Zunächst zum Gepäck. Oder genauer: der Garderobe für eine Deutschland-Reise.
Die Schuhe sollten doppelt besohlt sein, mit Eisenabsätzen und Nägeln, wie sie in England beim Schießen getragen werden. Das Gewicht eines Schuhs dieser Art steht der wirksame Schutz der Füße vor spitzen und losen Steinen gegenüber, die Quetschungen verursachen können sowie Müdigkeit und Schmerzen. Sie sollten groß genug sein, um keinen Teil des Fußes einzuklemmen. Der erfahrene Fußgänger beginnt nie eine Reise mit neuen Schuhen, sondern mit einem Paar, das bereits der Fußform angepasst ist.7
Zwar war ich kein Fußreisender, doch beabsichtigte ich an die 100 Orte und Örtchen, laute wie stille, aufzusuchen, weshalb ich Schuhwerk, bereits der Fußform angepasst, für alle Witterungen, Weguntergründe und Anlässe mitführte.
Baumwollstrümpfe schneiden die Füße auf einem langen Spaziergang in Stücke; an ihrer Stelle sollten ausnahmslos dicke Kammgarnsocken getragen werden.8
Entgegen dieser Empfehlung hatte ich vier Paar Baumwollsocken neu gekauft, dazu kamen mehrere Paar Sneakersöcklinge und zwei Paar Wollkniestrümpfe, damit ich es des Nachts oder an kühlen Tagen untenrum warm hatte.
Es ist ratsam in Stoffhosen zu reisen, nicht in Leinen, die keinen Schutz bieten gegen Regen oder Temperaturschwankungen in Bergregionen.8
Keine meiner Hosen bestand aus Leinen. Es handelte sich vielmehr um baumwollene, zum Teil mit Elasthan. Drei lange und zwei kurze. Dazu kamen eine Schlafhose (Baumwolle) und eine Trekkinghose aus Polyamid, die in eine kurze verwandelbar war, weil man die Hälfte ihrer Beine abnehmen konnte.
Ein Gehrock ist besser als eine Jagdjacke, die zwar für abgelegene Orte ausreicht, aber in fremden Städten unangenehm auffällt.8
Ich würde in einige fremde Städte kommen. Magdeburg zum Beispiel. Da wollte ich nun wirklich nicht unangenehm auffallen. Also verzichtete ich auf eine Jagdjacke. Was leichtfiel, weil ich gar keine besitze. Nicht mal ein Jagdgewehr. Auch ein Gehrock fehlte meinem Hausstand. Dafür nannte ich andere Jacken mein Eigen und folgte der Schuhstrategie: je eine passend zu Witterung, Gegend und Anlass.
Dass Murray nichts über T-Shirts und Hoodies schreibt, ist nachvollziehbar. Eine Empfehlung für Leibwäsche hätte er wenigstens geben können. Ich packte nach Gutdünken ein. Und auch eine Badehose.
Aber wem vertraute ich mich da in punkto Hosen, Schuhen und Reiserouten eigentlich an?
Oder anders gefragt: Wer iss’n John Murray?
Dafür beginnen wir mit seinem Großvater. Der hieß mit Vornamen John und suchte 1768 nach einer Verdienstmöglichkeit. Obwohl er sich in geschäftlichen Dingen für einen totalen Dummkopf9 hielt, lieh er sich von seiner Frau 700 Pfund und gründete in der Londoner Fleet Street eine Verlagsbuchhandlung. Dank Druck und Verkauf der Werke des dichtenden Lords George Gordon Byron brummte der Laden und Großvater Murray expandierte. Räumlich wie geschäftlich. Er produzierte weitere Erfolge. Darunter Englands erstes Kochbuch für den Massenmarkt. Sein Sohn, er taufte ihn John, führte die Geschäfte fort. 1808 wurde dieser Sohn Vater eines Sohnes, den er überraschenderweise John nannte.
Damit sind wir bei unserem John angelangt. Der studierte ab 1827 an der Universität von Edinburgh, wo er neben Chemie und Mathematik Kurse in Mineralogie und Geologie sowie Französisch und Deutsch belegte. Und Reitstunden nahm. Wovon er später profitierte. Oft legte er größere Reisestrecken im Sattel zurück. Fahrrad fuhr er nicht. Das erste Fahrrad, wie wir es heute kennen, wurde 1892 vorgestellt, im Jahr seines Todes.
Porträt von John Murray, 1904
Quicklebendig und jung, verkehrte unser John in Edinburghs Intellektuellenkreisen und lernte unter anderem den schottischen Schriftsteller Sir Walter Scott kennen, dessen abenteuerliche Historienromane, allen voran »Ivanhoe«, Bestseller der europäischen Literatur waren.
1828 erlebte Murray in den Sommerferien sein erstes Reiseabenteuer. In Schottland. In den nächsten Sommerferien reiste er bereits ins Ausland. Eine Tradition, die er bis ins hohe Alter beibehielt, schreibt John Murrays Sohn – er hieß übrigens John – in seinen Erinnerungen an den Vater.10
Wie und warum John III. die Welt der Reiseliteratur revolutionierte, davon schreibt er 1887 höchstselbst in »Murray’s Magazine«11: Da ich seit meiner frühen Jugend von einer leidenschaftlichen Reiselust besessen war, kam mein sehr nachsichtiger Vater meiner Bitte [reisen zu dürfen] nach, unter der Bedingung, dass ich die Sprache des Landes beherrschte, in das ich reiste. So betrat ich 1829, nachdem ich mein Deutsch aufgefrischt hatte, zum ersten Mal den Kontinent in Rotterdam. … So etwas wie einen Reiseführer für Deutschland, Frankreich oder Spanien gab es damals noch nicht.12
Zwar existierten Reisebeschreibungen für Italien, die Schweiz und Belgien, jedoch fehlte ihnen, Murray zufolge, jede Systematik.13
Ich machte mich auf den Weg nach Nordeuropa, ohne mit irgendeinem Führer versehen zu sein, mit Ausnahme einiger handschriftlicher Notizen über Städte und Gasthäuser in Holland … Es beschämte mich, dass ich bei der Ankunft in Hamburg auf freundliche Hilfe angewiesen war. Dies war es, was mich den Wert praktischer Informationen vor Ort erkennen ließ und ich machte mich daran, alle Informationen zu sammeln, die ein englischer Tourist wahrscheinlich benötigen oder nützlich finden würde. So reiste ich mit dem Notizbuch in der Hand umher. Ob auf der Straße, im Eilwagen oder in der Gemäldegalerie, ich notierte alles, was sich ereignete. Diese Notizbücher (von denen ich viele Dutzend besitze) wurden bei meiner Rückkehr ausgewertet, in Routen geordnet zusammen mit anderen Informationen, die ich über Geschichte, Architektur, Geologie und andere für die Bedürfnisse eines Reisenden geeignete Themen sammeln konnte; und schließlich übergab ich sie meinem Vater. Er … hielt meine Arbeit für veröffentlichungswürdig und gab ihr den Namen »Handbuch«.14
Neu für die damalige Zeit war der umfangreiche Prüfungs- und Überarbeitungsprozess des »Handbook for Travellers«.
Nachdem ich meine Routen erstellt und grob typisiert hatte, fuhr ich fort, sie zu testen, indem ich sie an reisende Freunde auslieh, damit sie an Ort und Stelle überprüft oder kritisiert werden konnten. Ich begann erst nach mehreren aufeinanderfolgenden Reisen und Aufenthalten in Kontinentalstädten mit der Veröffentlichung, nachdem ich nicht nur ausgetretene Pfade durchquert, sondern auch verschiedene Gegenden erkundet hatte, in die meine Landsleute noch nicht vorgedrungen waren.15
1836 erschien der erste Band der Reihe, das »Handbuch für Norddeutschland«. Zwei Jahre später das für Süddeutschland. Der Nord-Band beinhaltete zudem einen umfangreichen Routenteil für Belgien und die Niederlande, der Süd-Band bestand zu zwei Dritteln aus Reiserouten durchs Gebiet des Kaisertums Österreich inklusive seiner Herrschaftsgebiete in Ungarn, Böhmen, Mähren und Galizien, also Teilen des heutigen Tschechiens, Polens und der Ukraine. Die Norddeutschland-Ausgabe hatte einen roten Umschlag. Die süddeutsche erschien in der ersten Auflage zur besseren Unterscheidbarkeit in grünem Einband. Ab der zweiten dann auch in Rot.16 Was zum Markenzeichen der bald »Red Books« genannten Reihe wurde. Erstmalig setzte man auf das Prinzip des Sehenswerten. Also: Wo muss man was gesehen haben und warum. Das später von Murray erfundene Bewertungssystem mit Sternen half bei der Einordnung. Bis 1901 erschienen Handbücher für fast jedes Land Europas. Hinzu kamen ausgewählte außereuropäische Ziele.
Für Sternstunden sorgte der John-Murray-Verlag nicht nur mit seinen Reise-Handbüchern. 1859 brachte John Murray ein Buch heraus, das ebenfalls Neuland beschritt: Charles Darwins »Die Entstehung der Arten«.
An diesem Dienstag um halb zwei wurde nun ich mit Starten des Motors meines vollgepackten Wohnmobils zu einer anderen Art Mensch: zum Camper.
Wir Camper, wir halten zusammen. Helfen uns, unterstützen uns … und grüßen uns. Das hatte ich bereits auf der Fahrt von Hoppegarten nach Berlin-Mitte entdeckt. Während ich über die auf Berliner Stadtgebiet gar nicht mehr so gut in Schuss befindliche B1 geholpert war, hoben entgegenkommende Camperlenker eine Hand zum Gruß. Ab dem dritten hatte ich verstanden, zu welcher Kaste ich nun gehörte. Und grüßte lässig zurück.
Es ist nicht so, dass ich keine Camping-Kenntnisse besäße. In meinen Kindertagen machte ich mehrmals Familienurlaub in einem Wohnwagen. Der den ganzen Sommer an derselben Stelle stand.
Ein Wohnmobil ist kein solch unselbstständiges Anhängsel. Ein Wohnmobil ist etwas Erhabenes. Ein rollendes Königreich. Von meinem Thron herab schaute ich auf all die Kleinst-, Klein-, Kompakt-, Mittelklasse- und Oberklassewagen. Ja, selbst auf SUV. Denn ich fuhr CUV. Ein Crossover Utility Vehicle.
Utility bedeutet Nutzen oder Nützlichkeit. Treffend, weil Basis meines Wohnmobils ein Nutzfahrzeug war: ein Fiat Ducato-Kastenwagen. Fahrerhaus und Laderaum gehen nahtlos ineinander über.
Ursprünglich und hauptsächlich dienen die zwischen fünf und achteinhalb Meter langen Vehikel Handwerkern, Lieferanten oder Menschen, die umziehen, als Transportfahrzeug.
Doch nicht nur Maurerkellen, Möhren und Möbel lassen sich darin kommod unterbringen. Auch Urlaubswillige. Sofern am und im Kasten ein wenig geschraubt wird. Das tun Karmann, Malibu, Hymer, Adria, Pössl und viele andere Vertreter der Freizeitindustrie und sorgen für das Crossover. Wer selbst einen Kastenwagen umbauen will, findet dafür inzwischen umfangreiche Bausätze im Fachhandel oder gestaltet selbst nach Lust, Laune und Fingerfertigkeit. Zum Wohnmobil werden die Lieferwagen durch Einbau von Dachluken, bis zu sieben zusätzlichen ausstellbaren Fenstern, einem Küchenblock vor der seitlichen Schiebetür, einem Doppelbett im Heck sowie einer Nasszelle mit Chemieklo gegenüber der Küche und einer Sitzgruppe, die sich aus einer festen Bank, unterm Fenster einzuhängendem Tisch und den drehbaren Fahrer- und Beifahrersesseln bauen lässt. Dazu kommen Wassertanks, Lichtinstallation, Heizung, Staufächer und im Laufe der Zeit Krümel an schwer erreichbaren Stellen.
Bei den fertig konfektionierten CUV bilden neben dem Fiat Ducato häufig Peugeot Boxer oder Citroën Jumper die Basis. Spielt keine Rolle. Technik und Chassis sind aufgrund von Konzernverwandtschaften weitgehend identisch. Dem Sprinter von Mercedes und dem Crafter von VW, bis 2017 ebenfalls baugleich unterm Blech, begegnet man seltener in Camperform.
Egal welche Form ihr Wohnmobil hatte, ich grüßte alle Camper, die mir begegneten. Wie ich es gelernt hatte durch einmal Handheben. Denen in CUV winkte ich enthusiastisch mit wedelnder Hand, weil wir zur selben Camper-Kategorie gehörten. Was mehrere Handwerker irritierte. Von vorn bleibt ein Kastenwagen doch ein Kastenwagen.
Meiner war außen nicht wohnmobilweiß, sondern grau. Wie ein Esel. Zu meinem kleinen, der zusammengeklappt im Gepäckabteil unterm Doppelbett lag, hatte ich einen großen bekommen. Das Muttertier.
Sechs dynamisch geformte, auf alle Karosserieteile gepappte schwarze Aufkleber verliehen meinem grauen Kastenesel das nötige Outdoor-Freedom-Fun-Outfit.
Mit dem Passieren des Brandenburger Tors hatte ich das Berlin des John Murray verlassen und befand mich auf dem Weg nach Charlottenburg, ein kleines Dorf an der Spree, hauptsächlich geprägt von Villen und Tavernen, eine Sommerresidenz der Reichen und im Sommer Erholungsgebiet der bescheideneren Klassen von Berlin17.
Abgesehen von ein paar einstöckigen Häusern aus dem 17. Jahrhundert Haubach-/Ecke Wilmersdorfer Straße, hatten vor Stuck triefende Vier- und Fünfstöcker des ausgehenden 19. und mehr oder weniger formschöne Bauten des 20. Jahrhunderts das dörfliche Charlottenburg verdrängt. Geblieben war das Selbstverständnis der Charlottenburger. Wer in diesem Berliner Stadtteil wohnt, gehört meist zu den Betuchteren oder hält sich dafür. In vielen Straßen reiht sich eine moderne Taverne an die nächste und am Lietzensee sucht auch der bescheidenere Berliner Erholung.
Ich suchte den Weg nach Potsdam. Über die Autobahn A115 ist er leicht zu finden. Eine Strecke, die natürlich ausschied.
»Plopp«, machte mein Telefon, was den Eingang einer Nachricht bedeutete.
»Na, wo steckt mein Hasenmann gerade?«, las ich nicht, da ich ja am Steuer saß.
Die vertrauliche Anrede offenbart, die Absenderin steht mir recht nahe. Manchmal ruft sie mich sogar »Hasi«, was insofern erstaunlich intim ist, als dass sie kulturkreisbedingt ihre Großeltern siezt.
Weil ich am Steuer saß, antwortete ich nicht, dass ich auf der Bundesstraße 5 fuhr, eine Fernstraße, die seit Beginn des 19. Jahrhunderts die Gebiete an der dänischen Grenze im Nordwesten mit denen an der Oder im Osten verbindet. Auf ihr reiste – das lässt sich leicht aus der Reihung der Orte in den Routen-Beschreibungen erkennen – schon der selige John. Und da ich auf seinen Spuren wandelte, würde ich in den kommenden Wochen ausschließlich auf Landstraßen unterwegs sein.
Was für die östlichen Berliner Ausfallstraßen galt, traf ebenso auf die im Westen zu: Die Gasthäuser am Wegesrand boten keine Haute Cuisine. Ich kehrte kurz vor der Stadtgrenze im Rasthaus Zum Goldenen M ein.
Den McDrive zu nutzen traute ich mich nicht, dafür erschien mir mein Reisemobil zu hoch. Seine exakte Höhe herauszufinden, indem ich ein Vordach rammte, hielt ich für kontraproduktiv. So holte ich mir drinnen ein Menü to go und speiste bei offener Schiebetür auf dem Boden meiner Behausung sitzend, die Füße auf dem Parkplatzasphalt. Davon nur wenige Zentimeter entfernt schob sich eine Schlange aus Autos vorbei, die samt Insassen am Fahrzeugschalter anstanden.
»Ihr fahrt gleich wieder in euer Wohnungsgefängnis«, rief ich den Insassen in Gedanken zu. »Ich fahre in die Freiheit!«
Ich schrieb der Hasenfrau eilends ein paar Zeilen, dann musste ich weiter. Spätestens 18 Uhr 30, wenn die Schranke an meinem Übernachtungsplatz schloss, endete meine Freiheit.
»In sechzig Metern rechts abfahren«, wies mich eine Stimme auf den Abzweig hin, der dreißig Meter hinter mir lag. Auf einer vierspurigen Bundesstraße mit Mittelstreifen wendet es sich schlecht. So fuhr ich weiter westwärts, statt mich gen Süden nach Potzdam zu orientieren.
Ich nahm es als Wink des Schicksals, denn um diese Tageszeit würde Potzdam zur Staufalle werden. Jawohl, Potzdam. Das steht bei Murray. Die dort befindliche Sommerresidenz Sanssouci von Preußenkönig Friedrich II. und seiner Nachfolger schreibt er Sans Souci, was im Sinne französischer Rechtschreibung korrekt ist und übersetzt »ohne Sorge« bedeutet. Ich befand mich im gegenteiligen Zustand, da ich mich, kaum unterwegs, schon verfahren hatte.
Dadurch entging mir das preußische Versailles. Man kann es als Stadt der Paläste bezeichnen, nicht nur wegen der vier königlichen Residenzen darin und drum herum, sondern weil selbst die Privathäuser bekannte Bauwerke nachahmen, allerdings mit Wohnungen für mehrere Familien darin. Die Ödnis der Straßen steht oft im eigenartigen Kontrast zur Pracht ihrer Architektur18.
Infolge meines schlafmützigen Navigationsgerätes stand meine Fahrstrecke in eigenartigem Kontrast zu Route 58, die eigentlich nicht die Strecke Berlin–Köln, sondern Köln–Berlin beschreibt. Für einen fortlaufenden Reiseweg reiste ich einige Routen verkehrt herum. Jetzt war ich unfreiwillig richtig herum unterwegs, allerdings auf Route 61, Berlin–Hamburg.
Dorthin führte der Weg über Nauen. Das zu beschauen, klang wenig lohnenswert: Der größte Teil wurde 1830 bei einem Feuer zerstört.19 Wenngleich ich vermute, die größten Schäden wurden inzwischen beseitigt.
Es galt, auf die ursprünglich geplante Route zurückzufinden, die südlicher verlaufende B1, um über Großkreutz, Brandenburg, Genthin und Burg nach Magdeburg zu gelangen.
Ich war noch nie in Magdeburg!
Bei der nächsten Gelegenheit schwenkte ich nach Süden und geriet ins brandenburgische Nebenstrecken-Nirvana.
Frau Navi irritierte das. Während ich auf einer frisch asphaltierten Straße fuhr, zeigt sie mich auf ihrem Display in Form eines blauen Pfeils an, der über glattes Grün glitt.
Irgendwann entsprach die Strecke auf Frau Navis Anzeige wieder dem Weg vor der Windschutzscheibe. Natürlich abzüglich der bis zu hundert Meter, die ihre Angaben von meiner tatsächlichen Position abwichen.
Puristen mögen einwenden, moderne Orientierungshilfen wie ein Navigationsgerät widersprächen dem Gedanken, möglichst authentisch historische Routen abzureisen. Müsste ich nicht mit papierenen Karten reisen? Historischen gar?
Ich hatte die neuesten an Bord. Zwölf Stück, die die Bundesrepublik im Maßstab 1:300 000 abbildeten. Die Routen hatte ich mit Bleistift eingezeichnet.
Karten zu nutzen wäre dennoch viel weniger authentisch gewesen, als sich kundiger Führung anzuvertrauen.
Ein Führer ist, obwohl es sich um einen teuren Luxus handelt, ein Luxus, der die Leichtigkeit und das Vergnügen des Reisens sehr fördert und nur wenige, die es sich leisten können, werden auf den Vorteil seiner Dienste verzichten. Er bewahrt seinen Herrn vor Ermüdung des Körpers und Ratlosigkeit des Geistes, löst Schwierigkeiten mit langen Abrechnungen und fremden Währungen … [und] schlichtet Streitigkeiten mit Gastwirten, Postmeistern und dergleichen. Ein Reiseführer ist, sofern klug und erfahren … eine sehr nützliche Person.20
Okay, Murray meint echte Menschen. Streitigkeiten mit Postmeistern und Schwierigkeiten mit fremden Währungen würde ich auf meiner Reise wohl keine bekommen. Ratlosigkeit meines Geistes konnte Frau Navi durchaus lindern, denn drückte man die richtigen Touchscreenfelder, gab sie schriftlich Hinweise auf Sehenswürdigkeiten, kannte die Adressen von in der Nähe befindlichen Gasthäusern und wusste, wo ich Futter, sprich Diesel, für meine 140 Pferdchen bekam. Dass sie ein bisschen Schwierigkeiten mit der Orientierung hatte … Herrje, sind Menschen fehlerfrei?
Die Fehler vieler Führer, die Reisenden ihre Dienste anbieten, sind zahlreich und ernst: obwohl sie … bezahlt werden, leben sie auf Kosten des Reisenden, das heißt, sie zahlen nichts in den Gasthäusern. Wäre das alles, wäre es unwichtig. Tatsache ist, dass sie regelmäßig ihre Schützlinge bestimmten Gastwirten zuführen, die sie kennen. Dafür verlangen sie eine Provision im Verhältnis zur Anzahl und Aufenthaltsdauer der Reisenden. Diese wird dem Reisenden wiederum [vom Wirt] … in Rechnung gestellt.21
Frau Navi kostete mich vor allem Zeit. Einerseits. Andererseits lernte ich – hatte sie mal wieder einen Abzweig zu spät angesagt – wie man ein Wohnmobil schnellstmöglich in drei Zügen wendet. Außerdem war die Gegend schön, durch die wir irrten.
Auf den Feldern wogten grüne Ähren, rot leuchtete der Klatschmohn darin und die Kornblumen blau. Üppig belaubte Bäume standen am Straßenrand Spalier und die von skelettgleichen Masten gespannten Überlandleitungen säumten wie vergessene Girlanden den Horizont.
Brandenburg: Land
Verkehr herrschte kaum. Und wenn, löste er Herzrasen aus. Zum ersten Mal in meiner ein Vierteljahrhundert andauernden Fahrzeugführerkarriere steuerte ich ein Wohnmobil. Es verführt zum Bummeln. Weil man auf einem dicken Sessel thront. Weil es hinter einem in den Kisten, Stau- und Geschirrfächern unentwegt klappert und rappelt und weil vorbeibrausende Fahrzeuge den Wohnkasten wanken lassen.
Auf den schmalen Alleen genügten mir 70 Kilometer die Stunde, 80 fühlten sich schnell an, 60 sicher.
Die auf dem Nachhauseweg befindlichen Eigenheimbewohner der umliegenden Dörfer sahen das anders. Besonders, wenn 100 Kilometer pro Stunde gestattet waren. Die meisten klemmten sich dicht hinter mich, sodass ich sie trotz meiner extragroßen Außenspiegel nicht sah. Ein Innenspiegel fehlte meinem Gefährt (was mich nicht davon abhielt, bis zum Ende der Reise regelmäßig an die gewohnte Stelle zu schauen).
Gerne schoss die Landbevölkerung unvermittelt und ohne Rücksicht auf kommende Kurven und Überholverbote hinter mir hervor und vorbei. Oder tat dasselbe bei LKW auf der Gegenfahrbahn, so dass wir – für meinen Geschmack viel zu lange – aufeinander zu rasten.
Gelegentlich geriet ich auf Straßen, denen ob ihrer geringen Breite die Markierung in der Mitte fehlte und leider auch Schilder, die 40-Tonnern verbot, diese Straßen zu benutzen.
Als der erste auf mich zuhielt, steuerte ich soweit wie möglich an die rechte Seite und hielt an.
Ein Hupen hinter mir ließ mich die Augen wieder öffnen.
Dabei fuhr ich die zweitschmalste Wohnmobilausführung, breitenmäßig unter mir kamen nur Campingbusse wie der berühmte Bulli von VW, alle anderen Camper waren breiter als mein Kastenwagen.
Um meinen Puls zu entschleunigen, pausierte ich in einer Feldzufahrt, fotografierte Mohnblumen und maß aus Spaß in Ein-Meter-Schritten die Straßenbreite. Von der einen bis zur anderen Seite benötigte ich fünf Schritte. Die Breite meines Gefährtes betrug zwei Meter fünf. LKW dürfen höchstens fünfzig Zentimeter breiter sein. Kühllastern gestattete die StVO wegen ihres Dämmmaterials fünf weitere Zentimeter. Schlechtestenfalls blieben 35 Zentimeter zwischen mir und den Entgegenkommenden. Sofern beide am Rand der Fahrbahn fuhren, reichte das.
Darauf vertrauend hielt ich bei den nächsten Lastzügen nicht mehr an, sondern stattdessen den kleineren rechten Außenspiegel im Blick, der, unter dem Großen montiert, den Straßenrand zeigte. Allmählich bekam ich den Bogen raus und zirkelte millimetergenau auf der Außenmarkierung entlang.
Retzow, Möthlow, Marzahne hießen Dörfer, durch die mich Frau Navi führte. In letzterem buhlte eine Filmtierschule mit angeschlossenem Tierpark um Besucher. Die Gans aus dem DDR-Fernsehfilm »Die Weihnachtsgans Auguste« von 1988 war hier geschlüpft und trainiert worden. Die Kühe und Pferde in Tarantinos »Inglourious Basterds« stammten aus Marzahne. Und Rennschwein Rudi Rüssel.
Brandenburg: Stadt
Das ursprünglich anvisierte Murray’sche Gross Kreutz, heute Großkreutz, verpassten mein Gefährt, Frau Navi und ich. Dafür kamen wir endlich zurück auf Route 58 und erreichten Brandenburg an der Havel. Diese Stadt mit 13 000 Einwohnern wurde an den Grenzen der Havel errichtet, das »Burg« genannte Viertel mit dem Dom befindet sich auf einer Insel im Fluss. … Die Kirche St. Katharina, gebaut 1410, enthält ein altes Taufbecken und mehrere eigentümliche Denkmäler. Den Dom, noch älter (1318), verzieren alte Statuen und Gemälde im Stil von Cranach, in seinen Gewölben sind drei Markgrafen begraben. … [Der Dom] wurde vor kurzem äußerlich durch Schinkel restauriert und neu geweiht.22
Der damals oberste preußische Baubeamte Karl Friedrich Schinkel werkelte von 1833 bis 1836 am Dom. Er rettete, was zusammenzustürzen drohte, verblendete den oberen Teil des Westgiebels in neugotischem Stil und fügte Zinnenkränze auf dem Stumpf des Südturms hinzu.
Weder den Dom, noch St. Katharina, nicht »the Gerichtshaus«, noch die angeblich beachtenswerten Stadttore, ja nicht einmal den 18 Fuß hohen Roland auf dem Markt sah ich.
Eine Umleitung führte mich stattdessen an Brandenburgs beeindruckenden Stahlwerken entlang. Riesenhafte Hallen aus rotem Ziegel, in denen es krachte und knirschte.
Auch ein paar der heute 72 000 Einwohner der Stadt erblickte ich. Vor 40 Jahren waren es noch 20 000 mehr gewesen. Nach jahrelangem Niedergang boomt Brandenburg an der Havel wieder. Großstadtmüde Berliner ziehen her, die Tesla Manufacturing Brandenburg SE hat sich hier niedergelassen. Ich blieb nicht. Neunzig Kilometer hatte ich in zweieinhalb Stunden geschafft. Knapp 100 lagen noch vor mir. Es war 16 Uhr. In 150 Minuten schloss die Schranke.
Die nächste Murray’sche Wegmarke Genthin lag bereits in Sachsen-Anhalt. Murray empfiehlt hier das Hotel »Goldener Stern«. Gibt’s immer noch. Heißt jetzt: »Stadt Genthin«. Außerdem wusste Murray zu berichten, dass an Genthin ein Kanal vorbeiführt, der Elbe und Havel verbindet, stimmt nach wie vor. Ich wusste über Genthin schon als DDR-Kind: Genthin ist die Waschmittel-Stadt.
1921 errichtete die Düsseldorfer Firma Henkel hier ihr erstes Zweigwerk, damals die modernste Waschmittelproduktion Deutschlands. Unter dem Namen der bekanntesten Henkel-Marke wurde das Werk ab 1949 in der neu gegründeten DDR weitergeführt: Als VEB Persil-Werk Genthin. Trotzig behauptete der nun deutsche demokratische Waschmittelhersteller in der Werbung: »Persil bleibt Persil«, bis das die westdeutschen Markeninhaber verboten. Die nun schlicht als VEB Waschmittelwerk Genthin firmierende Produktionsstätte sorgte weiterhin für die Sauberkeit sozialistischer Wäsche, ab 1968 mit einer SPEzialEntwicklung, kurz SPEE. 1990 kam Henkel zurück, machte SPEE im Gesamtland bekannt und verließ 2009 die Stadt. Waschmittel wurde in Genthin weiterhin produziert, durch eine zur Hansa Group gehörenden Firma, bis 2015 die Muttergesellschaft insolvent ging.
Drei Örtchen später fuhr ich beinahe durch Burg. Eine geschäftige und blühende Stadt mit 11 000 Einwohnern, ein Siebtel davon arbeitet in Tuchmanufakturen, die von ausgewanderten französischen Protestanten gegründet wurden.24 (Diesen Satz bitte merken! Wir kommen später darauf zurück.) Die Zeiten der Tuchmacher sind in Burg längst vorbei. Das heute bekannteste Produkt der Stadt gehörte zu meiner Bordverpflegung: Knäckebrot. Weil die B1 südlich um Burg herumführt, sah ich von der Stadt nur zwei Doppelkirchtürme, die in den Himmel piekten.
Gleich darauf war es halb sechs und ich dort, wo ich noch nie war: in Magdeburg. Ein lebensgroßer Tyrannosaurus Rex begrüßte mich. Er sollte an der Kreuzung Jerichower-/Herrenkrugstraße Menschen in die Ausstellung »Dinosaurier – Im Reich der Urzeit« locken, einer Sammlung grüngrau angemalter Plastikskulpturen.
Das durch die Windschutzscheibe herauszufinden, hatte ich ausreichend Zeit. In Gesellschaft zahlloser Magdeburger, deren Übernachtungsplatz nicht bald von einer Schranke verschlossen wurde, stand ich in brütender Hitze auf der B1 herum.
Zum Zeitvertreib studierte ich an den Laternenpfählen die Plakate der Magdeburger Gartenpartei. Unter einer apricotfarbenen Rose, dem Parteisymbol, verkündete man die programmatische Ausrichtung: »Für eine dunkelgrüne Politik«. Derweil sprang die nächste Ampel auf Rot. Deutlich schneller als ich kam die Uhr voran. Sie zeigte 17:42.
Um 17:52 hatte sich die Situation deutlich verbessert. Statt in praller Sonne stand ich im Schatten. In einem Tunnel nämlich und sah nun gar nichts mehr von Magdeburg. Das blieb im Wesentlichen so, da ich ab 18:12 über die stadtseits von Lärmschutzwänden gesäumte B71 und B189 nordwärts raste.
18:24 erreichte ich den Orteingang Jersleben.
18:29 passierte ich die Schranke des Erholungscenters Jersleber See. Und erfuhr, dass der Platzwart jeden Abend bis sieben Dienst schiebt. »Hättense ja anrufen können!«
Stimmt.
Ich war schon in Einkaufscentern, Erlebniscentern, ja sogar beinahe mal im Centerparc gewesen. Aber noch nie in einem Erholungscenter. Das Erholungscenter Jersleber See erinnerte mich an die Ferienhaussiedlung Ryonggang im Westen Nordkoreas. Hier wie dort verhindert eine Umfriedung unkontrolliertes Eindringen. Hier wie dort bewachen – damit sich die Insassen ungestört erholen können – Sicherheitskräfte das Areal. Was die Anlagen unterschied: Der Schutzzaun in Jersleben erreichte mit knapp zwei Metern nur die Hälfte der Schutzmauer in Ryonggang, die Jerslebener Sicherheitskräfte waren über-, die Ryongganger untergewichtig und in Jersleben trug man keine Gewehre.
Außerdem kam in Ryonggang Wasser aus heißen Quellen direkt ins Hotelzimmer, in Jersleben musste man selbst zum Wasser gehen. Eine ehemalige Kiesgrube, deren Inhalt in den Jahren 1928–37 half, die Dämme des in unmittelbarer Nähe vorbeifließenden Mittellandkanals aufzuschütten, bot Schwimmern, Seglern und Anglern die Gelegenheit zu tun, was ihre Bezeichnung vermuten lässt.
Bei Magdeburg: Camping-Romantik
Strandbad und Campingplatz nahmen etwa die Hälfte des Seeufers ein und Dauercamper mehrheitlich den Campingplatz. Mich schickte der Platzwart zur Wiese für Kurzcamper. Dabei bin ich fast Eins neunzig.
Vorsichtig parkte ich rückwärts ein. Gar nicht sehr schwer, eine Rückfahrkamera half mir, nichts umzufahren. Aus dem Gepäckraum unterm Heckbett holte ich den von Freunden geliehenen Campingklapptisch hervor, den mitgemieteten Campingstuhl und – aus eigenem Besitz – ein Klapphöckerchen für die Beine. Ich setzte mich. War angekommen. Hatte Hunger. Musste auspacken. Sollte baden gehen. Oder duschen oder beides. Stattdessen starrte ich vor mich hin.
Was hinter mir lag, fühlte sich falsch an. Zwar war ich durch jeden von Murray beschriebenen Ort gekommen, ausgenommen Potzdam, wofür es gute Gründe gab, und Großkreutz, was vermutlich kein Verlust war. Wirklich gesehen hatte ich wenig. Reisen wir nicht deswegen? Um zu sehen? Oder hatte ich doch alles richtig gemacht, weil ich angekommen war? Geht es ums Ankommen?
In Magdeburg zum Beispiel?
Wo ich gar nicht ankam. Nur durchfuhr.
Immerhin etwas von Magdeburg hatte ich gesehen: einen Dinosaurier und die Plakate der Gartenpartei.
»Hunger!«, knurrte mein Magen und beendete fürs Erste tiefgründige Grübeleien.
Wollte ich essen, musste ich den Inhalt der dazu gebuchten Küchenkiste auf drei Schubladen verteilen. Besteck, Ess- und Kochgeschirr bekam ich darin geradeso unter.
Im Licht der Abendsonne deckte ich meinen Campingtisch und kredenzte käsebelegtes Pumpernickel, Weintrauben und den übrig gebliebenen Salat aus dem Rasthaus Zum Goldenen M. Da gibt’s ja auch Gesundes.
Gepacktes gab’s zuhauf in meinem Camper.
Für Kleidung standen zwei mal drei Klappfächer über dem Bett und eines über der Sitzbank zur Verfügung. Für Hemden war zwischen Küchenblock und Bett ein Handlang breiter und – je nach Vergleichsperson – brust- oder bauchnabelhoher Schrank vorgesehen, dessen Tiefe zu gering für normale Bügel war. Ich drehte die Bügel in die Diagonale und drückte die Schranktür kräftig zu. Siehe da, es passte, da die Tür die Bügel in die richtige Länge brach.
Alle Jacken und Schuhe stopfte ich ins Dachfach über dem Fahrersitz, Sonnenschutz- und Mückenmittel legte ich griffbereit. Und die beiden Murray-Bände auf den Beifahrersitz.
Rätselhaft blieb, wo ein zweiter Mitreisender seine Sachen unterbringen sollte. Davon abgesehen, dass mein Sechs-Meter-Reisemobil mit Schlafplätzen für sieben geordert werden konnte, obwohl während der Fahrt nur vier Personen darin sitzen durften. Mysteriös, dieses Campen. Auch bettbezüglich.
Eine der ersten Beschwerden eines Engländers bei der Ankunft in Deutschland wird gegen die Betten gerichtet sein. Es ist daher wichtig, ihn vorher auf das volle Ausmaß des Elends hinzuweisen, dem er dabei ausgesetzt sein wird23, warnt Murray unter der Überschrift Deutsche Betten. Nun ist mir als Deutscher nicht nur die deutsche Art zu nächtigen geläufig, ich ziehe sie sogar der englischen vor. Unzählige Nächte hatte ich frierend unter dünnen britischen Laken und den darüber liegenden Wolldecken gelegen, deren Aufgabe anscheinend nicht war zu wärmen, sondern zu kratzen. Ich mag Steppdecken. Zwei eigene führte ich mit. Um keinesfalls zu frieren. Und weil ich im Laufe der Reise mit Übernachtungsbesuch rechnete.
Auf der Website des Vermieters veranschaulichte eine »Nachtmodus« genannte Zeichnung des Wohnmobilinneren, wie auf der an vier Gurten hängenden Liegefläche zu schlafen sei: quer zur Fahrtrichtung. Kaum lag ich unter meiner eigenen Bettdecke wie vorgeschrieben, zog mich etwas Richtung Hecktüren. Ich versuchte mich durch Anwinkeln eines Knies abzustützen. Es rumste. Die Liegefläche stieß gegen die Führungsschienen der Gurte, an denen sie hing. Rumsend ruckelte ich mich in eine andere Position. Wieder zerrte eine unsichtbare Kraft an meinem Körper. Die Schwerkraft. Meine Behausung stand schief. Deshalb also die Keile in der Zubehörkiste im Laderaum. Mit den Hinterrädern hätte ich darauf fahren müssen, bis ich waagerecht stand. Zu spät.
Vorsichtig, damit ich die Nachbarn nicht wachrumste, stopfte ich mir mein Kopfkissen zur Stabilisierung zurecht.
Da gab die Wand hinter meinem Kopf nach.
Ich tastete umher. Fühlte Falten. Und Glätte, wo Falten hätten sein müssen. Die Leseleuchte setzte das Unheil in grelles LED-Licht. Mein Kissen hatte die Jalousien vorm Seitenfenster eingebeult. Ich zupfte und klopfte sie in ihre Ziehharmonikaform zurück. Sorgte für Sicherheitsabstand zwischen Fenster und Kissen. Schaltete das Licht aus. Ließ den Kopf sinken. Streckte die Beine.
Die fußwärtige Wand gab nach.
Licht an.
Das Malheur gegenüber war noch größer. Meine Füße hatten der Jalousie ein vollständiges Lifting verpasst. Faltenlos wölbte sie sich nach außen. Ich reparierte den Schaden und legte mich längs. Rechts.
Auf der Küchenseite war die Liegefläche auf einer Breite von einem halben Meter zehn Zentimeter länger. Um ja nicht in die Jalousie des Heckfensters zu geraten, rückte ich so weit wie möglich nach unten. Flatsch!
Eine H-Milch-Packung war vom Kleiderschränkchen auf die Abdeckung der Spüle geklatscht. Ich zog die Füße an. Zusammengekauert und bewegungslos würde ich einfach warten, bis es hell wurde.
Allmählich sammelte sich Blut in meinem Kopf. Hinten stand ich ja tiefer.
Ohne Rücksicht aufs Rumsen bettete ich mich diagonal. Der Kopf in der Ecke von linker Seitenwand und Badwand, die Füße in der Ecke zwischen Hecktür und rechter Seitenwand. So ging’s. Das Blut floss wieder ab.
Stille umfing mich. Und Frieden.
Bis der Kühlschrank losbrummte.
Distanz: 207 km