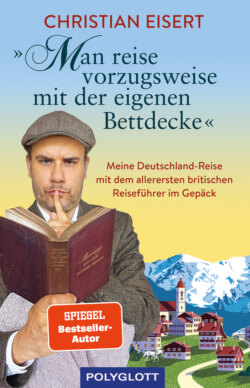Читать книгу "Man reise vorzugsweise mit der eigenen Bettdecke" - Christian Eisert - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
BERLIN – KÖLN II
OSTEN, WESTEN, KUSCHELBESTIEN
ОглавлениеSieben Uhr Abfahrt, über Magdeburg, Eichenbarleben, Erxleben, Helmstedt, Königslutter, Braunschweig, Immendorf, Lutter am Barenberg, Seesen, Bad Gandersheim, Mühlenbeck, Eschershausen, Holzminden, Höxter, Brakel, Driburg bis zu einer laut Murray sehr alten und düsteren24 Stadt.
Dieser Plan für den Tag fiel mir sofort ein, als ich gegen acht erwachte. Schwitzend. Die Sonne begann den Blechkasten aufzuheizen. Ansonsten hatte ich erstaunlich gut geschlafen, besonders, nachdem ich den Kühlschrank auf die niedrigste Kühlstufe gestellt hatte, was seine Schweigezeit deutlich verlängerte.
Ich zog mich aus und an, öffnete verschiedene Fenster und die große Seitentür. Schwülwarme Luft strömte herein. Ich schaltete kurz die Zündung an, das Ducato-Display zeigte um acht eine Außentemperatur von 22 Grad. Das ließ Schlimmes für den Tag befürchten. Ich setzte Kaffeewasser auf. Schüttete Haferflocken in eine Schüssel. Den Tisch hatte ich gestern Abend, ohne ihn zusammenzuklappen, unters Bett und übers gefaltete Fahrrad gezwängt. An mein Wohnmobil gelehnt mümmelte ich Müsli in der Morgensonne.
Gestern stand der Tag ganz im Zeichen des Ankommens. Des Ankommenmüssens. Für den ersten Tag war es gut gewesen zu wissen, wo er enden würde. Es war gut gewesen, einen sicheren Platz zum Schlafen zu haben.
Wenn ich es dabei beließ, dass Magdeburg mir abgesehen von Erkenntnissen über Parteienlandschaft und Ausstellungswesen bis auf Weiteres fremd bleiben würde, konnte ich die verlorene Zeit hereinholen.
Nur, war das nötig? Wieso hetzte ich?
Reiste ich nicht um des Unterwegssein willen?
Gut, ein paar Wegmarken galt es zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erreichen. Am kommenden Wochenende sollte ich idealerweise im Taunus sein, weil ich dort arbeiten wollte. Kurz vor Ende der Reisezeit war ich in Dresden verabredet. Ansonsten … bestimmten das Was zwei Reisehandbücher aus dem 19. Jahrhundert, das Wann bestimmte ich.
Heute musste ich nicht, heute Abend wollte ich in der von Murray beschriebenen engen und düsteren Stadt sein. Ob ich sie erreichte, würde sich zeigen. Wo ich schlafen würde auch. Nein, das wusste ich. In meinem Hängebett. Unter meiner eigenen Bettdecke. Nur wo, blieb offen.
Reisen heißt nicht allein, einen Ort zu erreichen. Ihn zu besichtigen. Ihn abzuhaken. Reisen heißt in gleichem Maß, fremde Kulturen, fremde Menschen kennenzulernen. Schon bei seiner ersten Erkundung des Kontinents 1829 ließ sich der junge Murray voller Neugier darauf ein.
Als ich in Weimar ankam, hatte ich die Ehre und das Vergnügen, dass mir ein Treffen mit Goethe, dem großen Dichter und Philosophen, ermöglicht wurde, um mit dem rüstigen alten Mann ein persönliches Gespräch zu führen. Er empfing mich in seinem Atelier, das mit Abgüssen der Elgin-MarbelsIV und anderen Werken griechischer Kunst dekoriert war. Unter seinem braunen Morgenrock schimmerte das strahlende Weiß eines sauberen Hemdes hervor; eine unter deutschen Philosophen nicht übliche Eleganz.25
Ich schlenderte hinüber in den Dauercamper-Bereich.
Kniehohe Jägerzäune grenzten die Parzellen voneinander ab. Wohnwagen und Vorzelt ergänzte vielfach ein grüner Wellblechschuppen, der die unzähligen Gartengeräte beherbergte, die die Pflege von 80 Quadratmetern Campinggrund anscheinend erfordern. Um ihre Sitzgruppen formschön einzurahmen und jeden Quadratzentimeter Rasenfläche zu nutzen, hatten manche eine weiße Pergola errichtet oder kleine Pavillons gezimmert.
Als ich bei Parzelle 121 ankam (möglichweise war es auch eine andere), hatte ich die Ehre und das Vergnügen, jemanden zu treffen, dessen Anwesen mit Gipsskulpturen und anderen Werken deutschen Kunstgewerbes dekoriert war.
Offenbar starrte ich sie zu lange an, denn aus dem Vorzelt zwängte sich ein rüstiger alter Mann, der über seiner gebräunten Haut ein strahlend weißes Unterhemd trug,eine unter hiesigen Dauercampern nicht übliche Eleganz. Diemeisten Männer über 70 patrouillierten in kurzen Turnhosen und mit freiem Oberkörper über den Platz.
»Kann ich helfen?«, murrte er und kratzte seinen Bauch.
»Ich bewundere Ihre Gartenzwerge«, sagte ich, weil ein Kompliment Leben retten kann.
Er sah auf die bärtigen Männlein herab. »Die sind von meiner Frau. Ich mag die eigentlich nicht.« Er rückte einen gerade. »Aber ich mag meine Frau.« Er verschwand wieder hinterm Fliegenvorhang.
Da ich in den nächsten Wochen Stunde um Stunde hinterm Steuer sitzen würde, sollte ich jede Gelegenheit zur körperlichen Ertüchtigung ergreifen. Badehosenbekleidet spazierte ich zum Strand, der eine Hangneigung aufwies, die man am Meer Steilküste genannt hätte. Rutschend erreichte ich den See und schwamm darin herum.
Anschließend zog ich mich zum dritten Mal an diesem Morgen um und begann die Wanderung zum Sanitärgebäude.
Den Zustand der Duschkabinen kannte ich schon vom Vorabend. Hier wurden Fungiphile froh. Fungiphobe weniger. Fungizide hätten viel bewirken können.
Bis mein Mobil reisefertig war, brauchte ich eine Weile, auch, um die an einer der Hecktüren angebrachte Fahrradbefestigungsapparatur zu verstehen und mein Drahteselchen dort zu verzurren. Erst halb zwölf kam ich los. Und nicht weit. Heute würde es keinen Termindruck geben. Kein Müssen. Heute gab es nur Wollen. Wissen wollen und sehen wollen.
In Dahlenwarsleben fing ich damit an. Dort steht eine dicke Kirche. Sie heißt St. Lamberti. Wenn es 12 Uhr ist, schlägt die Kirchenglocke zwölfmal.
Zugegeben, Dahlenwarsleben erweiterte mein Wissen nicht wesentlich. Aber man soll sich nicht überfordern. Überforderung frustriert.
Nach fünf motivierenden Minuten Dahlenwarsleben stieg ich in mein Wohnmobil ein und nach weiteren fünf Minuten wieder aus. In Hohenwarsleben. Wichtiger Unterschied: Der erste Ort gehört zur Gemeinde Niedere, der zweite zur Gemeinde Hohe Börde.
In Hohenwarsleben besichtigte ich anstelle einer Kirche ALDI und EDEKA. Mein Proviant bestand im Wesentlichen aus von zu Hause Mitgebrachtem. Ich kaufte ausreichend Getränke und Lebensmittel für morgens, abends und das eine oder andere Mittagsmenü. Das heutige erwarb ich an einem Grillwagen. Einen halben BroilerV und Kartoffelsalat. »Is’ selbstjemacht, ohne Schemie«, behauptete die Verkäuferin, in einem Dialekt, der, schreibt man ihn, Berlinerisch aussieht, aber eher sächsisch klingt. Womöglich hätte dem Kartoffelsalat der eine oder andere Konservierungsstoff gutgetan. Jedenfalls scheiterte kurz nach seinem Verzehr mein Plan, heute nicht müssen zu müssen.
Mangels anderer nutzte ich meine Toilette. Zum ersten Mal seit ich losgefahren war. Sie nahm die rechte Seite meines der Beschreibung zufolge »Kompaktbad« heißenden Hygieneraumes ein.
Die Längsachse des Sitzschüsselovals war nicht in die Mitte des Räumchens ausgerichtet, sondern fast im rechten Winkel zur unmittelbar anschließenden Seitenwand. Bei geschlossener Tür war ich gezwungen, quer auf dem Oval Platz zu nehmen. Wegen des im Vergleich zu handelsüblichen Heimklosetts deutlich geringeren Schüsseldurchmessers und der männlichen Anatomie verursachte Quersitzen Quetschungen. Durch Öffnen der Kompaktbadtür und Unterbringung der Beine im Küchenbereich gelang es mir, annährend längs auf dem Schüsseloval und damit schmerzfrei zu sitzen. Bonus: Ich konnte durchs große Seitenfenster hinausgucken. Das Ehepaar, das zu dem Wagen neben mir zurückkehrte, guckte in die Gegenrichtung.
Ich grüßte freundlich und wartete mit den nach Geschäftsabschluss erforderlichen Handgriffen, bis sie ihren Einkauf verstaut hatten und losfuhren.
Frau Navis Aufgabe bestand heute zunächst darin, mich auf die B1 zurückzuleiten. Das gelang ihr gut, wenngleich sie gelegentlich durch Ansagen irritierte wie: »Fahren Sie im Kreisverkehr geradeaus«.
Kurz nach Hohenwarsleben erreichte ich wieder die B1 und damit Murrays Route 58. Erste Wegmarke: Eichenbarleben. Dort gibt es ein höchst anheimelndes Hotel.26 Dergleichen kann ich nach Durchfahrt nicht bestätigen, alternativ besteht die Möglichkeit der Einkehr in die »Fleischerei Ingeborg Frost«.
Die Börde ist das fruchtbarste Getreideland in Deutschland. Wenngleich es eine offene und unscheinbare Landschaft ist, die kaum Hecken oder Bäume aufweist29.
Aus der Luft betrachtet gleicht die Börde einem Patchwork-Tuch. Viereck an Viereck. Nirgends wächst Wald. Der Löss-Boden zwischen Elbe, Saale, Ohre und Bode ist zu kostbar, um ihn an Bäume zu verschwenden. 1934 wurde der Acker eines sogenannten Reichsspitzenhofes in Eickendorf, in der südlichen Börde, zur deutschlandweiten Referenz für Ackerqualität und bekam die Bodenwertzahl 100.27 Nirgends war die Erde fruchtbarer. Nach Deutschlands Teilung brauchte der Westteil einen eigenen Referenzwert für die Ertragsfähigkeit landwirtschaftlicher Flächen – er beeinflusst die Höhe von Abgaben und Zuschüssen – und fand sie in der Hildesheimer Börde. Inzwischen nimmt Eickendorf wieder den besten Bodenwert des Landes für sich in Anspruch.28
Zwei Stunden waren wir nun unterwegs. Frau Navi, mein Gefährt und ich. Felder bis zum Horizont in sanften Wellen. Als wäre das Patchwork-Tuch, eben aufgeschüttelt, im Senken erstarrt. Großsantersleben, Schackensleben, Rottmersleben, Nordgermersleben, Tundersleben …
Was die Orte, die wir durchfuhren, offensichtlich verbindet, hat nichts mit dem Gegenteil von Tod zu tun, sondern mit dem mittelhochdeutschen lev/löw. Seine Bedeutung blieb im englischen leave erhalten. Zurücklassen. Hinterlassen. Überlassen. Weshalb der erste Teil der Ortsbezeichnung oft auf einen Namen zurückgeht. Ein hinter- oder überlassener Hof war nicht selten Keimzelle für Dörfer und Städte.
Erzleben, in Preußen29, mehr Worte hatte Murray nicht übrig für den Ort, den er falsch hörte oder notierte. Urkundlich erwähnt erstmals im Jahr 958 als Inarraxluuu. Worin sich luvu, ebenfalls aus der lev/löw-Sprachfamilie, verbirgt und der Name des Ortsgründers Arrax, auf Neuhochdeutsch Erich. Vor mir lag also Erichs Hinterlassenschaft.
Wie alle anderen -leben zuvor, wollte ich Erxleben durchfahrend anschauen. Es standen genug andere Orte auf dem Tagesplan, denen sich Murray ausführlich widmete. Insbesondere die düstere Stadt am Ende der Etappe.
Recyclinghof, Star-Tankstelle, Edeka Hoffmann …
»Ui!«, trat ich hefig in die Bremsen. Mein ungewaschenes Geschirr in der Spüle schepperte. Ich ließ den Blick über die Rückspiegel huschen, blinkte und erwischte geradeso die Einfahrt in eine Nebenstraße. Was war denn das hier mitten in Erxleben?
Leberwurst. Grobe Bauernleberwurst. Breitgeschmiert. Daran erinnerten in Farbe und Struktur die Fassaden von … ja, was?
Kirche? Burg? Schloss? Kriegsfilmkulisse?
Keine Kulisse. Aber ein Schloss auch nicht. Sondern zwei. Stammsitz derer von Alvensleben. Niederdeutscher Adel.
An einem adlergekrönten Obelisken vorbei schlenderte ich über eine Wiese auf einen unbefestigten Platz. Rechts ragte ein aus Feldsteinen gemauerter Turm auf, an den sich das kaum halb so hohe Kirchenschiff klammerte. Geradeaus und links umgaben mich die drei Stockwerke hohen Leberwurstfassaden. Ehemalige Wohngebäude, Stallungen, Scheunen. Rote Ziegeldächer darauf. Einige neu, die meisten nicht. Stattdessen Löcher darin, zur Hälfe eingestürzt. Nur die Kirche war frisch renoviert. Der fenster- und schmucklose Turm passte stilistisch nicht dazu. Kein Wunder. Er wurde rund 300 Jahre früher als Hausmannsturm gebaut. Hausmänner (oder Türmer) dienten in diesem Ausguck dem Wohl von Burgen, Dörfern und Städten. Moment einmal! Darüber schrieb jemand. Unter dem Stichwort Feuerwache.
Der höchste Turm oder Kirchturm einer deutschen Stadt ist normalerweise besetzt von Wächtern, die Tag und Nacht Ausschau halten, um Feuer zu entdecken und Alarm zu schlagen, sobald es irgendwo ausbricht. … Aufgrund der allgemeinen Verwendung von Holz als Baustoff sind Brände [in Deutschland] häufiger und zerstörerischer als in England; wo jedoch eine solche Einrichtung überaus wünschenswert wäre.30
Schon vom Vorgänger, dem Turm der nicht mehr existierenden Burg Erxleben, hielt man hier Ausschau nach Feuer und Feinden. Mir drohte Unheil allenfalls vom geriatrischen Gemäuer.
Das stetig im Blick und sprungbereit, falls mich ein Stück Schloss zu erschlagen trachtete, wagte ich mich in einen bröckelnden Durchgang. Im Hof dahinter Schuttcontainer, gelbe Absperrbänder und eine sechsköpfige Kommission. Die bestand aus Herren in Hemden und Damen in Blusen, die sich um eine Grube gruppiert hatten. Einer der Hemdherren beendete gerade eine Rede und alle guckten in die Grube. Ob darin Spenden- und Fördergelder verschwanden?
Die von Alvenslebens verschwanden 1945 aus Erxleben, nach fast 800 Jahren, die sie dort lebten. Zunächst war es die rote Erblinie. Nachdem die 1554 ausstarb, übernahmen schwarzer und weißer Familienzweig die Schlossanlage. Jeder bekam die Hälfte. Die einen bauten um (Schloss II), die anderen wegen Baufälligkeit ihres Schlosses 1782 ein neues: das Barockschloss (Schloss I). Hier residiert heute eine regionale Verwaltung. Ihre Parzellen teilten schwarze und weiße Alvenslebens nicht durch ein Jägerzäunchen, sondern mittels Mauer. Statt grüner Wellblechschuppen standen beiden ausreichend Nebengebäude für ihr rasenmähendes Vieh, Futter und Getreide zur Verfügung. Anstelle von Gartenzwergen hütete man einen Goldreif (Schloss II) und einen gotischen Kelch (Schloss I). Beide Familienreliquien gehören seit 1945 zum Halberstädter Domschatz. Und was anderswo das gemeinsam genutzte Sanitärgebäude war, war in Erxleben die Schlosskirche. Die errichteten beide Familienzweige ab 1662 zusammen. Einen Turm brauchte man nicht, der stand ja schon da. 1945 machten Sowjetsoldaten das Kirchengestühl zu Feuerholz, auch in den Schlössern wüteten sie. Da waren die Alvenslebens schon geflohen. Bis 1984 diente Schloss II, das alte, noch als Schule, dann verfiel es.
Erxleben: Schloss 1
Ich verfiel in Laufschritt, denn in zweieinhalb Stunden hatte ich erst 35 Kilometer geschafft. Zweihundert lagen noch vor mir. Ich startete den Diesel und treckerte weiter. Dank dünner Motorraumdämmung wusste jeder, welchen Kraftstoff ich tankte. Ich mochte den Motor trotzdem. Er hing gut am Gas, schalten brauchte ich nicht, da Automatik, und wenn dem Motor an langen Steigungen die Puste ausging, schaltete ich einen Gang zurück, indem ich kurz das Gaspedal durchtrat.
Erxleben: Schloss 2 – mit Leberwurstfassade
Zu den großen Herausforderungen der deutschen Sprache gehört für viele Ausländer die Aussprache von Ä, Ö und Ü. Die Hasenfrau beispielsweise brauchte fast zwei Jahre, um schön »schön« zu sagen. Ä, Ö und Ü in ausländischen Büchern sind mangels Lettern oftmals eine noch größere Herausforderung. Für Mörräi war es keine. Er schenkte Helmstedt ein ä, wo gar keines hingehört: Helmstädt … Der Weg dahin ist abscheulich, fast völlig vernachlässigt.31
Das ist vorbei. Auf diesem Abschnitt der B1 hörte ich nicht das leiseste Geschirrgeschepper aus der Spüle.
Helmstedt verbinden viele dennoch mit Abscheulichkeiten.
Was die Alvenslebens 1554 im Kleinen veranstalteten, geschah zwischen Helmstedt und Marienborn rund 400 Jahre später im Großen: Das Land, zu dem beide gehörten, wurde durch eine Mauer geteilt. Die, anders als in Berlin, eigentlich ein doppelreihiger Zaun war, 870 Kilometer lang.
Einer der streng bewachten Durchlässe darin: die Grenzübergangsstelle Helmstedt-Marienborn.
Die A2, ehemalige Transitstrecke nach Westberlin, führt heute direkt an den martialischen Kontrollanlagen vorbei.
Für 70 Millionen Ost-Mark baute die DDR die Abfertigungshallen extragroß, um Reisende einzuschüchtern. Muss funktioniert haben, der westdeutsche Zweig meiner Familie erzählt bis heute mit Schaudern von den Grenzkontrollen.
Auf der B1, die hier parallel nördlich der A2 verläuft, sah ich nichts von Grenzanlagen. Nur ein großes braunes Schild. Darauf eine Kartendarstellung, die den darunter stehenden Satz illustrierte: »Hier waren Deutschland und Europa bis zum 18. November 1989, 8.30 Uhr geteilt.«
Durch die Grenzübergangsstelle strömten schon am 10. November ’89 Tausende gen Westen und ein paar in die Gegenrichtung. Bis die alte Fernstraßenverbindung nördlich davon wieder hergestellt war, dauerte es ein paar Tage.
Sommerwind rauschte durch Blättergrün. Und ein Auto über den Asphalt. Wäre das Schild nicht. Man wüsste nicht.
Die Grenzübergangsstelle Helmstedt-Marienborn überwältigt mit ihren Überdachungen, Fahrspuren, Kontrollhäuschen und Passtransportbändern mit ihrer Masse an historischem Material. Dort ist noch, was gewesen war.
Das Nichts an der B1 zeigt, was jetzt ist.
Und … was vor dem Gewesenen war. Sommerwind, Blättergrün, Autos. Bis Stacheldraht und Wachtürme kamen, Schäferhunde, Selbstschussanlagen und Landminen. 1,3 Millionen auf 870 Kilometern.
Vergangen, die Zeit der Grenzen. Fast. Aus Westen Kommende werden durch ein kleines Schild gegenüber dem großen braunen darauf hingewiesen, dass hier der Landkreis Börde beginnt.
Weder auf Englisch noch als deutsches Zitat findet man bei Murray das Wort »Ortsumgehung«. In Helmstedt kennt man dessen praktische Nutzung seit wenigen Jahren. Was mich zwang, die B1 zu verlassen, sonst wäre ich an der Stadt vorbeigebraust. Für Schusslige, die vergessen haben, in welchem Land sie sich befinden, flatterten in der Helmstedter Kleingartenanlage Harbker Straße an hohen Masten mehrere schwarz-rot-goldene Erinnerungshilfen.
Zur Einkehr in Helmstedt empfiehlt Murray den Erbprinz von Braunschweig. Ob der noch existierte?
Frohen Mutes brummte ich ins Stadtinnere, wo mich in der Straße Magdeburger Tor das dort stehende Tor glauben ließ, es wäre selbiges. Ich Tor!
Zwar gab’s dort mal einen Stadtausgang Richtung Magdeburg, was jetzt in Dunkelgelb parallel zu Straße steht, heißt aber Türkentor. Dabei geht es in dieser Richtung gar nicht in die Türkei, sondern zur Tischlerei Demuth. Das Tor wurde 1716 anlässlich des Sieges der Kaiserlich-österreichischen Armee über die des Osmanischen Reiches erbaut und diente als Portal des Klosters St. Ludgeri, das dem Kaiser in weltlichen Dingen unterstand.
Ob mein Geschirr in der Spüle die folgende Kopfsteinpflasterstraße überstand, konnte ich nicht kontrollieren. Da ich Ausschau hielt nach dem Erbprinz von Braunschweig. Der war, wie sich am Markt herausstellte, inzwischen kastriert worden. Das Gasthaus heißt jetzt schlicht Erbprinz. Übernachten ist nicht mehr möglich. Dafür lassen sich Bilder anschauen, denn der Erbprinz beherbergt zugleich eine Galerie. Aus Murrays Zeiten blieben das säulengesäumte Eingangsportal und der Dachreiter erhalten. (Kein Jockey, ein Türmchen!) Beide schmückten ursprünglich die Universitätskirche. Über 200 Jahre besaß Helmstedt eine bedeutende Universität. Bis die 1810 einer Verwaltungsreform zum Opfer fiel und die Kirche zum Gasthaus umgewidmet wurde. 1890 brannte es ab. Portal und Dachreiter konnten wiederverwendet werden.
Wie es sich unter den ausladenden beigen Erbprinz-Sonnenschirmen saß und aß, konnte ich mangels wohnmobiltauglicher Parklücken nicht herausfinden.
Abseits der herausgeputzten Häuser am Markt weckte Helmstedt bei mir Kindheitserinnerungen. An DDR-Kreisstädte Ende der Achtzigerjahre. Blätternder Putz, brettervernagelte Fenster, Kunstblumen in Schaufenstern leer stehender Geschäfte. Den Wegfall der Zonenrandförderung hat die Stadt nicht gut kompensiert.
Unterliegt der Namensforscher Jürgen Udolph keinem Irrtum, bedeutet Helmstedt »Stätte am Hang«32. Glaubte ich sofort, denn plötzlich ging die Straße überraschend steil bergab und mein Motor brüllte und bremste zugleich. Die Automatik hatte heruntergeschaltet, was die Drehzahl hochjagte und den Begrenzer aktivierte. Um meinen Lieblingsdiesel nicht zu überlasten, half ich per Fuß beim Bremsen.
Zu Murrays Zeiten verlangsamten spezielle Häuser das Vorankommen. Eines davon steht seit über 200 Jahren an der Kreuzung Magdeburger Tor/Tangermühlenweg. Ein Paradies für Verliebte. Die hier viel Geld lassen können. Zu Murrays Zeiten mussten das in dem kleinen gelben Haus mit den vier braunen Säulen Reisende tun.
Wer heutzutage am Föderalismus der Bundesrepublik verzweifelt und mehr Einigkeit zwischen den 16 deutschen Bundesländern wünscht, wäre damals therapiebedürftig geworden.
Etwa 300 souveräne Staaten bildeten nach dem Westfälischen Frieden 1648, der den Dreißigjährigen Krieg beendete, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Die 80 kleinsten dieser Länder zusammengenommen, hätten nicht mal zwei Drittel der Fläche des heutigen Berlins bedeckt. Besonders auf dem Gebiet des heutigen Thüringens tummelten sich Klein- und Kleinststaaten. Um Staat und Hofstaat zu finanzieren, nutzten die Landesherren zwei Haupteinnahmequellen: die waffenfähigen Männer ihres Landes an andere Armeen zu verleihen und Wege- und Warenzölle zu erheben. Weswegen bis ins 19. Jahrhundert kaum ein Herzog, Fürst oder König den Zusammenschluss der Länder zu einer Zollunion wollte. Anders Händler, die zum Beispiel auf der Strecke Köln–Königsberg achtzig Mal Zoll entrichten mussten. Murrays Handbuch vermeldet diesbezüglich Positives: Bis vor wenigen Jahren … war der Reisende den Unbequemlichkeiten von Zöllen an der Grenze jedes noch so unbedeutenden Staates ausgesetzt …. Zur Förderung des Handels hat sich neuerdings ein Verein unter der Führung Preußens gebildet.33
In Folge des Wiener Kongresses 1814/15, der nach der Niederlage Napoleons die Grenzen Europas neu ordnete, ordnete Preußen sein Wirtschafts- und Finanzsystem inklusive Zollwesen neu. Ab 1818 wurden Zölle nur noch an den Außengrenzen Preußens erhoben. Nach diesem Vorbild schlossen sich einige deutsche Staaten am 1. Januar 1834 zu jenem Verein zusammen, dessen Vorzüge Murray preist: den Deutschen Zollverein. Die Staaten sind Preußen, Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden, Hessen-Darmstadt, Kassel, Nassau, Frankfurt am Main und andere kleinere Fürstentümer. Diejenigen, die sich bis heute weigern dem Handelsbund beizutreten, sind Hannover, Braunschweig, Mecklenburg, Holstein und die Hansestädte.37
Helmstedt gehörte Ende der 1830er-Jahre zum störrischen Herzogtum Braunschweig und lag direkt an der Grenze zur preußischen Provinz Sachsen und damit zur Deutschen Zollunion. Weshalb Murray zu Helmstedt anmerkt: Auf dieser Etappe stößt man auf das preußische Zollhaus.34 Bis 1840 mussten Reisende in dem kleinen gelben Haus auch die Nutzungsgebühr für die Staatsstraße Helmstedt-Magdeburg entrichten.
Heute kann, wer möchte, hier den Wegezoll auf der Straße in die Ehe entrichten. Im Alten Zollhaus befindet sich ein Brautmodengeschäft. Hätte ich dort für eine Zukunft zu zweit einkaufen wollen, stand ich am falschen Tag vor der Tür. Mittwochs ist zu.
Seit zwei Tagen fuhr ich ab Mittag gen Westen. Demzufolge knallte die Sonne vier Stunden durchs linke Seitenfenster – das, an dem ich saß – dann kam sie den Rest des Tages von vorn. Die Klimaanlage kühlte bestmöglich, Schatten spendete sie keinen.
Mein linker Arm, am meisten der Sonne ausgesetzt, glühte, die Wangen spannten und am Hals brannte die Haut.
Ich lenkte bereits seit einer Weile abwechselnd einhändig. Den nicht lenkenden Arm schob ich zwischen Rückenlehne und meinen Rücken, das verlieh mir von vorn das Aussehen eines bekannten Glücksspielautomaten.
Helmstedt: Altes Zollhaus an der alten Fernstraße
Nicht die einzige Mühsal. Die charmante Idee, meine gesamte Reise murraykonform auf Landstraßen zu absolvieren, hatte ein paar Schwächen. Beschleunigte ich nach Verlassen einer Ortschaft auf 80 oder 90 gar, kam bald ein Abzweig, um den herum 70 galt, dann waren wieder 100 erlaubt, bis eine scharfe Kurve 60 zu fahren verlangte, das folgende 100er-Stück Gas zu geben, lohnte kaum, denn der nächste Ort lag in Sichtweite. Dort forderten 30er-Zonen zusätzlich Aufmerksamkeit, besonders, wenn sie nur zu bestimmten Tageszeiten galten. Wie in einem Realität gewordenen Nintendo-Spiel musste ich ständig auf neue Herausforderungen reagieren. Inzwischen war ich auf Level zwei, in dem LKW für weitere Komplikationen sorgten, da sie, wenn überhaupt, die Tempowechsel verzögert mitmachten. Darüberhinaus verdeckten ihre Aufbauten Ge- und Verbote am Straßenrand, so dass ich oft nicht wusste, was gerade galt. Ungünstig, denn anders als in Computerspielen gab’s Punkte bei Fehlern. Ich mag keine Computerspiele. Mich strengt schon digitales Solitaire an.
Mit puckerndem Kopfschmerzschädel fuhr ich in Königslutter vorschriftswidrig auf den ausschließlich für PKW vorbehaltenen Parkplatz des Kaiserdoms.
Die Kirche, ehemals im Besitz der Benediktiner, enthält Denkmäler von Kaiser Lothar und seiner Kaiserin, und von Heinrich dem Stolzen, alles Vorfahren der Familie Braunschweig. Sie wurde im byzantinischen Stil erbaut und hat einen schönen Kreuzgang, ist aber sehr baufällig.39
Ich war hinfällig. Die Schwüle machte das Atmen schwer und ließ alle, die die kleine Anhöhe zum Dom erklommen, hörbar schnaufen.
Im Schatten der alten Linden am Dom war es genauso heiß wie in der Sonne. Die dickste war angeblich 1135 von König Lothar III. aus Anlass der Grundsteinlegung für den Dom gepflanzt worden und heißt deshalb Kaiserlinde.
Im kühlen Kaiserdom, einem wuchtigen romanischen Bau mit drei spitzhaubigen Türmen, hätte ich auf- und durchatmen können. Stattdessen verschlimmerten sich meine Symptome. Zum Schädelpuckern gesellte sich Tinnitus. Ich wollte schon umdrehen, da bemerkte ich, ich war nicht der Einzige, dessen Zeigefinger im Ohr herumrüttelte.
Das Fiepen wurde fieser.
Sehr ausdauernd prüfte der Organist die nächstkleinere Orgelpfeife. Auch optisch geht der Dom an die Grenzen des Erträglichen.
Der von Murray bemängelten Baufälligkeit des Doms rückte Ende des 19. Jahrhunderts Prinz Albrecht von Preußen zu Leibe. Zur Instandsetzung gehörte, die ursprünglich farbenfrohe Ausmalung des Innenraums wiederherzustellen. Die Hofmaler von Prinz Albrecht schufen eine Neuinterpretation bunter romanischer Bildmotive.
Um 1970 drohte der Dom erneut auseinanderzufallen, man trieb Sicherungsanker ins Gemäuer und übertünchte Teile der Albrecht-Malereien. Dies und das Eindringen sauren Regens zwang in den 1990er-Jahren dazu, wieder zu sichern und zu malern. Die heute vornehmlich in Gelb, Blau und Rot gestalteten Ornamente an Wänden und Decken sind Nachbildungen der Nachbildungen des 19. Jahrhunderts.
Der Fries »Hasen fesseln Jäger« an der Außenseite der Apsis ist original, sollte aber keinesfalls Kindern unter zwölf zugemutet werden, sonst bekommen sie Albträume von kotzenden Langohrtigern.
Im Jahr 1834 war die Straße von Braunschweig nach Magdeburg in sehr schlechtem Zustand, der größte Teil davon nicht makadamisiert.39 Was den zweiten Teil des Satzes betrifft, dazu später. Was Braunschweig betrifft, ist der zweite Teil des Ortsnamens Motto. Vom Murray’schen Brunswick bleibt vor allem Schweigen. Das liegt am Zweiten Weltkrieg, in dem neunzig Prozent der Innenstadt, und damit das meiste, was Murray besuchte, zerbombt wurde. Ein Schicksal, das viele deutsche Mittel- und Großstädte verbindet. Der Unterschied besteht in ihrem Umgang damit. Durch diese vormals sehr alte Stadt an der Ocker39 kam ich flott durch, Braunschweig wurde nach dem Krieg »autogerecht« wieder aufgebaut. Neben den breiten Straßen hinterließ der Hauptbahnhof Eindruck. Ein Schuhkarton mit Vordach und italienischem Vorbild. Er ist eine verkleinerte Kopie der Stazione Termini, dem Hauptbahnhof von Rom.
Vielleicht trifft »ist inspiriert von« die Sache besser als Kopie. Oder »entstand in Anlehnung an …« Solche Phänomene finden wir zuhauf. Bei Bahnhöfen, in der Musik, in der Mode, bei Reisebüchern.
Im September 1887, fünf Jahre vor seinem Tod, erzürnte John Murray ein Artikel in der Pall Mall Gazette. Darin pries ein Journalist die Reisehandbücher des deutschen Verlegers Karl Baedeker.
Der Verfasser dieses Artikels scheint Herrn Baedeker das Verdienst zuzuschreiben, diese Buchkategorie erfunden zu haben. Er ignoriert völlig die Existenz von Murray und seinen »Handbooks for Travellers« und unterlässt jede Erwähnung derselben.35 […] Die Behauptung, diese Art von Literatur hervorgebracht und sie auf das »Niveau einer schönen Kunst« gebracht zu haben, die der Verfasser der Pall Mall den Herren Baedeker zuschreibt, würde von ihnen sicher zurückgewiesen werden, da sie zu Beginn ihrer Buchreihe immer wieder ihre Verpflichtungen gegenüber Murray anerkannten. Sie gaben nicht nur zu, dass sie seine Führer zur strukturellen Vorlage für ihre eigenen gemacht hatten, sondern dass sie in einigen Fällen direkt aus seinem Werk übersetzten.36
Schon der Titel des 1842 bei Karl Baedeker in CoblenzVI erschienenen Reiseführers erinnert an die Vorlage: Handbuch für Reisende durch Deutschland und den Oesterreichischen Kaiserstaat – Nach eigener Anschauung und den besten Hülfsquellen37.
Wer Baedeker hür vor allem half, schreibt er im ersten Satz: Die Brauchbarkeit der dem Buchhändler Murray zu London herausgegebenen Reisehandbücher (Handbook for Travellers in Northern and Southern Germany) ist eine von den Engländern, dem unter allen vorzugsweise reisenden Volke, anerkannte Thatsache, dass man kaum einen derselben ohne das sogenannte »rothe Buch« umherwandern sieht. Sie führte den Herausgeber des vorliegenden Handbuchs früher schon auf die Idee, zwei in Deutschland, trotz der Nachbarschaft, wenig gekannte Länder nach jenen Murray’schen Handbüchern für Reisende zu beschreiben.38
Bei den wenig gekannten Ländern handelte es sich um Belgien und Holland, wie eine Fußnote erklärt. Und weiter schreibt Baedeker: Beim Fortschreiten der Arbeit zeigte sich immer mehr und mehr, dass nur der Rahmen des englischen Vorbildes beibehalten werden konnte. Die Volks- und Länder-Anschauung des Engländers ist eine von der des Deutschen durchaus verschiedene. Vieles diesem Bekannte musste dem Engländer weitläuftig [sic] erzählt werden, Geschichtliche Andeutungen, diesem werthlos, dem Deutschen dagegen anregend, mussten für diesen eingefügt werden. Endlich pflegt der Engländer auch wohl anders zu reisen als der Deutsche.46
Und schon war Murray wegargumentiert. 1859 starb Baedeker. In den Ausgaben nach 1860 fehlte der Hinweis auf das britische Vorbild. Hatten die beiden Reiseführer-Pioniere anfangs gegenseitig die Werke im Land des anderen vertrieben, wurden sie Konkurrenten. Baedeker hatte die von Murray eingeführte Sterne-Bewertung und das einheitlich rote Erscheinungsbild der Reiseführer übernommen und wurde damit bekannter als sein Erfinder. Auch andere kopierten, zum Teil wortwörtlich, Murrays Handbücher. In den Law Journal Reports von 185339 füllen der Bericht über einen von Murray angestrengten Plagiatsprozess unzählige Seiten.
Es klingt ein wenig verzweifelt, wenn John Murray am Ende seines Lebens schreibt: Daher fühle ich mich verpflichtet, mir das Verdienst nicht nehmen zu lassen, das mir als Autor, Erfinder und Urheber einer Kategorie von Werken zukommt, die nach der unumstößlichen Aussage von Reisenden mehr als ein halbes Jahrhundert, für sie von größtem Nutzen und Komfort waren.40
Die Rollen in dieser deutsch-britischen Auseinandersetzung scheinen klar verteilt. Wie in den noch folgenden Weltkriegen waren die Deutschen die Bösen. Die Briten Opfer.
Typisch.
Blöd nur, dass es da einen Leopold Freiherr von Zedlitz-Neukirch gibt. Der zahlenverliebte Rittmeister aus preußischem Adel gab allerlei von seinen Reiseerfahrungen geprägte Datensammlungen heraus. 1831 erschienen bei Duncker und Humblot, Berlin in einem Band der »Wegweiser durch den Preussischen Staat, in die angrenzenden Länder und die Hauptstädte Europa’s – Ein geographisch-statistisches Taschenbuch für Geschäftsmänner und Reisende« und das »Reisetaschenbuch für Berlin und die Preussischen Staaten mit besonderer Berücksichtigung der Preussischen Bäder«.
Auf die Einleitung folgen alphabetisch geordnet kurze Abhandlungen über beispielweise: Abkunft und Abstammung der Bewohner … Arbeits-, Zucht- und Strafhäuser … Bäder und Brunnen … Buchhandel, Censur … Gends’armerie … Irrenhäuser, Juden, Klima … Taubstummeninstitute41 sowie alles über Zölle.
Der zweite Abschnitt beinhaltet viel Statistisches über Berlin. Kaum sind 199 Seiten vorbei, folgt Abschnitt drei.
Und der hat’s zusammen mit den zehn folgenden in sich.
Zedlitz beschreibt darin Reiserouten. Da geht es von Berlin nach Breslau oder nach Coblenz. In der Abfolge der Reise vermerkt er die Entfernungen zwischen den Orten in Meilen und empfiehlt Übernachtungsmöglichkeiten wie: Helmstädt: Der Erbprinz von Braunschweig, der Prinz Regent, die Stadt Braunschweig, guter Gasthof in der Vorstadt am Thore zu Königslutter.42
Touristische Empfehlungen und Einwohnerbeschreibungen fehlen ebenso wenig: Burg. Es ist ein ziemlich geräumiger Wohnplatz und gehört, ohne zu den schöneren Städten der Provinz gewählt zu werden, zu den ansehnlichsten Oertern […] Unter den Einwohnern sind sehr viele Nachkommen französischer Auswanderer … Die Tuchfabrikation wird nach wie vor stark betrieben.43
Wer sich gemerkt hat, was Murray über Burg schreibt, stellt nun erstaunliche Parallelen fest.
Natürlich kann einem Buch, das Fakten nennt, nicht vorgeworfen werden, dass die woanders genauso stehen. Dass Murrays Reiseführer und der von von Zedlitz eine ähnliche Struktur aufweisen, ist schon bedeutender, da Murray die Urheberschaft dafür in Anspruch nimmt. Mehr noch: Obige ist nur eine von mehreren fast identischen Textstellen, die über Faktennennung hinausgehen, also Schöpfungshöhe besitzen. Zufall? Fest steht: Murray besuchte ab 1829 mehrmals Deutschland und beherrschte Deutsch in Wort und Schrift.
Was Murray und von Zedlitz unterscheidet: Zedlitz hat einerseits eine auffällige Vorliebe für alphabetische Ordnung, Kategorisierungen jeglicher Art, nennt bei Orten oft seitenlang die Anzahl von Wohnhäusern, Kirchen, Plätzen, Bibliotheken, Lehrern, Invaliden, Anstalten für verwahrloste Kinder und dergleichen mehr. Andererseits gerät er immer wieder ins Schwafeln. Murray konzipierte seine Handbücher deutlich klarer und stringenter. Völlig fehlen bei ihm Sätze wie: Weiterhin bemerken wir die Hornsche Anstalt für Geisteskranke und links unfern dem Thore, etwas seitwärts sehen wir das ansehnliche Gebäude, in welchem sich das orthopädische Institut des Hrrn. Hammer befindet44. Auch die niedliche Villa des Hofschauspielers Rebenstein45 ignoriert Murray in seiner Berlin-Beschreibung. Und ebenso, wenigstens offiziell, die Existenz der »Wegweiser« von von Zedlitz.
Wie sehr ihn der Deutsche inspirierte, bleibt daher so undurchsichtig wie meine Frontscheibe kurz nach Braunschweig.
Regen pladderte aufs Dach meines Gefährts und prasselte gegen die Fenster, was das Durchgucken erschwerte. Und das Fahren. Nachdem ich alle Hebel und Knöpfe rund ums Lenkrad ausprobiert hatte, glitten die Scheibenwischer übers Frontglas, sobald ich einem der Hebel einen Stups nach unten gab. Ohne Stupsen blieben sie liegen.
Der Regen senkte die Außentemperatur um zehn auf 26 Grad. Wolken verdeckten die Sonne und ich musste nicht mehr abwechselnd einen Arm in den Schatten meines Rückens schieben. Regelmäßig den Scheibenwischerhebel stupsend, zuckelte ich mit Tempo 65 einem LKW mit Anhänger hinterher.
Zwei Kilometer, drei …
Nach vier Kilometern reichte es mir. Kaum konnte ich die Gegenfahrbahn halbwegs überblicken, setzte ich den Blinker und trat das Gaspedal durch. Der Motor brüllte auf.
»Komm-komm-komm-komm!«, feuerte ich ihn an. Schließlich musste er das Gewicht von drei vollgetankten Opel Corsa auf Tempo bringen, bei einer Leistung von weniger als zwei Corsa.
»Jajajajajaja … jaaa!« Wir schafften es, zwischen die beiden Lastwagen zu flutschen, den überholten und den, der von vorne kam.
»Fein gemacht«, tätschelte ich das Armaturenbrett meines Gefährten. Ja, es war kein Gefährt mehr!
Kopfsteinpflaster, unbarmherzige Sonne, prasselnder Regen. Mein Gefährte nahm es klaglos hin. Trug und schützte mich.
Er brauchte einen Namen.
Ich erreichte derweil Salzgitter-Thiede.
Wie sollte ich meinen Gefährten nennen. Camperchen? Camperinchen? Oder schwäbisch: Camperle?
Nein, er hatte nichts Niedliches.
Ein Name, dachte ich, als ich Salzgitter-Drütte passierte, kann die Herkunft widerspiegeln. Mein Gefährte war Italiener. Italienische Namen klingen schön. »Luutschianoo«, »Sssilviooo«, »Lu-iiitschiii!«, singsangte ich und war bis Salzgitter-Immendorf – Murray schreibt darüber nicht mehr als: Immendorf46 – der Meinung, Luigi würde passen. Sah ich in Salzgitter-Barum schon wieder anders. Mein Wohnmobil war ja zur Hälfte Deutscher. Paule vielleicht?
»Bist du ein Paule?«, fragte ich ihn in Salzgitter-Lobmachtersen. Er verneinte mit den Scheibenwischern.
In Salzgitter-Beinum wunderte ich mich zum ersten Mal, warum alle Orte den gleichen Vornamen hatten.
Es liegt daran, dass Salzgitter aus 31 Stadtteilen besteht, meist räumlich getrennte Ortschaften. Außerdem fiel mir ab Salzgitter-Bad eine besondere Grundstücksbegrenzung auf. Ganze Straßenzüge lang standen vor den Häusern im Abstand von weniger als einem halben Meter metallene Zaunfelder. Direkt davor verlief der Bürgersteig, der Platz dahinter war zu schmal für einen Vorgarten.
Waren das Salzgitter?, fragte ich mich in Salzgitter-Gitter. Dort wären ja dann die Gitter Salzgitter-Gitter-Gitter.
Nahe dem Dorf Gitter entdeckte man im Mittalter salzhaltige Quellen und so kam im 14. Jahrhundert namentlich eines zum anderen.
Ich kam endlich in einen anderen Ort: Lutter am Barenberg, wo Tilly die Protestanten unter Christian von Dänemark so vernichtend schlug, dass ihm dafür der Heilige Stuhl dankte.47 Der belgische Graf Tilly wurde im Dreißigjährigen Krieg ob seiner Siege und Härte Legende.
In mir tobte der Krieg zwischen Erschöpfung und Pflichtgefühl. Bis zu meinem Etappenziel, der alten und düsteren Stadt, waren es noch 130 Kilometer. Bedeutete bei meinem Tempo drei Stunden Fahrt. Jetzt war es halb sechs. Der Regen hatte aufgehört, die Sonne stach vom Himmel, die Erde dampfte. Den Verkehr stetig im Auge behaltend, suchte ich mit dem anderen Auge in meinem Campingführer einen Schlafplatz in der Nähe.
Im »Tatort« hätte sie als Kleindarstellerin mit Text den Kommissaren Leitmayr und Batic den Zugang zu ihrem Etablissement verwehrt: »Meine Mädchen aaalle gutte Mädchen!« Daraufhin hätte Leitmayr gesagt: »Frau Kumerowa, auch gute Mädchen können etwas beobachten.« In dem Moment würde Batic beobachten, wie eine leicht bekleidete junge Frau aus dem ersten Stock auf ein Vordach springt, weshalb er »Franz, da!« riefe und Leitmayr vorwurfsvoll sagen würde: »Fliehen gute Mädchen, Frau Kumerova?« Die würde »Pfff …« machen und den Kommissaren die Tür vor der Nase zuschlagen. Im Film.
In Wirklichkeit pfffte die Platzwartin des Campingplatzes am Brillteich nicht, sondern paffte Zigaretten einer mir unbekannten Marke. Nachdem wir die Formalitäten erledigt hatten, schnarrte sie: »Ich gähe vor, du fährst nach!«
Sie trug ein schwarzes Kleidchen, dessen Saum ihre gebräunten Oberschenkel umspielte, und eine Bierflasche, aus der sie sich ab und zu stärkte. Schließlich nickte ihr Kopf in eine Ecke und ich parkte neben einer stattlichen Tanne.
Tisch, Stuhl, Höckerchen raus. Dann Topf aufs Gas. Milch hinein, aufblubbern lassen, Topf runter, Milchreismischung dazu, umrühren, über dem Teller auskippen, Himbeeren aus dem Glas drüber. Fertig. Zum ersten Mal hatte ich im Camper gekocht!
Die Beine auf dem Höckerchen, die Lehne des Campingstuhls nach hinten gestellt, genoss ich mein Mahl im grünen Paradies am Brillteich.
In der gegenüberliegenden Parzellenreihe sah ein Dobermann zu, wie sein Herrchen den Wohnwagen kärcherte. Das Fauchen des Hochdruckreinigers war kaum zu hören, da auf der anderen Seite meines Stellplatzes jemand Rasen mähte.
Den Dobermann schien sein Kärcherherrchen zu langweilen. Er schaute umher. Was könnte ihm wohl Freude bereiten?
Sein Blick blieb an mir hängen.
Dobermänner verdanken ihre Existenz einem Zeitgenossen John Murrays: Karl Friedrich Louis Dobermann trieb Steuern im thüringischen Apolda ein und züchtete sich zum Selbstschutz einen scharfen Hund heran. Die Rasse wurde später gern eingesetzt von Polizisten, dem deutschen Heer und in Konzentrationslagern.
In weiten Sätzen jagte er auf mich zu.
Ob ein Dobermann Milchreis mochte?
Zentimeter vor meinen Zehen kam er zum Stehen. Ich setzte mich auf und sagte, was ich zu fremden Hunden immer sage: »Na, wer bist du denn?« Es ist mehr eine rhetorische Frage.
Der Dobermann kam zwei Schritte näher. Unsere Nasen waren fast auf gleicher Höhe. Damit er nicht in meine biss, bot ich ihm eine Alternative, die er beschnupperte. Bereitwillig ließ er sich von der Alternative im Nacken kraulen. Nach einer Weile schwenkte er das Hinterteil herum. Ich massierte den Rücken. Und ich erkannte, es war gar kein Dobermann. Es war eine Doberfrau. Sie presste ihren Po an meine Oberschenkel, bis ihr Herrchen eifersüchtig wurde und pfiff. Frau Dober ging weg. Und ich spazieren. Gleich hinterm Campingplatz lässt sich der Wasserweg Schildautal erkunden, ein zwei Kilometer langer Rundweg, an dem Tafeln einem beibringen, was eine Quelle ist, ein Fließgewässer und ein Wasserfrosch. Alle kann der Wasserfreund in echt sehen und hören. Das Wasser im lebhaftesten der Fließgewässer lässt sich trinken. Hab ich mich aber nicht getraut. Wer eine Jutta kennt oder gar so heißt, freut sich sicher darüber, dass hier am Neujahrs- und Johannistag eine gleichnamige Sagengestalt um Mitternacht mit einem Schlüsselbund herumklappert.
In den übrigen Nächten zeichnet die Gegend eine Stille aus, die hervorragenden Schlaf gestattet.
Distanz: 159 km