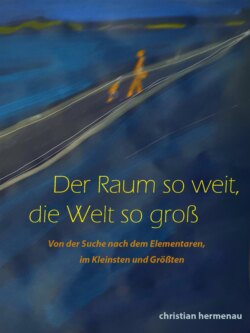Читать книгу Der Raum so weit, so groß die Welt - Christian Hermenau - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Physik heute
ОглавлениеWas hat sich seit Galileis Tagen geändert? Wie sieht die Physik heute aus? Haben wir alle Fragen nach dem Woher und dem Wohin, mit all unseren modernen Mitteln, hinreichend beantwortet? Schließlich ist die Physik zu einer der wichtigsten Wissenschaften, unserer technologischen Welt geworden. Ihre Grundlagenforschung hat zur Entwicklung zahlloser, immer raffinierterer Geräte geführt. Es wurden gewaltige Teilchenbeschleuniger gebaut, um tief in die Natur der Materie einzudringen. Aus dem einfachen Teleskop von Galilei, sind beeindruckende Apparate, mit Meter großen Spezialspiegeln geworden, die mit Hilfe von ausgefeilten Computerprogrammen, die Tiefen des Weltraums durchforschen. Inzwischen haben wir ausgereifte Theorien zu jedem Phänomen. Aber hat all das uns weiter gebracht? Kennen wir heute den Ursprung des Lebens, das Woher der Dinge und ihrem Zusammenspiel? Können wir es berechnen und lösen?
Leider nein.
Alles was wir bisher dabei geschafft haben ist, dass die Antworten immer verwirrender und vor allem immer komplizierter werden. Wir schieben einen Berg von Lösungen vor uns her, von dem jeder einzelne Ansatz und jede Erklärung der Zusammenhänge so spezialisierte Lösungen der Fragen hat, dass sie nur die entsprechenden Fachexperten verstehen - wenn überhaupt. Denn die Antworten, auch auf ungestellte Fragen, liegen in einer mathematischen Fachsprache vor, die man sich nicht mal eben so aneignet. Darum wird es auch immer schwieriger, einen Überblick zu bekommen und einen möglichen Zusammenhang der einzelnen Bereiche zu erkennen.
Die Sprache, die jeder mehr oder weniger gut versteht, die Sprache der Anschaulichkeit, das Beschreiben in Bildern und Vorstellungen, diese Sprache blieb bei den Physikern schon lange auf der Strecke. Wer heute in der Physik noch Karriere machen will, muss hervorragend in Mathematik sein. Er muss sich darin wohl fühlen und sie lieben. Wer aber große mathematische Fähigkeiten hat, kann gut im abstrakten Formalismus denken. Diese Fähigkeit wird im Studium noch gestärkt, denn anders lassen sich die komplex mathematischen Theorien meist gar nicht mehr bearbeiten. Zudem wird von einem Physiker erwartet, dass er die Formeln anwenden, also berechnen kann und nicht das er sich vorstellt was sie bedeuten. Das heißt aber auch, dass man die schlüssigen, anschaulichen Bilder wohl nicht von den Physikern bekommt. Sie vertrauen zu Recht nur ihren Gleichungen, die sie miteinander kombinieren und mathematisch umformen. Die äußerst abstrakten Ergebnisse werden dann wieder auf die Natur übertragen. Das ist aber immer kritisch zu bewerten, da die Ergebnisse nicht die Natur selber sind, sondern nur logische Zusammenhänge und Umformungen von Zeichen. Sind die Rechnungen einfach und gut zu überschauen, hängt die abstrakte Formulierung eng mit den realen Versuchsbedingungen, gut erkennbar zusammen, dann sind auch die Ergebnisse klar und übersichtlich und wir sehen mehr die Mathematik als Instrument, schneller ans Ziel zu kommen. Wir müssen nicht jede Addition mit Äpfeln und Apfelsinen überprüfen. Aber was, wenn wir uns auf Mechanismen der Logik verlassen müssen, die so kompliziert sind und so verschachtelt, dass wir sie weder richtig bei der Mathematik durchschauen noch ihren Bezug zur Wirklichkeit jederzeit intuitiv erahnen? Wenn wir nur vermuten, dass sich ein Elektron mit einer mathematischen Beschreibung so verhält, wie es die Formel vorgibt? Was, wenn wir etwas übersehen haben oder die Formel nur fast passt?
Entwickeln wir dann die Mathematik weiter und treiben unsere Rechnungen immer aufwendiger voran, mit diesen nur ein bisschen falschen Annahmen, sind dann die Abweichungen zur Wirklichkeit nur klein oder sind sie ganz falsch? Plötzlich erleben wir die Vielfalt der Mathematik, die in jeder komplexen Formel steckt. Lösungen die alle innerhalb der Logik, im Abstrakten möglich sind und vielleicht in einer anderen Welt, in einem anderen Universum verwirklicht wurden, aber die nicht unsere Welt widerspiegeln. Auf diese Weise kann man eine Theorie entwickeln, die in sich so symmetrisch und so vollkommen geschlossen und logisch ist, dass wir ähnlich wie Archimedes, lieber an den Sphärenklang der Planeten auf vollkommenen Kreisbahnen festhalten, als uns ins kalte Wasser, der chaotischen Wirklichkeit zu begeben. Auch hinter dem Chaos können einfache, leicht zu verstehende Gesetzmäßigkeiten, stecken. Hat man es mit dem Vielen zu tun, dann entsteht auch leicht darin ein heilloses Durcheinander, indem sich die Ordnung dahinter versteckt. Die Mathematik ist hervorragend darin, logische und geordnete Prozesse darzustellen. Unser Gehirn wiederum kann am besten in Bildern arbeiten und ist ständig auf der Suche nach Mustern und Veränderungen. Die komplexe Welt auf der Erde, ist nur in einigem Abstand oder tief im Detail schön geordnet. Auf der Ebene wie wir sie wahrnehmen, ist sie heillos kompliziert und unübersichtlich, ständig im Wandel, immer anders. Darauf hat sich unser Gehirn spezialisiert und nur so können wir die Umwelt erkennend erfassen und Strukturen in dem unübersichtlichen Durcheinander sehen. Unser Gehirn kann aus einer wirren Flut von Informationen, die Essenz herausziehen und planerisch damit die Zukunft gestalten. Es kann Bilder und Phantasien produzieren und sich so eine Vorstellung von der Außenwelt machen, aber dafür brauchen wir die Anschaulichkeit. Wir müssen uns die Bewegungen der Elektronen vorstellen. Unser Gehirn kann sich nicht die Bewegung die in einer Formel steckt vorstellen, es muss erst wieder übersetzt werden und dafür fühlen sich die Physiker entweder nicht genug verantwortlich oder sie können es auch nicht besonders gut, weil durch den Prozess der Mathematisierung immer mehr mathematisch begabte Physiker die Physik erobern. Zudem fehlt es meist den mathematischen Begabungen und sehr rationalen Menschen, an der Liebe zum Chaos und dem Fantastischen, dem Wunsch etwas nur unvollkommen anschaulich beschreiben zu wollen. Vielleicht muss man sich dafür an die Philosophen wenden. Vielleicht sind doch sie es, die in diese Gleichungen und mathematischen Systemen, Sinn und Anschaulichkeit bringen könnten - wenn sie sie nur verstehen würden. Vielleicht ist die Philosophie aber auch schon zu verdorben von der Logik und der Rationalität?
Physiker, sowohl experimental- als auch theoretische Physiker, suchen in erster Linie Regelmäßiges. Daraus leiten sie dann ihre gesetzmäßigen Zusammenhänge und Formeln ab. Sie versuchen die unterschiedlichsten Bereiche miteinander zu verbinden und darin das immer Gleiche zu erkennen. Können viele sehr unterschiedliche kleine Entwicklungen in einem übergeordnet Ganzen zusammengefasst werden, so spricht man von den Theorien. Sind es wichtige, übergeordnete Zusammenhänge, so führt uns dies auf die großen Theorien der Physik. Dabei spielt die Anschaulichkeit wieder nur eine Nebenrolle. Physiker können, beispielsweise alle diese auseinanderlaufenden Bewegungen im Universum zurückrechnen und kommen so zur Theorie vom Urknall, die eigentlich nur eine Hypothese ist, weil sie nicht überprüft werden kann. Sie können inzwischen auch viel darüber aussagen, was passiert, wenn Materie immer mehr verdichtet wird, aber schon da sind die Meinungen nicht mehr so einheitlich. Doch sind Physiker bei der Sinnfrage nicht die richtigen Ansprechpartner, weil die Frage des „Woher und Wohin“, sie nur in der allgemeinen Form interessiert, so wie es jeden interessiert, sie aber nicht in dem Bereich mehr Vorstellung und Ideen haben, als andere.
Die Frage nach dem Sinn des Lebens ist eine sehr persönliche Frage, die jeder für sich selber beantworten muss. Gläubige Menschen sehen in Gott die höchste Instanz. Gott ist dann die Antwort auf die Frage wo alles herkommt, aber auch was mit uns nach unserem Tod geschieht. Wir besitzen danach allesamt eine Seele, die unsere Unsterblichkeit verkörpert. Ein religiös denkender Mensch, will und sollte nicht Gott weiter hinterfragen. Für ihn endet die Suche nach dem Grund allen Seins hier. Will man noch weiter gehen, noch tiefer in die Zusammenhänge eindringen, darf man auch nicht an einem Grund für alles festhalten, sondern es fällt eher auf wie unwichtig, wie belanglos wir für das Ganze sind, und das möglicherweise das ganze Universum weniger wichtig oder unendlich ist, als wir bereit sind auszuhalten. Die Antwort darauf, was vor dem Urknall war, was bleibt, wenn alles verschwindet, hängt auch davon ab, wie viel man bereit ist zu akzeptieren. Und doch ist genau das vielleicht, für die Meisten, der eigentlich tiefere Grund, sich überhaupt mit dem Ursprung zu befassen. Wir suchen einen Sinn für das Ganze, etwas beständiges, etwas Ewiges, etwas das jeden Einzelnen zu etwas Besonderen macht. Materie, die von einer Ewigkeit ist und von einem kosmischen Geist berührt wird. Es kann sein, dass wir uns deshalb so schwer mit dem Nichts und der Unendlichkeit tun, weil damit auch so eng die Sinnlosigkeit alles Seienden verbunden ist.