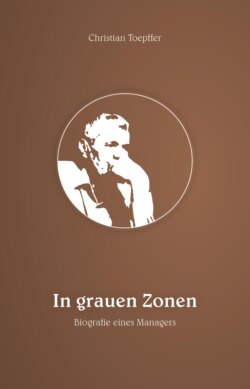Читать книгу In grauen Zonen - Christian Toepffer - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Im Archiv
ОглавлениеSeine Erinnerungen beginnen in einem Raum mit seinem Kinderbett und dem Bett seiner Mutter. Dann war da noch ein Wandschirm, hinter dem sich seine Mutter abends aus- und morgens anzog. Das Zimmer war immer dunkel, an den Wänden waren Schränke eingebaut, bis zu seiner Höhe mit Holztüren, darüber gab es Glastüren, dahinter standen Bücher. Es war ihm streng verboten, die Schränke zu öffnen, später lernte er, dass da allerlei Urkunden, Manuskripte und andere Papiere lagen, die als wichtig oder sogar als wertvoll erachtet wurden. An die Glastüren kam er ohnehin nicht heran. Wo sie ihre Sachen aufbewahrten, wusste er nicht mehr, es wird auch nicht viel gewesen sein. Auch an eigenes Spielzeug erinnerte er sich nicht, aber er konnte das kaum als Mangel empfunden haben.
Die Umgebung war Spielplatz genug. Vor dem Fenster lag eine große Wiese um ein verwildertes Rosenbeet herum. In besseren Zeiten war das ein Park gewesen, der durch einen Wassergraben von den Feldern dahinter abgegrenzt war. In dem Graben gab es Krebse, die von den geschickteren Jungen gefangen wurden, Georg begnügte sich eher mit Weißfischen, die waren zwar glitschig, aber konnten nicht kneifen. Auf den ziemlich verunkrauteten Wegen ritzten die Kinder Vierecke und Kreise in den Sand und spielten Hüpfspiele. In einer Ecke des Parks standen hohe, alte Bäume und Sträucher, dort konnte man Verstecken spielen. An einem Ast hing eine Schaukel, die Georg gerne und sehr ausgiebig benutzte, solange keines der anderen Kinder schaukeln wollte. Daneben gab es noch ein Kletterseil, die kräftigeren Jungen und sogar ein Mädchen schafften es auch, da hochzuklettern. Nach seinem ersten eigenen, erfolglosen Versuch übte Georg heimlich, aber er schaffte es nicht und gewöhnte es sich an, sich unter einem Vorwand zu entfernen, wenn beim Spielen Klettern angesagt wurde.
Auf der anderen Seite des Schlosses erstreckte sich ein Hof mit einer großen Linde bis zu den Wirtschaftsgebäuden, dem Pferdestall – ein Pferd gehörte seiner Mutter und ihm –, dem Kuhstall und dem Schweinestall, den Scheunen, einigen Misthaufen und allerlei Schuppen für die Dreschmaschine, die Gulaschkanone und andere Landmaschinen, darunter auch der Lanz-Bulldog, mit dem sie aus Schlesien geflohen waren. Der Hof war unbefestigt bis auf gepflasterte, meistens unter Matsch verschwundene Verbindungen von den beiden Hoftoren zur Schlosstür. Vor diesen Toren lagen steinerne Brücken, eine führte über einen Bach, an dem eine Wassermühle lag, zur Landstraße, die andere über den Wassergraben, der das ganze Gut umgab, auf die Felder und in den Wald. Dort floss ein Bach, die Kinder bauten Staudämme aus den herumliegenden Steinen, die Ritzen wurden mit Moos abgedichtet. Sie bauten nicht gemeinsam, sondern jeder für sich, und Georg war stolz darauf, dass sein Damm der schönste war. Die beiden bewaldeten Hügelzüge, die das Tal säumten, erschienen dem Jungen als hohe Berge. Vom Fenster des Archivs aus sah er, wie die beiden Rücken in der Ferne zusammenliefen. Dort schien die Welt zu Ende.
Ihre Zimmertür öffnete sich auf einen Gang, daneben lag ein Badezimmer mit frei stehender Eisenwanne und ein Klo, beides ungeheizt. Er war froh, dass er das auch nachts leicht erreichen konnte, denn er hasste die Nachttöpfe seiner Vettern und Kusinen. Die schliefen auf der anderen Seite des Gangs in zwei großen Sälen, in denen bei schlechtem Wetter auch gespielt wurde. Der Gang mündete in eine große Halle. Dort standen ein riesiger, noch weiter ausziehbarer Esstisch, ein Flügel, ein Billardtisch mit gerissenem Bezug und eine Unmenge von Stühlen – alles sehr geeignet, um „Reise nach Jerusalem“ zu spielen. Es wurde viel musiziert, aber Georg war es streng verboten, auf dem Flügel zu klimpern. An den Wänden hingen Bilder der Vorfahren. “Ja, Georg, schau ihn dir nur an, deinen Urgroßvater, dem verdankt ihr es, dass ihr hierher kommen konntet“, sagte Tante Luise. Eine breite Treppe führte in den ersten Stock mit den Wohn- und Schlafräumen von Onkel Eberhard und Tante Luise. Aber wie für sie selber im Erdgeschoss war auch hier und im Obergeschoss unter dem Dach Platz für ausgebombte oder aus dem Osten geflüchtete Verwandte frei gemacht worden.
Die Wirtschaftsräume und die oberen Stockwerke waren für die Kinder verboten – mit einer Ausnahme: Um sieben Uhr wurde mit einer Glocke geklingelt, und man versammelte sich im Wohnzimmer von Tante Emmi zu einer Morgenandacht: Lesung aus der Bibel und Singen eines Chorals mit Klavierbegleitung. Georg verstand das alles nicht recht, nahm es aber als unbedingt zum Tageslauf gehörig hin. Es freute ihn auch, wenn Tante Emmi ihn für seine Teilnahme lobte und ihn gar ihren eigenen Enkeln als Vorbild empfahl. Besonders glücklich war Georg, wenn er einen Platz ergattern konnte, von dem aus er die Engstelle am Ende des Tales beobachten konnte. Durch die verlief eine Nebenstrecke der Eisenbahn. Fahrplan und Andacht waren so gut aufeinander abgestimmt, dass Georg während der Lesung die ersten Dampfwolken über den Hügeln sah und dann beim Singen den Zug selber, wie er durch die Engstelle herandampfte. Es gab also offensichtlich eine Welt hinter dem Tal.
Irgendwo musste da auch Schlesien liegen, wo sie her kamen. Und es musste außer den Menschen auf dem Gut, den Verwandten, den Flüchtlingen wie den Goldbergs, der Köchin, dem Dienstmädchen und den Arbeitern noch andere geben. Die Leute auf der Landstraße, die Lokomotivführer und die englischen Soldaten. Sein Vater allerdings war nicht einmal mehr außerhalb seiner Welt, sondern überhaupt nicht mehr auf der Welt. Die Mutter hatte nur noch ihn und er die Mutter. Natürlich waren sie dankbar, bei der Tante des Vaters, Emmi, ihrem Sohn Eberhard und dessen Frau Luise aufgenommen worden zu sein. Aber der kleine Junge spürte Spannungen, und lernte langsam deren Ursache zu durchschauen.
Der Onkel nannte ihn „Pfiffikus“, schnitzte dem Jungen kleine Boote aus Baumrinde, die er auf den Gräben fahren ließ, und nahm ihn gerne auf seinen Spaziergängen mit. Da durfte der Onkel Zigarren rauchen, was Tante Luise, unterstützt von Schwiegermutter Emmi und besonders militant von Tochter Gerda, die von „Lungentorpedos“ redete, im Schloss strikt verboten hatte. Das war eine Maßnahme, die Georg voll billigte, denn in der Nachkriegszeit stank der Tabak fürchterlich. Draußen störte das nicht, der Onkel brauchte jemanden, vor dem er seine Gedanken ausbreiten konnte, und Georg hörte gut zu. Alles, was geerntet würde, müsse er abliefern, trotzdem herrsche Mangel, alles würde nur auf Karten zugeteilt. Er könnte viel mehr erzeugen, wenn er nur mehr Dünger und neue Maschinen bekäme. Die Pferde müssten durch Traktoren ersetzt werden, dann brauche er auch nicht mehr so viele Arbeiter auf dem Gut, die begannen nämlich, mehr Lohn zu verlangen. Andererseits drohe die Gefahr ausländischer Konkurrenz, in Amerika wachse der Weizen auch ohne Dünger. Immerhin gäbe es einen guten, wichtigen und mächtigen Menschen namens Adenauer, der „die Karre aus dem Dreck ziehen würde“, was den Jungen angesichts des Matsches auf dem Hof und den Feldwegen sehr beeindruckte. Keine Bodenreform, was immer das sein mochte, und man konnte mit dem neuen Geld alles kaufen, was es vorher nicht gab. Sie hatten zwar keins, aber Adenauer würde ihnen auch das noch verschaffen.
Der Krieg war nun einige Jahre vorbei, die Notzeit ging zu Ende, jeder musste sich zumuten lassen, selber die Verantwortung für sein Schicksal zu übernehmen. Bei Tisch gab es sarkastische Anspielungen. Luise zu Eberhard: „Schönbergs haben den linken Flügel des Schlosses abreißen müssen, der war so baufällig, dass man es auch den Flüchtlingen nicht mehr zumuten konnte.“ Als erste gingen die Goldbergs, in einen Ort namens Bonn, wo Adenauer regierte. Aber nicht zu dem, sondern zu fragwürdigen Menschen, den Sozis. „Nach allem, was wir für ihn getan haben“, meinte Tante Luise. Der Onkel wiegelte ab: „Er ist gegen die Kommunisten und war das schon vor dem Dritten Reich, und überhaupt war schon sein Vater zwar Jude, aber doch ein hochanständiger Mensch.“ Tante Emmi unterstützte ihren Sohn: „Dein Vater, Agnes, hat die Goldbergs doch auch geschätzt“. „Ja, weil der alte Goldberg durchaus national gesinnt war. Dem Sohn hat Vater noch vor seinem Tod empfohlen, sich an uns zu wenden, wenn er in Schwierigkeiten käme, aber natürlich hat es damals Vater, wie wir alle, nie für möglich halten können, wie schlimm sich die Nazis aufführen würden. Jedenfalls haben wir ihn mit seiner Frau in Weißstein aufgenommen, als es in Berlin zu gefährlich wurde. Die Gestapo hatte schon einige seiner Bekannten verhaftet.“ „Tätige christliche Nächstenliebe“, lobte Tante Emmi. Tante Luise passte das alles nicht: „Mit seinem Webfehler hätte er sich nicht auch noch mit zweifelhaften Kreisen einlassen sollen. Wahrscheinlich hatte der doch nur Angst vor den Bomben. Von mir aus hätte er in Schlesien bleiben und sich von seinen roten Gesinnungsgenossen befreien lassen können.“ Onkel Eberhard beendete das Gespräch mit der Bemerkung, Goldberg sei ihm nach Kriegsende bei Verhandlungen mit den englischen Besatzungsbehörden durchaus behilflich gewesen, es sei nicht seine Art, so etwas zu vergessen. Aber er sei doch froh, dass man solcher Hilfe kaum noch bedürfe, man habe es jetzt wieder mehr mit deutschen Behörden zu tun, der Respekt kehre zurück.
Da sich diese Gespräche ständig bis auf unwesentliche Abweichungen wiederholten, merkte der kleine Georg, dass hier niemand mehr versuchte, andere zu überzeugen, vielmehr wurden unabänderliche Weltanschauungen verkündet. Die verstand der Junge kaum, aber er merkte sehr wohl, wie hartnäckig sich jeder darstellte: Mutter Agnes zurückhaltend, weil abhängig, Tante Luise gekränkt und aggressiv, Onkel Eberhard pragmatisch und Tante Emmi lieb, fromm und naiv.
Dann gab es die Söhne und Töchter von Eberhard und Luise, sie waren deutlich älter als Georg und wurden Vettern und Kusinen genannt, waren aber eigentlich zweiten Grades. Der älteste war 1944 in Frankreich gefallen, durch Verrat, wie Tante Luise fest behauptete, Karl kämpfte mit dem Abitur und auch Peter ging schon auf das Gymnasium. Zwischen den ersten beiden Söhnen kamen zwei Töchter, die ältere, Gerda, war noch BDM-Führerin gewesen. Georg wich ihr aus, sie hatte ihn einmal bloßgestellt. Er hatte für sich ein angenehmes Gefühl entdeckt, wenn er im Bett seinen Penis berührte. Dabei hatte ihn Gerda erwischt und bei Tante Luise verpetzt. „Du musst unbedingt darauf achten, Agnes, dass Georg im Bett die Hände immer auf der Decke hat.“ Die Mutter schämte sich, und dafür fühlte sich Georg schuldig.
Die jüngere Tochter, Bertha, hatte er sehr lieb. Einmal an einem bitterkalten Abend, als sie allein waren, durfte er zu ihr ins Bett schlüpfen. Da war es nicht nur warm, sondern sie roch auch sehr gut und fühlte sich zugleich weich und fest an, er schlief schnell ein.
Die Lücke in dieser Großfamilie war so offensichtlich, dass es die Mutter überhaupt nicht nötig gehabt hätte, ihren Sohn ständig an das Fehlen des Vaters zu erinnern und mehr noch, von ihm zu erwarten, die Rolle des Beschützers zu übernehmen. Nach heftigen Auseinandersetzungen mit Standesgenossen und Verwandten hatte sich Wilhelm v. Mallwitz schließlich nach Ausbruch der sowjetischen Offensive im Januar 1945 doch entschlossen, dem Rat seines Schwagers, des Fabrikanten Burgdorff, zu folgen und sich mit seinem Bulldog dessen Trek nach Westen anzuschließen. Die Mallwitzens wurden in Westfalen auf dem Gut des Vetters Eberhard aufgenommen, Luise allerdings machte spitze Bemerkungen, ob es sich denn für einen preußischen Edelmann schicke, im Angesicht des Feindes Haus und Hof zu verlassen. Dann posaunte die Propaganda heraus, dass es gelungen sei, den Ansturm der asiatischen Horden auf das schlesische Bergland zu brechen. Unter solchem Druck und bei eigenen Zweifeln entschied sich Mallwitz für einen Kompromiss: Seine schwangere Frau ließ er in Westfalen, er selber kehrte nach Schlesien zurück, und zwar – trotz seiner Behinderung – auf einem Fahrrad, alle anderen Verkehrsmittel waren inzwischen zu unsicher. Ende März kam er wieder in Weißstein an, das in der Tat noch einige Kilometer hinter der Front lag. Der Ortsgruppenleiter wurde unangenehm, redete von Fahnenflucht und Defaitismus, ließ sich aber mit dem Argument beeindrucken; ohne v. Mallwitz keine Aussaat, ohne Aussaat keine Ernte und ohne Ernte kein Endsieg. Mallwitz, der Vorarbeiter Jacques, ein belgischer Kriegsgefangener, die russischen Kriegsgefangenen und die Frauen der längst eingezogenen Landarbeiter machten sich an die Arbeit.
Anfang Mai verschwand Jacques mit einem Pferd. Ein paar Nächte später sahen sie Feuerwerk über der Front, die Russen feierten ihren Sieg. Der Ortsgruppenleiter setzte sich ab, ein wilde Menge, deren Anführer sich als Kommunisten ausgaben, fing an, Vorratslager zu plündern und dann auch verlassene Häuser. Die Bank wurde besetzt, ein Tresor auf den Vorplatz gestürzt, aufgeschweißt und geleert. Aber der Pöbel traute sich nicht nach Weißstein, Wilhelm v.Mallwitz saß noch auf seinem Besitz. Er vergrub einige Wertgegenstände und ließ allen Alkohol bis auf einen Anstandsrest ausgießen. Diese kluge Maßnahme bewährte sich nach Ankunft der Russen am nächsten Tag, sie bekamen etwas zu trinken, aber in Maßen. Auf dem Gut kam es zwar zu Diebereien, aber nicht zu Gewalttaten. Hilfreich war sicher auch, dass die Gefangenen nichts gegen Mallwitz vorbrachten. Im Ort erschossen die Russen einige wirkliche oder angebliche Kommunisten, um deutlich zu machen: Plündern ist ein Privileg von Siegern. Nach einigen Tagen verschlechterte sich die Lage, und zwar zuerst für die gerade befreiten russischen Gefangenen, sie wurden verhaftet, verprügelt und abgeführt von einem Trupp, den Mallwitz als so etwas wie eine sowjetische Gestapo einordnete. Dann zogen die Russen ab, und es kamen Polen, die alles in Beschlag nahmen, was sie nur wollten. Es wurden Plakate angeschlagen, die sie im Namen der Siegermächte als neue Herren einsetzten. Den Deutschen wurde die Repatriierung nach Westen befohlen. Mallwitz hatte verloren und glaubte inzwischen auch, sich damit abfinden zu müssen. Am Abend vor der Abschiebung tauchte eine Gruppe von Polen auf, Männer, Frauen, Kinder und ein Anführer. Der erklärte, sie würden nun das Gut übernehmen und erst einmal die Befreiung feiern. Man schlachtete ein noch verbliebenes Schwein, warf Möbel aus dem Haus und zündete damit ein großes Feuer an. Ein Scheunentor wurde ausgehängt und auf dem Hof als Tafel aufgebockt. Da griff das Feuer auf die Scheune über, die inzwischen Betrunkenen grölten vor Freude. Um wenigstens den Anführer zur Besinnung zu bringen und die Landmaschinen aus der Scheune zu retten, rüttelte Mallwitz an dessen Schultern. Der empfand das als Angriff und schlug ihn zu Boden. Dann legten sie das Scheunentor auf den regungslosen Körper und tanzten darauf herum. Wilhelm v. Mallwitz starb noch in dieser Nacht.
Das war der gemeinsame und schließlich von der Familie geglaubte Kern der Erzählungen und Briefe der überlebenden Ausgewiesenen. Das Pferd lieferte übrigens Jacques in Westfalen für Agnes ab und machte sich dann zu Fuß auf den Weg heimwärts nach Belgien.
Georg v. Mallwitz verstand, so unerfahren er noch war, das Wesentliche: Um seine Familie, seinen Besitz zu retten, hatte sich sein Vater zwischen zwei Parteien schlechter Menschen geworfen und war dabei umgekommen. Er hatte sich als Einzelner einem Unheil entgegengestemmt und war gescheitert. Also musste er, Georg, sich noch besser schützen und immer auf der Hut sein. Er lernte, die Gespräche der Erwachsenen anhand seiner eigenen Erfahrungen zu beurteilen und damit auch ihre Behauptungen zu bewerten. Aus den Erzählungen der Erwachsenen und dann immer mehr aus seinen eigenen Beobachtungen entwickelte er sein Weltbild. Es stand zwar außer Frage, dass den Erwachsenen gehorcht werden musste, denn sie hatten immer recht. Aber da sie oft verschiedene Ansichten hatten und manchmal sogar stritten, konnte es nicht nur eine Wahrheit geben. Einig war man sich noch in der Furcht vor Kommunisten, Polen und Russen. Da hatte man es unter den Engländern besser, die hatten allerdings vorher alle Städte mit Bomben ausradiert und, was die Leute auf dem Land besonders nachtrugen, aus Flugzeugen auf pflügende Bauern geschossen. Auf dem Gut war zwar niemand verletzt worden oder gar umgekommen, aber das verdankte man dem Keller, in den man sich immer noch rechtzeitig hatte flüchten können.
Dann waren da die Nazis, das waren Leute, die früher in Deutschland zu bestimmen hatten, was ganz schlimm ausgegangen war. Onkel Eberhard meinte, die hätten zu Anfang eigentlich bis auf einige Übertreibungen – die Juden und so – ganz vernünftig losgelegt, insbesondere die Landwirtschaft vorbildlich gefördert, seien aber 1938, spätestens jedoch 1941 größenwahnsinnig geworden. Die Tschechen, Polen und Franzosen hätten ja eine Lehre verdient gehabt, aber was hatten wir in Russland zu suchen? Und überhaupt hatte der Gefreite Hitler die Kriegführung verpatzt. Tante Luise betonte den Idealismus, die Opferbereitschaft und die fabelhafte Einheit des Volkes, das unter schwersten Belastungen bis zum letzten zusammengehalten hätte. Auch unter den Nazis sei die Mehrzahl immer anständig geblieben und hätte von irgendwelchen Untaten gar nichts gewusst. Mutter Agnes wiederum meinte, man hätte durchaus einiges gewusst, aber nichts machen können, weil die Nazis zu brutal waren. Für Tante Emmi schließlich waren Nazis wie Kommunisten gottloses, ordinäres Gesindel.
Dabei war es Tante Emmi, der man verdankte, dass sie am Leben waren und das Schloss überhaupt noch stand. Kurz vor Kriegsende – oder 'Toresschluss', wie Onkel Eberhard es nannte, quartierte sich noch ein General mit seinem Stab ein. Die setzten sich ab, als die Front näher kam, und befahlen dem Volkssturm, das Gut bis zum letzten Mann zu verteidigen, um den Rückzug zu decken. Die Volkssturmmänner bauten aus der Dreschmaschine und anderen Geräten eine Panzersperre auf der Zufahrt. Weder die Zivilisten noch der Volkssturm hatten Lust auf einen Endkampf, aber keiner traute sich, das zu sagen oder gar etwas dagegen zu unternehmen. Die Drohungen der Nazis gegen alle Feiglinge, die am Endsieg zweifelten, hatten gewirkt.
Nur bei Tante Emmi nicht. Auf der Landstraße rückten englische Panzer heran. Die Zivilisten versteckten sich im Keller, Eberhard war eingezogen und und kommandierte irgendein fernes Depot, in dem Pferde für die Wehrmacht trainiert wurden, und Luise war zu verwirrt, um irgendeinen Entschluss zu fassen. Jetzt kam es auf sie, auf Emmi an. Sie hängte weiße Bettlaken aus den Fenstern, nahm zwei weiße Tücher in die Hand und gab eins davon Agnes, die müsse, Schwangerschaft hin oder her, wegen ihrer guten Englischkenntnisse mit. Die beiden kletterten durch die Lücken in der Sperre, Emmi sagte „Gott behüte uns“, und sie gingen auf die Panzer zu. Sie hatten fürchterliche Angst: Zwar war es ja eigentlich jenseits aller Vorstellungskraft, dass die Engländer von vorn oder der Volkssturm von hinten auf sie schießen würden, aber schließlich waren sie ja gerade durch Vorgänge in diese Lage gekommen, die man sich ebenfalls nicht hatte vorstellen können. Überdies wusste Agnes nicht, was sie sagen sollte.
Glücklicherweise redete ein Engländer zuerst und befahl ihnen, die Sperre sofort räumen zu lassen, alle Waffen in der Einfahrt abzulegen und sich mit erhobenen Händen im Hof zu sammeln. Falls nicht, würden sie das Feuer eröffnen und Flugzeuge anfordern. Sie kehrten zurück, Emmi holte tief Luft und sprach zu den Männern: “Ihr legt jetzt eure Waffen hier hinter der Dreschmaschine aufeinander, dann zieht ihr die zur Seite, sodass die Engländer den Haufen sehen können. Wer will, kann dann durch das hintere Tor verschwinden, während wir den Rest der Sperre wegräumen.“ Da es so offensichtlich mit den Nazis zu Ende ging, hielt man sich wieder an die alte Autorität einer Gutsherrin, der Volkssturm gehorchte und verschwand.
Die Engländer kamen vorsichtig herein und durchsuchten alles. In der Halle fiel ihnen unter einem Ahnenbild ein Säbel auf, ein Offizier nahm ihn herunter und sah Emmi scharf an: „No weapons!“ Emmi sagte schnell etwas zu Agnes, die übersetzte: „This sabre was presented by the Duke of Wellington to our ancestor for his gallantry in the battle of Waterloo, please read the engraving.“ „I told you that you have to surrender all weapons. You must learn to obey our orders. And no nonsense!“ Offensichtlich wollte der Offizier den Säbel jetzt erst recht behalten. Die Soldaten nahmen sich ein Beispiel und stibitzten alles, was wertvoll erschien und nicht vorher noch versteckt worden war.
Zuerst überwog bei allen das Gefühl, doch noch ganz gut davongekommen zu sein, aber später redete man eher über die Diebereien. Eine Flüchtlingsfrau meinte sogar, Tante Emmi hätte diese eigentlich verhindern müssen. Tante Luise konnte sich überhaupt nicht vorstellen, dass deutsche Soldaten stehlen könnten. Als darauf Karl auf die Mitbringsel seines Bruders aus Frankreich, Cognac, Champagner und Parfum, zu sprechen kam, wies ihn seine Mutter zurecht, das sei bezahlt gewesen und französisches Parfum sei ohnehin zu aufdringlich, deutschen Frauen reichten Wasser und Seife vollständig. Sie hatte sich allerdings noch kurz vor dem Krieg, als importierter Luxus schon knapp wurde, mit einem großen Vorrat feiner englischer Seife eingedeckt. Auch diese Erzählungen von Ereignissen, die sich noch vor seiner Geburt zugetragen hatte, merkte sich Georg gut.
Die Gegenwart war von der Vergangenheit geprägt, und vor ihnen lag eine Zukunft, in der alles besser werden würde. Aber es gab auch Jahreszeiten und Feste, die sich immer wiederholten. Der Winter brachte zwar Abwechslungen wie Schlittenfahren und Glitschen auf dem Eis des Fischteichs, aber Georg fror meistens. Er traute sich nicht, zu klagen, weil Tante Luise seine Mutter ermahnte, ein deutscher Junge müsse abgehärtet werden. Es wurde, wenn überhaupt, dann nur mit Sägespänöfen geheizt. Die Späne wurden vom Sägewerk geholt und um einen Holzstamm entlang der Achse eines eisernen, aufrecht stehenden Zylinders fest gestampft. Dann wurde der Holzstamm vorsichtig herausgezogen, sodass ein Kamin entstand, der Ofen wurde verschlossen und unten angezündet. Mit Glück gab es dann für einige Zeit eine große Hitze rund um den Ofen, aber allzu oft ging das Feuer bald wieder aus, manchmal fehlte der Luftzug, weil eben doch Späne in den Kamin gestürzt waren, oder die Sägespäne waren noch zu feucht.
Ein Lichtblick war Weihnachten. Weil sich Georg auf seinen Spaziergängen mit seinem Onkel sehr für die Züge interessierte, die durch das Tal fuhren, bauten die Vettern für ihn, aber auch für sich selber, in ihrem Zimmer die Märklin-Eisenbahn auf, die vor dem Krieg angeschafft worden war. Georg kannte schon Spielzeuge, die durch vorher gespannte Weckgummis angetrieben wurden, und Uhrwerke, die man aufziehen musste. Die liefen aber nicht lange. Diese Lokomotive lief mit elektrischem Strom so lange man wollte. Georg wunderte sich, dass man dafür zwei Leitungen brauchte. Die Vettern brachten ihr Schulwissen an: Man muss einen Stromkreis schließen, irgendwo steht ein Kraftwerk, eine Fabrik, die den Strom durch die Lokomotive und durch alle anderen elektrischen Geräte pumpt. Durch die eine Leitung fließt der Strom hinein, durch die andere wieder heraus zum Kraftwerk. Karl wusste noch mehr: „Alles geschieht in Kreisläufen: Das Vieh lebt vom Futter und macht Mist. Den bringen wir dann auf die Felder, damit das Futter besser wächst. Und die richtigen Lokomotiven brauchen Kohle, wenn die verbrennt, entsteht ein Gas, das die Pflanzen zum Wachsen brauchen. Aus den Pflanzen entsteht dann wieder neue Kohle, aber das dauert viele Millionen Jahre.“ Georg galt zwar als Pfiffikus, aber Millionen gehörten noch nicht zu seinem Zahlenraum, er wusste nur, dass das sehr, sehr große Zahlen waren. Das war beruhigend, er hatte natürlich verwelkende Pflanzen gesehen, aber nie welche, die sich in Kohle verwandelten.
An Silvester durfte Georg mit den Anderen aufbleiben, er kämpfte mächtig mit der Müdigkeit. Aber endlich ging man auf den Hof, ein Posaunenchor spielte einen Choral und die Glocken läuteten. Ein neues Jahr fing an, die Eisenbahn wurde wieder abgebaut und sorgfältig verpackt, und als Trost bekam Georg alte Märklin-Kataloge als Bilderbücher. Darin gab es nicht nur Eisenbahnen, sondern auch Dampfmaschinen und Autos, sogar einen Dreiachser, den Wagen des Führers, und für die Mädchen Kochherde.
Gegenüber Fabeltieren wie den Osterhasen aus der „Hasenschule“ hegte Georg gesunden Zweifel. Im Frühling sah er beim Spazierengehen mit Onkel Eberhard viele Hasen und Kaninchen. Onkel Eberhard meinte, es seien viel zu viele, weil in den letzten Jahren zu wenige abgeschossen worden seien. Die Deutschen dürften nicht jagen und die Engländer schössen lieber größeres Wild. Aber auch das würde sich jetzt ändern, und darauf freue er sich. Osterhasen konnte es also nicht geben, denn Georg hielt es für ausgeschlossen, dass der Onkel auf sie schießen könnte. Auch in Tante Emmis Andachten war zwar viel von Ostern, aber nie von Hasen oder Ostereiern die Rede. Umso mehr freute er sich auf das Suchen der Eier, die bei gutem Wetter draußen und sonst im Schloss versteckt waren. Er hatte einen guten Spürsinn und fand mehr als die Anderen, zum Schluss allerdings wurden dann die Eier und auch einige Schokolade an alle gleich verteilt. Georg fand das nicht ganz gerecht, freute sich aber, wenn er als bester Sucher gelobt wurde.
Die Schokolade bekamen sie von der früheren Gouvernante seiner Mutter aus der Schweiz. Weniger mochte Georg eine ihm ebenso unbekannte Freundin seiner Mutter aus Norwegen. Die schickte Lebertran, der scheußlich schmeckte, aber angeblich unbedingt notwendig für ihn sei, damit er groß und stark würde. Statt sich zu ekeln, solle er lieber dankbar sein, dass sie so gute Beziehungen hätten. Tante Luise hielt von solchen Überredungsversuchen wenig, sie packte sich Georg, zwängte ihn zwischen ihre Knie, hielt ihm die Nase zu, bis er der Mund aufmachte und sie ihm einen Löffel einflößen konnte. Georg fühlte, dass solch entschlossene Gewaltanwendung die Mutter noch mehr demütigte als ihn selber und ließ sich fortan den Tran doch lieber von seiner Mutter verabreichen.
Sobald es im Frühjahr grün wurde, sammelten die Kinder an den Feldrainen frisches Gras für die Kaninchen, die von der Familie, den Flüchtlingen und den Arbeitern in roh gezimmerten vergitterten Ställen gehalten wurden. Was kriegten die im Winter? Die Stallhasen hielten doch keinen Winterschlaf? Oder wurden sie im Herbst geschlachtet? Und dann? Einfrieren gab es damals nicht. Vermutlich gab es trotz aller Sparsamkeit noch allerlei Küchenreste, Kohlstrünke und ähnliches. Jedenfalls fraßen sie uns das frische Gras aus der Hand, und wir taten was Nützliches. Später wurden Maikäfer gesammelt und gezählt, auch dabei gab es Sieger und Verlierer. Die Hühner waren ganz wild auf die Käfer, aber nachdem entdeckt wurde, dass der plötzlich auftretende unangenehme Geschmack der Eier von einem Übermaß dieser Kost herrührte, wurde das verboten.
In diese Zeit fiel auch „Pfingsten, das liebliche Fest“. So begann eine Geschichte über die Abenteuer von Reineke Fuchs, daraus las der Onkel von Zeit zu Zeit vor. Dieser Reineke lebte mit seiner Familie in einer Burg und kämpfte gegen mächtige und böse Feinde. Es ging hin und her, aber zum Schluss gewann er, weil er listig und noch gemeiner als seine Gegner war. Onkel Eberhard las all das mit offensichtlichem Behagen, was Georg nachdenklich machte. Reineke Fuchs führte sein Leben nicht nach den zehn Geboten, die Tante Emmi in ihren Andachten predigte. Er war ein erfolgreicher Sünder, und was noch schlimmer war, man konnte ihn dafür sogar mögen.
Im Sommer gingen die Kinder auf die abgemähten Getreidefelder, um die liegen gebliebenen Ähren einzusammeln. Die meisten hatten ihre Fußsohlen im Lauf der warme Jahreszeit genügend abgehärtet um barfuß über die Stoppelfelder zu laufen, Georg trug Sandalen, aber auch er war sehr erfolgreich im Sammeln. Später im Jahr wurden die Äpfel gesammelt, die von den Bäumen am Rand der Landstraße herunter gefallen waren. Sobald einige Säcke zusammen waren, wurde auf dem Hof die Gulaschkanone angeheizt, und Bertha kochte Apfelmus. Wenn das Mus warm wurde, musste sie kräftig rühren, damit nichts anbrannte. Weil ihr heiß war und die Arbeit schwer, trug sie wenig unter ihrem Kittel, und viele Männer richteten ihre Arbeit so ein, dass sie oft an der Gulaschkanone vorbei gingen.
Einmal traf Georg im Wald auf ein sich küssendes Paar, die beiden fuhren auseinander, es war Bertha mit einem Uniformierten. Trotz der einsetzenden Dämmerung sah Georg, wie Bertha rot wurde und dann den Finger auf den Mund legte. Also ein Geheimnis, und Georg freute sich, der Kusine einen Gefallen tun zu können. Irgendwann wurden die beiden dann doch von Anderen beobachtet und verpetzt. Nach dem Abendessen wurden die Vettern und Georg aus der Halle geschickt, und es begann ein Strafverfahren. Natürlich dürften die Mädchen junge Männer sehen, die der Familie bekannt und vertrauenswürdig seien. Aber Knutschen mit Unbekannten sei unpassend, besonders (und darauf legte Tante Luise besonderen Wert), wenn es sich um Engländer handle.
Nach einigen Tagen besserte sich die Stimmung, Eberhard hatte nämlich herausbekommen, dass es sich nicht nur um einen Offizier, sondern sogar um einen Adligen handelte. Man beschloss, den jungen Mann in den Stand eines Bekannten zu versetzen, und lud ihn zum Tee ein. Er erschien in glänzender Uniform und begrüßte die älteren Damen Emmi, Luise und Agnes mit einem angedeuteten Handkuss, Eberhard mit einer tiefen Verbeugung, Gerda und Bertha mit einer leichteren. Den Vettern winkte er freundlich zu, und für Georg zwinkerte er kurz mit dem Auge. Die jungen Leute versuchten ihr Schulenglisch, für die älteren musste Agnes übersetzen. Zunächst redete man – natürlich – über das Wetter, über die Jagd und die Landwirtschaft im Allgemeinen, dann über die besonderen Verhältnisse in Westfalen und in Devon, wo der Vater des Offiziers seinen Besitz hatte. Eberhard und Emmi erzählten etwas aus der Geschichte des eigenen Schlosses, man unterließ es nicht, besonders auf das Bild des Ahnen hinzuweisen, der bei Waterloo gekämpft hatte. Luise warf noch etwas über den verschwundenen Säbel ein, aber das unterschlug Agnes in ihrer Übersetzung. Der Engländer begutachtete den Flügel und bat um Erlaubnis, etwas spielen zu dürfen, und trug etwas von Bach vor. Das gefiel, Onkel Eberhard schaute seine Frau an und nickte mit dem Kopf, womöglich hoffte er auch auf eine Quelle besserer Zigarren. Nach einer guten Stunde verabschiedete sich der Gast und wurde aufgefordert, doch einmal wiederzukommen. „Bertha spielt doch Querflöte, könne er sie nicht am Klavier begleiten?“ Bertha durfte ihn allein hinaus zu seinem Wagen bringen, sie wirkte sehr erleichtert. Nur Gerda giftete: „Die Engländer sind doch alle, besonders wenn sie gut aussehen, Sodomisten.“ Alle, die das Wort verstanden, wurden rot, das peinliche Schweigen wurde durch Karl beendet: „Wenn er anders veranlagt wäre, würde er sich doch nicht für Bertha interessieren.“ Georg fand den Engländer, den ersten, den er nicht nur kurz und von Ferne gesehen hatte, beeindruckend und wünschte im Stillen ihm und Bertha alles Gute. Sonst hatte er fast nichts verstanden, aber er freute sich, als die sich unbeobachtet glaubende Bertha ihrer Schwester die Zunge herausstreckte.
Dass alle ja nur sein Bestes wollten, hörte Georg bis zum Überdruss. Tante Luise und Gerda wollten ihn abhärten und bedauerten, dass es kein Militär mehr gäbe, in dem weichliche und widersetzliche Träumer zu strammen, jungen Männern geschliffen würden. Tante Emmi wollte ihn gottesfürchtig, die Mutter ewig dankbar und Onkel Eberhard brauchte jemanden, bei dem er seine Gedanken abladen konnte, was Georg anregte, aber auch belastete. Und er litt mit seiner Mutter unter der Abhängigkeit von den Verwandten.
Da brachte der nächste Besuch des englischen Offiziers eine Wende. Die Jüngeren hatten wenigstens ihr Schulenglisch, Bertha war inzwischen weit darüber hinaus, aber die Älteren hatten aus ihrer Jugend im Kaiserreich bestenfalls noch dunkle Erinnerungen an Französisch. Nur Mutter Agnes war als Tochter eines Diplomaten mehrsprachig aufgewachsen. Mit ihrer Hilfe konnte man sich entspannt unterhalten und begann, sich gegenseitig anzunehmen. Der Offizier lobte mehrfach Agnes‘ Englisch und vermittelte ihr schließlich, möglicherweise auf sanfte Empfehlung Berthas hin, eine Stelle als Übersetzerin bei der englischen Armee.
Statt die Gastfreundschaft durch Arbeit im Haus, Garten und auf dem Hof zu vergelten, konnte Agnes nun Miete zahlen. Sie zogen aus dem Archiv in frei gewordene Räume im Seitenflügel, Georg rechnete sich das als Verdienst seiner guten Beziehungen zu Bertha und seiner Verschwiegenheit an, aber die Mutter pries eher die gute Erziehung, die sie in ihrem Elternhaus genossen hatte.
Der Großvater war Diplomat gewesen, Agnes und ihre Schwester Anna hatten ihre Kindheit im Ausland unter der Obhut einer Schweizer Hauslehrerin verbracht. Besonders gern erzählte Agnes von Norwegen, das der Kaiser jeden Sommer auf seiner Yacht besuchte. Einmal war nicht nur der Großvater, sondern auch seine ganze Familie mit eingeladen worden. Die Mädchen durften mit am Tisch sitzen, noch zwei Kriege später veranlasste das Agnes zu erzieherischen Bemerkungen wie „Ich habe mit Kaisern und Königen gegessen“, wenn sie an den Tischmanieren Georgs etwas auszusetzen hatte. Wurde damals Republikaner. Jedenfalls mussten die Mädchen beim Kaiser einen guten Eindruck hinterlassen haben, denn er schenkte ihnen zum Abschied kleine goldene Broschen in Form eines stilisierten „W“ , Agnes trug ihre immer noch gern, obwohl der Großvater während des Krieges die Gunst des Kaisers verloren hatte.
Der Großvater und der Finanzier Goldberg hatten mit einer Denkschrift in den Streit um den Einsatz von U-Booten gegen Handelsschiffe eingegriffen und dringend davor gewarnt, den Amerikanern einen Vorwand zum Eintritt in den Krieg zu liefern. Später machte er sich bei seinen Standesgenossen unbeliebt, als er vor Annexionen im Osten warnte, die doch nur noch mehr der sonst so unerwünschten Polen und Juden ins Reich bringen würde. Leider gerieten der Kaiser, die Regierung und die Öffentlichkeit immer mehr unter den Einfluss intriganter Scharfmacher. Da war die Rede von Spielernaturen, was Georg etwas verwirrte, weil gelegentlich auch lobend erwähnt wurde, dass der Großvater einmal sehr viel Geld beim Glücksspiel gewonnen hätte. Aber der Großvater hätte eben die Charakterstärke besessen, aufzuhören, bevor die Gewinnserie abbrach. Die kaiserliche Ungnade kränkte den Großvater umso mehr, als, wie von ihm befürchtet, die Militärs ohne Erfolg blieben und der Krieg verloren ging. Da konnte man vernünftigerweise nur noch geduldig versuchen, zu retten, was noch zu retten war. Zwar würden die Sieger schwere Friedensbedingungen auferlegen, aber Deutschland müsste bei weiterem, äußersten Widerstand mit einer vernichtenden Zerstörung rechnen.
Der Großvater erhielt von der Republik die Aufgabe, die deutschen Interessen bei der Grenzziehung nach der Abstimmung in Oberschlesien zu vertreten. Das wollten sich die Polen mit Gewalt aneignen, obwohl sie die Abstimmung verloren hatten. Die Deutschen wehrten sich, und schließlich bestimmten die Siegermächte, dass das Gebiet geteilt werden sollte. In der Kommission, die die Grenze ziehen sollte, bevorzugten die Franzosen die Polen schamlos. Wenn Orte überwiegend deutsch waren, wurden sie aus wirtschaftlichen Gründen Polen zugesprochen. Aber zusammengehörige Industrien wurden zerschlagen, wenn es nur in irgendeinem Flecken eine polnische Mehrheit gab. Die übrigen in der Kommission vertretenen Länder sahen keinen Anlass, sich für den Kriegsverlierer einzusetzen, und hinter dem Großvater stand keine Macht. So niederdrückend das war, schlimmer traf ihn die Kritik aus jenen Kreisen, die er immer als die seinen empfunden hatte: Er sei einfach zu schlapp, ein Flaumacher vor, im und nach dem Krieg.
Obwohl sonst wach für politische und gesellschaftliche Entwicklungen, blieb der Großvater, soweit es seine Familie betraf, fest bei den überkommenen Vorstellungen. Die Bestimmung der Frau war Ehe und Mutterschaft. Zwar hatten noch vor dem Krieg unverheiratete Tanten bequem von ihrem Anteil am Familienvermögen leben können, aber viel zu vererben gab es nach der Inflation nicht mehr. Trotzdem erschien es ihm undenkbar, dass seine Töchter ein selbständiges Leben führen könnten. Falls sie keinen Mann finden würden, bliebe nur eine eher dienende Rolle, etwa in der Pflege, und das am besten im Rahmen der Großfamilie.
Die Töchter wurden also nach dem Lyzeum auf eine Maidenschule geschickt, ein Internat, in dem Töchter auf ihre Aufgaben als Gutsherrinnen in Hauswirtschaft, in der Anleitung und Beaufsichtigung des Personals, aber auch in der Gestaltung von Festen mit Musik, Theater, Literatur und Tanz vorbereitet wurden. Daneben war die Maidenschule natürlich auch ein Institut zur Anbahnung von Ehen mit den Brüdern der dort gewonnenen Freundinnen. Aber die Familie wurde nicht mehr für ganz zuverlässig gehalten, und Männer waren nach den Verlusten des Krieges ohnehin rar, es war nicht leicht, die Töchter standesgemäß zu verheiraten. Dabei waren beide hübsch, die ältere, selbstbewusste Anna heiratete schließlich den Ingenieur Friedrich Burgdorff aus Waldberg, zwar bürgerlich, aber aus einer lang ansässigen Familie, der das Eisenwerk Karlshütte gehörte. Burgdorff hatte noch in der kaiserlichen Marine gedient, auf der ein Schatten lag, sie hatte im Krieg gekniffen und dann auch noch gemeutert.
Die jüngere Agnes war eher schüchtern, aber zäh genug, eine Ausbildung zur Hauswirtschaftslehrerin gegen den anfänglichen Willen des Vaters durchzusetzen. Wenn schon alte Jungfer, dann besser unabhängig bleiben von der Familie, insbesondere der Schwester. Sie versuchte aber, so gut es ihre Arbeit erlaubte, weiter am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Im Kreis der entfernten Verwandten gab es die Familie v. Mallwitz mit einem Sohn Wilhelm, der das Gut Weißstein für seinen Vater verwaltete. Wilhelm v. Mallwitz hinkte leicht, er war als junger Freiwilliger bei den Kämpfen in Oberschlesien verwundet worden. Nach Jahren einer zunächst oberflächlichen Bekanntschaft entschlossen sich die beiden, zu heiraten. Weißstein hatte eine tüchtige Herrin nötig. Ein frommer Vorfahre Wilhelms hatte dem Krüppelheim Bethanien beträchtliche Flächen gestiftet, sodass das Gut selbst in guten Zeiten kaum Gewinn abwarf. Das Stammschloss auf einem Hügel war so heruntergekommen, dass Agnes beschloss, es den Familien der Arbeiter zu überlassen, die Mallwitzens selber zogen in das Haus der ehemaligen Verwalter am Wirtschaftshof. Agnes wirtschaftete geschickt und erschloss neue Einnahmequellen, indem sie Pensionsgäste aufnahm. Dass sie dafür Geld nahm, widersprach traditionellen Vorstellungen von Gastfreundlichkeit und war Wilhelm besonders dann peinlich, wenn es sich um Bekannte oder gar Verwandte handelte. Aber dem Argument, ohne solche Einnahmen könnten sie Weißstein überhaupt nicht halten, und das würde weder den Gästen noch ihnen selbst nützen, denn was sollten sie ohne das Gut anfangen, konnte er nichts entgegen setzen.
Vom Dritten Reich erhoffte man sich eine Versöhnung zwischen den Klassen, die auch Deutschlands Stellung nach außen stärken würde, selbst der Großvater trank noch kurz vor seinem Tod Champagner auf das Wohl der neuen Regierung. Die Landwirtschaft wurde gefördert, um Deutschland autark zu machen, und das Eisenwerk der Burgdorffs erhielt Rüstungsaufträge. Mit den guten Geschäften nahm aber auch das innere Unbehagen zu. Während man sich zunächst noch damit beruhigte, nach einer Zeit politischer Wirren und wirtschaftlichen Niedergangs seien vereinzelte Gewaltakte unvermeidlich und somit fast entschuldbar, merkte man bald, dass man mit ungeheurem Druck in eine Volksgemeinschaft gepresst wurde, die nur sich selber als Wert anerkennen wollte. Besonders bedrückte die wachsende Einsicht, dass es sich dabei nicht etwa nur um eine Weltanschauung handelte, die durch Übertreibungen auf radikale Abwege geraten war, sondern um eine Politik, deren durch und durch verbrecherischer Ansatz sich zunehmend offenbarte.
Eines Tages kam die Oberin von Bethanien nach Weißstein und berichtete, es sei angeordnet worden, die Krüppel zu verlegen, nach der Räumung sollte das Heim dann als Lazarett benutzt werden. Die Mallwitzens hatten Gerüchte über die Euthanasie gehört und versprachen, ihr Möglichstes zu tun. Wilhelm sprach bei verschiedenen Ämtern vor, berief sich auf die Stiftung seines Vorfahren, wurde weiterverwiesen, bis ihm deutlich gesagt wurde, dass im Krieg die Wiederherstellung der Fronttauglichkeit von Verwundeten den absoluten Vorrang habe, dass mit den Krüppeln gemäß den Grundsätzen der völkischen Gesundheitspolitik verfahren würde und dass er besser keine wehrkraftzersetzende Unruhe verbreiten solle.
Das war deutlich genug, und es gab einen weiteren Grund, peinlich zu vermeiden, die Aufmerksamkeit der Nazis auf sich zu lenken. Der Sohn Goldbergs, Halbjude und politisch eher links stehend, fühlte sich in Berlin beobachtet und nicht mehr sicher. Er musste sich zumindest unauffällig machen und wandte sich an die Töchter des Freundes seines Vaters. Burgdorff verschaffte ihm die Stelle eines Buchhalters in seinem kriegswichtigen Betrieb, wohnen konnte er mit seiner Frau auf Weißstein.
In Bethanien war man natürlich fromm gewesen, also sangen die Krüppel noch einen Choral, bevor sie den Autobus bestiegen, der sie fort bringen sollte. Die Mallwitzens, die Oberin und viele andere ahnten, was ihnen bevor stand, aber wie sollte man das ändern?
Zu diesen niederschmetternden Erlebnissen kam die Furcht vor dem Krieg. Die Erinnerung an die Demütigungen nach dem ersten Weltkrieg war zwar noch zu frisch, als dass man den Polen ihre schnelle Niederlage nicht gegönnt hätte. Aber man war sich auch der Brutalität bewusst, die mit den hochtrabenden Plänen zur Eroberung von Lebensraum und dessen Säuberung durch Aussiedlung aller rassisch nicht erwünschten Bevölkerungen einher ging. Nach Stalingrad schließlich war klar, dass der Krieg verloren und die Ostfront nicht zu halten war. Goebbels‘ Reden zeigten, dass die Nazis durch Niederlagen nur noch weiter radikalisiert wurden und in die von den Alliierten geforderte Kapitulation nie einwilligen würden, lieber führten sie Krieg gegen das eigene Volk. Staat und Gesellschaft würden untergehen, wer überleben wollte, musste umsichtig sein und viel Glück haben. Und die Familien mussten zusammenhalten und Freunde einander helfen.
Friedrich Burgdorff war es gelungen, ein Gelände im Hamburger Hafen zu pachten, um dort ein Zweigwerk für Aufträge der Marine zu errichten. Das wurde allerdings bald durch Bomben zerstört, also mussten Personal, Maschinen und andere Ausrüstung aus Waldberg dahin verlagert werden, um den für den Endsieg unverzichtbaren Betrieb wieder aufzunehmen zu können. Es gelang den Burgdorffs, die Mallwitzens davon zu überzeugen, dass traditionelle Wertvorstellungen wie „Ein Adliger weicht nicht von seiner Scholle“ keine Bedeutung mehr hätten. Aber dass Agnes nach langen Ehejahren endlich schwanger geworden war, gab den letzten Ausschlag dafür, dass sich die Mallwitzens anschlossen. Wilhelm allerdings eher, um Agnes und sein Kind zu schützen, er zauderte, vielleicht konnte er sie nur bei seinem Vetter in Westfalen abliefern und zurückkehren, sofern es die Kriegslage nur erlaubte. So machte man sich im Februar 1945 mit zwei Holzgas-Lastzügen und einem Lanz-Bulldog auf den Weg nach Westen. Abweichend von der Fahrerlaubnis nahm man weniger Ausrüstung, dafür aber alle jene Arbeiter mit, die nicht mehr an den Endsieg glaubten und sich und ihre Familien in den vergleichsweise sicheren Westen bringen wollten. Zunächst übernachtete man auf den Besitzungen von Verwandten und Bekannten, später, im Westen, konnte man sich wegen der Tiefflieger nur nachts bewegen, und selbst das war nicht ungefährlich, denn es gab auch Angriffe unter Scheinwerferlicht. Hinter Magdeburg trennte man sich, die Burgdorffs fuhren nach Hamburg, die Mallwitzens zu ihren Verwandten nach Westfalen.