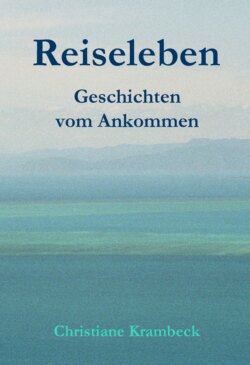Читать книгу Reiseleben - Christiane Krambeck - Страница 5
ОглавлениеJagdfieber
Im Näherkommen sahen wir, warum Cesar wütend den Pickup verbellte, mit dem wir mit den Kindern zum Strand fahren wollten. Ein Krokodil hatte sich den Schatten darunter für seine Siesta ausgesucht und dem alten Cesar damit seinen Stammplatz streitig gemacht. Das Reptil war kaum einen Meter lang. Ohne Caesar hätten wir es kaum rechtzeitig bemerkt. Das nicht endende Gekläff lockte ein paar unentwegte Doktoranden aus dem Institut, so dass schnell kein Mangel an theoretischen Lösungsansätzen herrschte. Aber erst Manuel fand eine Schaufel, beförderte das Vieh damit beherzt unter dem Wagen hervor und eskortierte es in seinen Teich zurück.
Dafür, dass wir nun schon einen Monat auf Sapelo lebten, ließ sich das Wochenende recht unterhaltsam an. Was es auf der zwanzig Meilen langem Sandinsel vor der Küste von Georgia außer dem Institut noch an Sehenswürdigkeiten gab, war schnell erkundet gewesen. Außer einer unnahbaren Forststation und der Siedlung ehemaliger Plantagenarbeiter gab es nur noch ein paar Ruinen und unscheinbare Spuren früher indianischer Besiedlung am anderen Ende mit Ringwällen von Muschelschalen.
Dieser Samstag blieb ungewöhnlich. Schon auf halber Strecke zum Strand gab es wieder etwas Neues. Unter der Brücke über den ersten Priel fischte ein vierschrötiger Fremder mit einer Technik, die wir noch nie gesehen hatten. Wir hielten an und sahen ihm zu.
Bisher hatten wir nur Leute aus der Siedlung so eine Art Stellnetz durch die Brandung ziehen sehen. Das flache Wasser ernährte auch Schwärme von Pelikanen, war ziemlich "stückig", wie unsere Tochter beim Baden bemerkte. Zu den Leuten aus der Siedlung konnte der Mann am Priel unten nicht gehören, denn er war weiß oder genau genommen rotgesichtig. Breitbeinig stand er da, ein Netzbündel in der einen und die Leine dazu in der anderen Hand, eins der Bleistücke von dem Rand des Netzes zwischen seinen Zähnen. Der Trick war, das Netz so zu schleudern, dass seine beschwerten Ränder es der Zentrifugalkraft folgend ausbreiteten, bis es sich in der Luft wie eine Frisbeescheibe drehte, nur langsamer, um dann mit seinen fast drei Metern Durchmesser flach auf die Wasseroberfläche zu fallen. Von dort sank der bleischwere Rand schnell, so dass das Netz sich wie eine Glocke über alles darunter wölbte. Beim Hochziehen wurden die Ränder über den Grund zur Mitte des Netzes gezogen, so dass am Ende einen geschlossener Ring blieb, aus dem kein Schwanz entkommen konnte.
Ein aufgesägter, blauer Plastikkanister neben dem Mannes quoll bereits über vor silbrigen Fischleibern. Er ließ uns das Netz untersuchen, drehte sich eine Zigarette und sonnte sich in unserem unverhohlenen Neid. Und schon war mein Teuerster in Wurfnetzlektionen gefangen.
Der Mann erzählte nebenbei in schwer verständlichem Slang, er sei bei der Forstbehörde angestellt, lebe mit seiner Familie in einem Wohnwagen auf der anderen Seite der Insel und lud unsere Kinder ein, mal mit den seinen zu spielen. Das ermutigte meinen Mann, der dem Wurfnetz schon verfallen war, zu fragen, ob er es sich für den Rest des Tages ausleihen könnte. Um es kurz zu machen: Gut eine Stunde später hatte das Netz den Besitzer gewechselt, gegen zwei Flaschen Schnaps. Da wir keine zum Tausch anzubieten hatten, sondern nur Geld, geriet die Transaktion allerdings bemerkenswert inseltypisch.
Wenn man sich nicht beizeiten auf dem Festland eingedeckt hatte, war auf der Insel schwer an Schnaps zu kommen. Die einzige Chance bestand darin, einen geheimen Ort in der Siedlung anzusteuern. Dass dort mehr zu holen war, als nur Salz oder ein paar Konserven aus den Bretterregalen des alten Benny war uns Newcomern bisher entgangen. Aber auch wir hatten schon von selbstgebranntem "Moonshiner" gehört. Unser neuer Freund bestand darauf, mich und die Kinder auf der Ladefläche seines verlotterten Pickups mitzunehmen. Ich meine wirklich verlottert, nicht nur so vom Seewind angerostet und klapperig wie alle übrigen Geländewagen auf der Insel. Ich vermute, dass er unsicher war, ob die Fahrt zur Siedlung Erfolg haben würde, und uns solange als Unterpfand brauchte. Warum er meinen Mann nicht mit haben wollte, weiß ich bis heute nicht. Wahrscheinlich war der Schnapskauf zu sensibel. Auch ich musste schließlich mit den Kindern in Bennys Wunderladen zurück bleiben und konnte die rau und lautstark in irgendwelchen hinteren Winkeln der Siedlung ablaufenden Verhandlungen nicht direkt mit verfolgen. Moonshiner schien eine Mangelware zu sein, deren Preis sich in Dollar plus Befreiung von Pöbelei rechnete. Jedenfalls kamen wir am Ende heil und erfolgreich zu der Brücke zurück, an der mein Mann noch immer übte. Den Trick, das Blei im Mund nicht zu früh und nicht zu spät los zu lassen, hatte er inzwischen raus, zum Glück ohne Schaden für seine Zähne. Es wäre ihm sichtlich schwer gefallen, das Wurfnetz wieder aus der Hand zu geben. Nachdem die Transaktion geglückt war, hatte auch der vorige Besitzer alles, was er wollte, jedenfalls für diesen Samstagabend und zog ab. Danach haben wir nie wieder etwas von ihm gesehen.
Dafür gesellte sich, ebenfalls magisch von dem Wurfnetz angezogen, Manuel zu uns. Er konnte nicht nur mit Krokodilen, sondern auch damit umgehen, er kam aus Kolumbien und promovierte auf Sapelo über in den Dünen lebende Bienen. Nun ließ er sein Fahrrad an der Brücke stehen und fuhr mit uns zusammen weiter. Auf dem Strand entlang war es nicht weit bis zu einem Priel, der die Insel von der Seeseite her durchschnitt.
Als wir ankamen, hatte gerade Ebbe eingesetzt. Der Priel füllte noch die ganze Breite seiner Mündung und wäre für den Pickup zu tief gewesen. Aber wir wollten auch nicht weiter. Das hier war die Stelle, wo das Wurfnetz zum Einsatz kommen sollte.
Bald wateten wir alle in dem trüben Wasser herum, das hüfttief über den Strand strömte. Die Kinder warfen sich in die Fluten und fingen an, sich ausgelassen zu bespritzen. Wir machten mit. An Fischen war bei der Toberei eh nicht zu denken. Die fand ein jähes Ende. Der Kleine hatte Sand in die Augen bekommen. Eine eilige Süßwasserspülung und ein paar Schlucke Cola später war der Schreck vergessen. Nutella-, Truthahn- und Käsebrote taten ein übriges dazu, den Frieden wieder herzustellen.
Indes war der Wasserpegel soweit gesunken, dass an flacheren Stellen einzelne Fische auszumachen waren, die gegen die Strömung dahin strebten, wo der Priel die Dünen verließ. An dieser Stelle grenzte die Salzmarsch, die der Priel entwässerte, direkt an die Dünenlandschaft. Die Marsch war ein von Krabbengängen durchlöchertes, schlickiges Watt, dessen Oberfläche sich dichte Muschelbänke und die Wurzelstöcke eines schilfartigen, salztoleranten Grases teilten.
Die beiden Männer begannen, das Netz nach den aufsteigenden Fischen zu werfen. Der erste Fang war die Sensation. Alle drängten sich, die drei Fische in die Hand zu nehmen oder wenigstens zu berühren. Es waren Meeräschen, sie hatten dicke, hochnäsige Köpfe mit ganz kleinen Mäulern. Mit Angeln waren sie nicht zu fangen, da sie mikroskopisch kleine Organismen fraßen. Es waren geschätzte Speisefische, und diese hier, so lang wie ein Unterarm, gerade richtig für die Pfanne. Ich beendete ihre letzten, verzweifelten Fluchtversuche mit einem Messerstich in den Nacken, wie mein Vater mir das als Kind bei unseren Angeltouren beigebracht hatte, damit sich die gefangenen Tiere an der Luft nicht unnötig quälten. Ich nahm die drei Exemplare sorgfältig aus und verstaute sie neben Bierdosen in einer von unseren beiden Eiskisten.
Der Priel veränderte sich mit der Ebbe stetig. Bald fiel an seiner Mündung auf unserer Seite eine breite Fläche trocken, in der ein lang gezogener, metertiefer Tümpel stehen blieb. Der Priel selber bildete nun landeinwärts einen tiefen Kolk, dessen Ablauf auf den Strand nur noch knietief war.
Am Kolk wechselten die Männer sich mit dem Wurfnetz ab, das von Mal zu Mal voller wurde. Auch die Kinder beteiligten sich daran, mit "Huch" und "Guck mal, guck mal!" die Fische aus dem Netz zu klauben und zur weiteren Bearbeitung bei mir abzuliefern.
Im immer flacheren Wasser des Ablaufs strebten immer mehr Fischleiber landeinwärts. Bald konnte man kaum noch im Wasser stehen, ohne mit einem zusammenzustoßen. Und dann entdeckten wir die erste Konkurrenz. Hier und da durchschnitt unverkennbar ein Dreieck auf Zick-Zack-Kurs die Oberfläche. Wir hatten nichts dagegen, den Segen mit den kleinen Haien zu teilen, die da unversehens mit von der Partie waren. In die erste Eiskiste passte auch schon keine Beute mehr. Dass die Männer eine Bierpause einlegten, schaffte kaum mehr Platz, ließ aber mir und den Kinder Zeit, in dem flachen Ebbetümpel auf der trocken gefallenen Fläche herum zu waten.
Das stehende Wasser hatte sich geklärt, so dass kleine Fische und Krebschen darin zu sehen waren. Für diese Art Beute waren die Maschen des Wurfnetzes zu groß. Dafür fanden sich andere Spezialisten ein. Auf einmal schossen große, schwarz-weiße Vögel dicht an uns vorbei. Zielsicher durchpflügten sie mit weit geöffneten, roten Schnäbeln die Wasseroberfläche über die gesamte Länge des Tümpels, genauer gesagt mit der unteren Hälfte ihres Schnabels, die gut doppelt so lang war, wie die obere. Fischlein, die in die Spur dieser Schnäbel gerieten, hatten keine Chance.
Die Frage, ob wir noch mehr Fische brauchten, stellte sich im Banne des allseitigen Jagdfiebers nicht. Wofür gab es schließlich Tiefkühltruhen! Mit glänzenden Augen zogen die Männer Netz um Netz schwer von Äschen an Land, ganz in Eintracht mit Haien und Vögeln. So vielen Fischen wie an diesem Tag habe ich in meinem ganzen übrigen Leben die Leidenszeit nach dem Fang nicht verkürzt. Dass ich ungeachtet der Massen und des Kopfschüttelns der Fischer dabei blieb, war nur noch mit meiner frühen Prägung zu erklären. Mit dem Ausnehmen war so oder so nicht nachzukommen. Die Ernte fing an, in Arbeit auszuarten. Die Kinder zogen es vor, am Ebbetümpel weiter zu spielen.
Nur zu schnell passte auch in die zweite Eiskiste keine einzige Äsche mehr hinein, obwohl die Getränke längst ausquartiert waren. Und so hockten wir schließlich nolens volens untätig am Priel, und sahen immer noch atemlos und mit fiebrigem Blick den Haien zu, die nicht aufhörten, sich voll zu fressen.
Die Sonne war inzwischen untergegangen und die Szenerie hüllte sich in ein letztes, kühles Violett. Selbst die Schatten schienen einig zu sein und mit uns zu schweigen. Nach so einem Beutezug mussten sich die Indianer hier genauso gefühlt haben. Was zählten schon tausend Jahre in solch einer Stunde? Dass die Jäger vor uns noch keine Tiefkühltruhen kannten und überschüssige Beute nur trocknen konnten, machte nicht wirklich einen Unterschied.
Seufzend strich Manuel mit einer Hand über die Maschen des Netzes auf seinen Knien. "Gibt einem das Gefühl, man könne seine Sippe ernähren", sinnierte er in die einfallende Dunkelheit hinein. Das kam aus tiefster Seele und mehr war dazu auch nicht zu sagen.