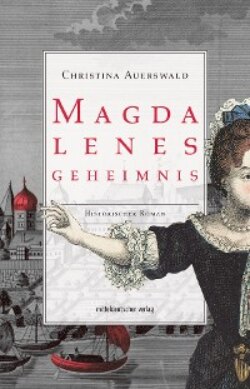Читать книгу Magdalenes Geheimnis - Christina Auerswald - Страница 5
1 . K A P I T E L
ОглавлениеAuch in dieser Nacht träumte Magdalene den alten Traum. Deutlich stand Jeans Gestalt vor ihr. Es war dasselbe Bild, das sie schon oft genarrt hatte: Sie sah, wie Jean den Pfad zu ihrer Hütte heraufkam, er hatte die Mundwinkel im Lächeln auseinandergezogen und winkte. Er winkte dem Mädchen in der Tür. Das war Magdalenes Gestalt, Magdalenes Körper, aber er winkte nicht ihr. Er winkte der anderen Frau, die er in ihr sah. Sein langes Haar wehte im Wind, sein verschlissener Mantel flog, er sprang über einen Stein. Die Kiesel spritzten unter seinem Schuh zur Seite; er kam näher, breitete die Arme aus und zog diese Frau an sich, die Magdalene war und die sie doch nicht sein konnte.
*
Am frühen Abend des 8. Juni 1690, einem Donnerstag, sprach Magdalene Bertram das erste Mal seit elf Monaten mit ihrer Freundin Sybille. Sie trafen sich zufällig, als das Mädchen vor die Haustür ihres Onkels in die Märkerstraße trat, um das dreckige Wischwasser auszukippen. Magdalene holte Schwung und schüttete es in einem hohen Bogen quer über die Straße. Die glitzernden Tropfen standen für einen Augenblick als silberner Bogen in der Luft und erloschen auf dem Boden. Magdalene streckte sich, um den Rücken geradezubiegen, und stellte den Holzeimer neben sich ab. Sie schaute sich um. Der Tag musste herrlich gewesen sein, denn auf dem gepflasterten Mittelstreifen der Straße lag noch der warme Glanz der Abendsonne, deren letzte Strahlen gerade über das Dach der gegenüberliegenden Akademie lugten. Ein spätes Fuhrwerk ratterte über die Steine, der Kutscher knallte die Peitsche, um das Pferd in seinem müden Trott noch das kurze Stück bis zum halleschen Marktplatz zu bewegen. Ein paar Hunde stießen auf der Suche nach Abfall ihre Schnauzen in den Staub. Fußgänger strebten der Ulrichskirche zu, die zwei Gassen hinter dem Haus der Familie Bertram steil aus dem Häusermeer aufragte, gut gekleidete Bürger auf dem Weg zur Abendandacht. In der Luft wogte ein Rest der Sonnenwärme dieses Tages. Magdalene wischte sich den Schweiß von der Stirn.
»He, Lene!« Ihre Freundin Sybille näherte sich. Sie war einer der Menschen, die immer zu lachen schienen. Von ihren schweren Pflichten im Haus gegenüber, der Ritterakademie, wirkte sie kaum gedrückt. Sybilles Kleid strahlte hell, als wäre es nicht grob und für die Arbeit gemacht. Sie trug einen Gemüsekorb über dem Arm, darin schleppte sie drei schwere Kohlköpfe. Den Korb schwenkte sie, als wären es Wollknäuel, und rief: »Wie schön, dich wiederzusehen! Es sieht alles aus wie früher. An deiner Arbeit hat sich nichts geändert, oder? Lässt sie dich immer noch wischen?«
Magdalene seufzte. »Das dritte Mal diese Woche. Sie macht ein Drama um diesen Fußboden, dabei ist er nur da, um drauf rumzutrampeln.«
Sybille streifte die Haube ab, und ihre rotblonden Locken quollen über die Schultern. Sie strich darüber, schlang die leuchtende Flut um die Hand und stopfte sie unter das grob gewebte Leinen. »Man sagt, du hast ganz schön was hinter dir.«
Magdalene nickte ernst.
Die Freundin zog die Stirne kraus und fragte flüsternd: »Und was hast du erlebt? Erzähl!«
»Tut mir leid, darüber kann ich nicht reden.« Magdalene verschränkte die Arme vor der Brust.
Sybille hob die Brauen: »Soso.« Sie spitzte den Mund. »Ein Kind hast du gekriegt, sagen die Leute. Hast du nicht eine Menge Ärger? Haben sie dich nicht bestraft? Auf jeden Fall wirst du jetzt schnell verheiratet werden. Das ist Strafe genug.«
Ehe sie weitersprechen konnte, knarrte hinter den Mädchen die Haustür. »Lene, ab ins Haus«, stach Tante Dorotheas Stimme zwischen die beiden. Bedauernd zuckte Sybille die Schultern und beugte sich über ihren Korb. Magdalene wandte sich ihrem Zuhause zu. Hier war sie auch nicht viel mehr als eine Magd.
Tante Dorothea hatte tagsüber die Verantwortung für Magdalene zu tragen. Das war schon früher so gewesen. Sie erzog das Mädchen zu dem, was sie für rechtschaffen, nützlich und sittlich hielt. Die Tante musterte Magdalene von oben bis unten. »Du wirst niemals eine brave Ehefrau, wenn du dermaßen nachlässig bist«, schimpfte sie. »Geh hinein und wische weiter, der Boden ist noch nicht richtig sauber!«
Die Tante war durch und durch flachsblond, ihre bleiche Haut, das Haar und ihre gelbliche Haube schienen in eins verschmolzen. Ihre knochigen Hände konnten kräftig zupacken. Zu alledem war sie lang und dürr und überragte ihren Mann um einige Zoll. Magdalene hob das Kinn und konnte ein Grinsen nicht verhindern. Tante Dorotheas Nase vibrierte vor Ärger dermaßen, dass der Tropfen, der ständig daran hing, ins Schaukeln geriet. Das Lächeln brachte dem Mädchen eine Kopfnuss ein, während es an der Tante vorüberschlüpfte.
Im Hof schöpfte Magdalene frisches Wasser in den Eimer. »Du wirst niemals eine brave Ehefrau«, äffte sie ihre Tante nach und verdrehte die Augen. Sie seufzte und wandte sich erneut der Arbeit zu.
Wie schon den halben Nachmittag glitt der löchrige Haderlumpen gleichmäßig über den Steinboden. Es war ein polierter Boden aus schwarzen und weißen Platten. Der Onkel hatte ihn erst vor zwei Jahren legen lassen. Magdalene wusste, dass er damit vor den Besuchern protzen wollte. Die Steinplatten lagen im Muster wie ein Schachbrett, das sah tatsächlich edel aus. Magdalene lag auf den Knien und biss die Zähne zusammen. Sie hatte die Ärmel aufgekrempelt und den Rocksaum in den Bund gesteckt, damit ihr Kleid nicht nass wurde.
Die Tante gab ihr Kontrollamt auf und stieg mit festem Schritt nach oben. Das Mädchen atmete durch und richtete sich auf. Kein Mensch würde sehen, ob sie jetzt noch länger über die Steine fuhr. Magdalene wrang den Hader aus, bis der mürbe Stoff riss. Wie den vorigen, trug sie auch diesen Eimer zur Haustür und schüttete das Wasser in hohem Bogen auf die Straße.
Sybille war nicht mehr zu entdecken.
Vor der Tür streckte sich Magdalene und krempelte die Ärmel herunter. Nachdenklich lehnte sie sich an die Hauswand. Die letzten abendlichen Sonnenstrahlen ruhten auf dem Gesicht der Siebzehnjährigen. Sie seufzte und wandte sich zurück zur Haustür.
Es war Zeit für das Abendessen. Die Familie aß erst in der Abenddämmerung und die hatte heute, gemessen am Hunger, viel zu lange auf sich warten lassen. Magdalene und die alte Magd Anna trugen das Essen über die breite Treppe mit dem gedrechselten Geländer hinauf in den ersten Stock. Gegessen wurde oben in der guten Stube. Unten, neben dem Eingang, lag zur Linken die Küche, zur Rechten die Bibliothek von Magdalenes Onkel Conrad. Er arbeitete in diesem Raum, da kamen die Besucher hin. Das Geschäft musste vorn am Eingang seinen Platz haben. Deshalb schleppten die Frauen, was es an Essen gab, jeden Tag hinauf in den ersten Stock.
Magdalene hielt die heiße Schüssel mit der nach Thymian duftenden Wurstsuppe in beiden Händen. Anna hinter ihr trug das runde Brot auf einem Brett und das breite Messer. Conrad Bertram trug kein Messer am Gürtel, wie es noch sein Vater und sein Großvater getan hatten. Das sei primitiv, sagte er. Wenn er eins brauchte, ließ er sich eins bringen.
Die Familie Bertram wartete. Conrad Bertram thronte auf seinem gewohnten Platz an der Stirnseite des schweren eichenen Tisches. Neben ihm, zu seiner Rechten, saß seine Frau. Ihre drei Kinder verharrten still und diszipliniert, wie sich das für die Erben einer wichtigen Familie gehörte, der zehnjährige Friedrich, flachsblonder hoffnungsvoller Sohn und Träger der Bertramschen Tradition, zur Linken des Vaters, Elisabeth, vierzehn, und Katharina, sieben Jahre alt, am Ende des Tisches links und rechts von Magdalene. Die Kinder einschließlich Magdalenes wurden während der Mahlzeiten alle gleich behandelt. Sie erhielten alle gleich viel zu essen, wurden gleichermaßen für Störungen bestraft.
Alle waren hier, die ganze Familie.
Nur Hans nicht.
Das Zeitmaß eines Essens bestimmte sich nach Conrad Bertrams Einsatz. Er war der Taktgeber in der Musik der Mahlzeiten. Sie begann, wenn er das Messer hob und das Brot schnitt. Anderswo schnitt sich jeder selbst sein Brot. Hier war es dem Hausherrn wichtig, seine Autorität im Kleinen zu beweisen; er allein schnitt das duftende Backwerk. Er hielt das Messer in seiner Linken und teilte das Brot nach einem bestimmten Maß zu. Er säbelte sich zwei große Scheiben von dem scharf gebackenen, krustigen Laib, die zweite erst, wenn die erste aufgegessen war, als würde er genießen, dass alle am Tisch ihm beim Abschneiden mit großen Augen zusahen. Das Brot wurde direkt in der Bertramschen Küche gebacken, es war schwer und dunkel und fest, damit es schön sättigte. Tante Dorotheas Scheibe war ebenso dick wie die ihres Mannes, die nächste erhielt der Sohn. Die drei Mädchen bekamen ein mageres Brotstück, durch das man hindurchsehen konnte.
Seit vier Wochen saß Magdalene wieder jeden Tag hier. Seit dem 9. Mai hatte sie jeden Tag zu essen, ein warmes Bett und ein dichtes Dach über dem Kopf. Sie tat vom folgenden Tag an wie früher ihre Pflicht in diesem Haus, nachdem sie für ihr Kind eine Kiste zum Schlafen beschafft und es zum ersten Mal richtig gewickelt hatte. Am Nachmittag des 10. Mai ging der Onkel mit ihr zur Ulrichskirche. Es war ein kurzes Stück Weg von seinem Haus in der Großen Märkerstraße bis zur Kirche, trotzdem schnaufte er, weil er schnell ging, um von niemandem auf diesem Weg gesehen und angesprochen zu werden.
Conrad Bertram war ein betuchter Bürger, massig, dunkelblond und im besten Alter. Sein Haar war kurz geschoren, weil er draußen die große Perücke trug, ohne die ein Mann von Stand nichts galt. Rund wölbten sich die rosigen Wangen, unter ihnen der Ansatz von Doppelkinn. Den fein gewebten Stoff seines Rockes hatte Magdalene wie befohlen gut ausgebürstet. In seiner Rocktasche steckte ein hellblaues Tüchlein von der Farbe seiner Augen, das ihm vor seinen Klienten ein gewisses Maß an höfischer Gewandtheit verleihen sollte. Conrad Bertram galt als wichtiger Mann in der Stadt Halle. Er hatte ein achtjähriges Rechtsstudium in Jena und Wittenberg vorzuweisen, praktizierte als Jurist für ausgewählte Klienten und beriet den Vorstand der Ulrichskirche in gewissen Angelegenheiten. Sein Sinnen und Trachten ging dahin, ein noch wichtigerer Mann zu werden. Das Vorsteheramt in der Ulrichskirche war vakant und er hegte große Hoffnungen, erwählt zu werden, denn der Name Bertram besaß in Halle und in der Ulrichskirche einen guten Klang. Sein Vater Sixtus Bertram, Magdalenes Großvater, war Pfarrer in der Ulrichskirche und Schullehrer gewesen. Conrad Bertram atmete schwer, da er die Last seines Schmerbauches zu tragen hatte und auch sonst muskulös war, wie seine Frau es auszudrücken pflegte. Er ging langsam und geriet darüber schnell in Schweiß. Wie er sich bewegte, war auch sein Reden. Dafür nutzten die Leute allerdings das Wort »wohlüberlegt«. Seine Stimme tönte tief und flößte durch ihre Lautstärke Respekt ein, eine Fähigkeit, die seinem Beruf dienlicher war als zaghaft vorgebrachte Klugheit.
Der Onkel kannte den Pfarrer der Ulrichskirche gut, einen Amtsnachfolger seines eigenen Vaters. Er schob Magdalene vor sich her in die Kirche hinein, wo der Pfarrer wartete. Magdalene trug das Kind auf ihren Armen. Es war in ein weißes Tuch gewickelt und schlief friedlich.
Der Pfarrer waltete seines Amtes schnell und effizient. Er taufte den Kleinen auf den Namen Johannes Conrad Bertram. Magdalene sah das Taufwasser über die kleine Stirn rinnen und dachte darüber nach, wo man den kleinen Hans getauft hätte, wenn sie nicht zurück nach Halle gegangen wäre.
Das Kind verschlief die Taufe. Wie auf dem Hinweg nahm Conrad Bertram seine Nichte schnell und unauffällig mit nach Hause. Dort stellte sie sich in die Küche zu Anna und begann ihre Arbeit. Das Kind blieb bei ihnen.
Es war in den vergangenen vier Wochen ihr Alltag geworden, in der Küche zu stehen oder im Haus diejenigen Arbeiten zu verrichten, für die Anna allmählich zu alt wurde. Magdalene verließ das Haus nicht. Vier Wochen lang wiegte sie sich in dem Glauben, sie wäre unsichtbar für alle Menschen und von den Nachbarn wüsste keiner, dass sie wieder da war. Das war, bei Lichte betrachtet, Unsinn. In einer Stadt wie Halle, mit zehntausend Einwohnern, konnte man nicht unbeachtet leben, erst recht nicht als Nichte eines bedeutenden Mannes. Es war Stadtgespräch, dass man Magdalene, o Wunder, nach mehr als einem Dreivierteljahr lebend wiedergefunden habe. Dass an der Sache einiges Rätselhafte war, machte sie erst richtig interessant.
Magdalene spürte es, als sie Anfang Juni das erste Mal sonntags mit den Bertrams in die Kirche gehen musste. Wenigstens waren ihr Gesicht wieder glatt, die Schwellung und das blaue Auge verschwunden. Sie sah die Blicke rings um sich aufflammen. Keiner sprach sie an, aber alle Leute beobachteten sie. Jeder malte sich bei ihrem Anblick aus, was geschehen sein mochte. Sie hatte den Hans zu Hause gelassen, trotzdem musterten die Nachbarn unverschämt ihre volle Brust und ihren Nacken hinter dem gesenkten Kopf, als wäre es nötig, sie darauf zu schlagen.
Als sie zu Hause war, stürzte sie in ihre Kammer und heulte eine Stunde lang, ohne das Kind zu beachten, das nach Nahrung schrie. Am Ende der Stunde wischte sie sich das Gesicht ab und wandte sich Hans zu. Es sollte so sein. Wenn sie es sowieso alle wussten, konnte sie ohne Scheu ihren Platz in der Stadt einnehmen.
Bei Tisch wurde nicht gesprochen. Kaum ein Ton war während der Mahlzeiten zu hören. Selten erhob einer der Erwachsenen die Stimme, und wenn, war das meist Conrad Bertram.
Heute war so ein Tag. Er blickte von seiner Schüssel auf und befahl: »Magdalene, ich erwarte dich nachher in meinem Arbeitszimmer.«
Den Gefallen, ihren Namen in seiner vollen Länge auszusprechen, tat Magdalene hier niemand. Sie nannten das Mädchen in diesem Haus Lene, wie früher als Kind, obwohl sie selbst Mutter war und ihr voller Name Magdalene Aurora Veronika Bertram lautete. Anna durfte Lenchen zu ihr sagen, sonst hatte sie niemandem gestattet, ihren Vornamen abzukürzen. Sie kämpfte mit sich, auf ein: »Lene!« zu antworten: »Ich bin alt genug und habe ein Anrecht auf meinen vollen Namen.« Aber sie wagte es nie.
Wenn der Onkel sich die Mühe machte, sie Magdalene zu nennen, musste es einen besonderen Anlass geben. Erst zwei Mal hatte er das bisher getan: das erste Mal, als er ihr vor neun Jahren mitteilte, dass er ihr Vormund geworden war, das zweite Mal, als er ihr die Nachricht vom Tod ihres Bruders überbrachte. Nun hatte er wieder »Magdalene« gesagt.
Sie löffelte ihre Suppe eilig aus der Schüssel und wartete, bis alle anderen aufgegessen hatten. Gemeinsam mit Anna räumte sie ab, trug das Geschirr in die Küche und lauschte den Schritten des Onkels, der in seine Bibliothek ging. Sie wischte sich die Hände an der Schürze ab und folgte ihm hinüber, wo er vor seinem mächtigen Schreibtisch saß. Er wies mit der Hand auf den hölzernen Scherensessel, auf dem die Besucher platziert wurden. Sie hockte sich hin und fühlte sich gleich wie mit Eisenstiften festgenagelt, während der Onkel mit den Fingern auf seinem Tisch trommelte. Tante Dorothea tappte draußen vorbei und klinkte die Tür ein, als wüsste sie Bescheid. Magdalene blieb allein mit dem Onkel, er vor seinem Tisch, sie im leeren Raum, mit nichts vor sich als ihren gefalteten Händen auf der Schürze. Er hatte »Magdalene« gesagt.
Nun stand er auf und rieb sich die Hände. Es war wirklich nicht kalt hier. Er rieb sie mit einer selbstvergessenen Zufriedenheit und tat drei Schritte zu den Fenstern hin, die auf die Märkerstraße hinausgingen. Sein Haus besaß viele Fenster, drei zu jeder Seite der Tür und sieben in der Etage darüber. Er blieb vor dem mittleren der drei Fenster seines Zimmers stehen.
Er sagte noch einmal »Magdalene« und begann ein Klagelied, das sie zur Genüge kannte und das jedem Besucher vorgesungen wurde. Die Kosten für ein Mündel. Besonders für dieses Mündel, das ungezogen war. Die Nachsicht, die endlich sei, denn an den Umständen der schlechten Zeit könne es nicht mehr liegen, wo er sein Bestes getan habe, sie gottgefällig zu erziehen. Der Undank, zu verschwinden und nach einem Dreivierteljahr aufzutauchen, als sei nichts geschehen, obwohl der Kummer sie alle fast umgebracht habe. Und die Schande, die sie über sein Haus gebracht habe, seit sie eine Hure geworden wäre. Jetzt war er beim Kern der Sache.
Er hatte ihr dieses Schimpfwort nie ins Gesicht gesagt, nicht einmal, als er sie in ihrem verwahrlosten Zustand ankommen sah. Und nun nannte er sie eine Hure. Magdalene reckte sich. Sie war immer noch eine Bertram. Sie war keine Bettlerin oder Hausierersfrau, dass er so mit ihr umgehen durfte. Was die Leute redeten, wollte sie nicht wissen. Selbst wenn sie sich das Maul zerfetzten – was sie mit Sicherheit taten – hätten sie nicht gewagt, das Wort laut vor ihr auszusprechen.
Ihr Onkel tat es. Er wollte Magdalene demütig und schuldbewusst sehen. Er wusste, dass es sie treffen musste und kannte sie genug, um sicher zu sein, dass es an ihrem Gesicht trotzdem nicht abzulesen sein würde. Sie verstand, dass er etwas von ihr wollte, was er sonst nicht bekam. Etwas, für das er das Wort noch einmal wiederholte und noch einmal und noch einmal.
Der Scherensessel, auf dem Magdalene saß, knarrte. Er war aus schwerer dunkler Eiche und besaß ein geschnitztes Muster in der Rückenlehne. Sie kannte diesen Stuhl schon lange. Er stand früher in der Stube ihres Vaters, sie war darauf herumgeklettert, als sie klein war. Magdalene presste den Rücken gegen die Stuhllehne. Das Relief der Schnitzerei, ein verziertes Oval, drückte gegen ihr Rückgrat. Das stärkte sie: Ein Stück ihrer alten Familie war bei ihr, wenn auch nur ein lebloser Stuhl. Es war ein Stück aus der Zeit, als die Welt noch gerecht war und sie ein unschuldiges Kind.
Der Onkel brauchte lange, bis er mit seinem wirklichen Anliegen herausrückte. Er wischte mit dem hellblauen Tüchlein den Schweiß von seiner Stirne, ging vom Fenster zurück zur Tischkante, wippte auf den Fußspitzen und trommelte mit den Fingern auf dem Tisch. Er räusperte sich. Magdalene hielt den Blick sittsam gesenkt, um ihm zu zeigen, dass sie so weit war, Magdalene als gehorsames und stilles Mündel zwei Ellen unter seiner Nasenspitze. »Die Schande muss aus der Welt. Entweder du sagst mir auf der Stelle, wer dich verführt hat, damit wir Ordnung in dein Leben bringen können, oder ich werde dich in Kürze verheiraten.«
Nun schwieg er. Er wartete. Er ließ sich Zeit, das hatte sie ihm nicht zugetraut. Das Ganze war ihm unangenehm, der Schweiß auf seiner Stirne bewies es. Sein Schweigen konnte aber auch einen anderen Grund haben. Er hatte sein Pulver verschossen, seine Rede war wohlüberlegt, doch endlich, und es gab nichts mehr zu sagen.
Er konnte unmöglich erwarten, dass sie ihm einen Namen nannte. Magdalene war seit mehr als vier Wochen wieder bei ihnen, und all die Tage war es ihm nicht gelungen, ihr einen einzigen Kommentar zu der Zeit zu entlocken, in der sie das Mädchen für ertrunken hielten. Wenn sie dort hätte bleiben wollen, wo sie gewesen war, hätte sie ihren Onkel nicht gebraucht. Wenn sie den Vater ihres Kindes hätte haben wollen, hätte sie ihrem Onkel nur seinen Namen nennen müssen. Er hätte schon lange für Ordnung gesorgt.
Nein, kein Wort über diese Zeit verließ ihre Lippen. Das wusste der Onkel genau, er kannte sie gut genug. Also konnte er in Wirklichkeit nur eins im Sinn haben: das, was er ihr für den Fall androhte, dass sie schwieg.
»Was soll die lange Vorrede? Es ist doch schon abgemacht. An wen wollt Ihr mich verschachern?«
Die Ohrfeige tat nicht weh, da sie saß und er zur Seite abrutschte, so schnell, wie er den Schritt auf sie zu gemacht hatte. Magdalenes Gedächtnis arbeitete präzise, sie zitierte Lukas 16, Vers 15: »Ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen, Gott aber kennt Eure Herzen.« Das brachte ihn aus dem Konzept, schließlich kannte er die Bibel so gut wie auswendig. Er blieb im Abstand von zwei ganzen Stühlen vor Magdalene stehen. Knapp antwortete er, seine Augen funkelten. »Es ist der Händler Rehnikel, der unten am Tal wohnt.«
Ein Händler. Er achtete sonst sehr auf die Stellung der Familie. Magdalene war eine Bertram! Nie hätte sie für möglich gehalten, dass er sie derart unstandesgemäß verhökerte. »Er ist keiner von denen, die bei Wind und Wetter am Markt stehen müssen. Die Leute kommen zu ihm«, fügte er hinzu.
Magdalene platzte heraus: »Ich denke nicht daran, einen alten Mann zu heiraten!«
Damit erntete sie eine zweite Ohrfeige, die besser saß und ihr den Hinterkopf an die Stuhllehne schlug. Das Mädchen ließ nicht zu, dass der Onkel ihr den Schmerz ansah. Sie verschloss die Ohren vor der Rede, die ihr Onkel jetzt schwang, aber sie konnte nicht verhindern, dass die Worte: »Das ist mein Recht!« in ihr Hirn drangen. Er war der Vormund. Sie konnte nichts ändern. Er konnte sie verheiraten und würde es zweifellos tun, da er glaubte, mit einem gut untergebrachten Mündel dem Vorsteheramt näher zu sein.
Es war beschlossene Sache, sie sollte die Frau eines Händlers werden. Von nun an musste sie behutsam sein, denn was jetzt entschieden wurde, galt für ihr restliches Leben. »Da Ihr es so eilig habt«, fragte Magdalene den Onkel, »habt Ihr den Herrn sicher schon für morgen eingeladen.«
Er lächelte süßlich. »Für heute, Mädchen. Er kommt in einer Stunde.«