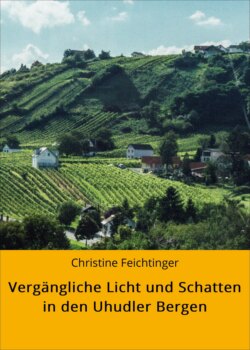Читать книгу Vergängliche Licht und Schatten in den Uhudler Bergen - Christine Feichtinger - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Rosenheim, Feber 1945
ОглавлениеAn einem wunderschönen, klaren, kalten Wintertag öffnete Irene Schmidt das Fenster des Lazaretts, in dem sie als Krankenschwester beschäftigt war.
Wehmütig beobachtete sie alle durch Bomben beschädigten Häuser, alle Ruinen, welche wie durch einen märchenhaften Winterzauber von einer weißen Schneedecke eingehüllt waren. Große Schneeflocken, vom eiskalten Wind in alle Richtungen geblasen, setzten sich auf den gefrorenen Schoß der Mutter Erde. In der Sonne glitzerten Schneekristalle auf der Schneedecke als wollten sie wie zum Trost die der Stadt vom Feind zugefügten Wunden mit einem weißen Leichentuch zudecken, für immer begraben und die trügerische Hoffnung schüren, dass nach der Schneeschmelze alles wieder unzerstört auftauchen würde, alles nur ein böser Traum gewesen sei und im Frühjahr unbeschadet, so wie seit ewigen Zeiten, neues, friedliches Leben sprießen könne.
Wie jedem anderen Betrachter schien auch Irenes Herz zu zerbrechen, wenn sie die Zerstörungen ihrer Heimatstadt Rosenheim durch den Feind ohnmächtig mitansehen musste. Seit 1942 hatten die Bombardierungen der Feinde ihrer Heimatstadt viele Schäden zugefügt, viele schmucke und wertvolle Bauwerke zerstört und viele unschuldige Menschenleben gefordert.
Abgemagerte, verbitterte, traumatisierte Menschen suchten in den Trümmern nach Essbarem oder Kleidung, streunende, herrenlose Tiere, Kleinkinder irrten herum. Alleinstehende Kinder hatten sich zu stehlenden und bettelnden Banden zusammengeschlossen, um zu plündern, trauernde Witwen und Mütter, Schwestern in alte Lumpen gekleidet, irrten mit humpelnden, blutenden Verwundeten und alten Menschen ohne Zukunftsperspektive herum, welche oft lieber tot als lebendig gewesen wären.
Ohnmächtig musste Irene zusehen, wie ihre Heimatstadt förmlich vor ihren Augen, beginnend mit 20. 10. 1944 von den Alliierten mit gezielten Angriffen auf die Zivilbevölkerung, Häuser und Straßen und als wichtiges Angriffsziel die Bahnanlagen, galt Rosenheim doch als wichtiger Schnittpunkt der Bahnverbindungen München – Salzburg – Wien und München – Innsbruck – Italien, zerstört wurde. Dort, wo früher Fabriken, zahlreiche Unternehmen, die Salzgewinnung mit vielen Beschäftigten, mit Gleisanschlüssen zum Bahnhof versehen waren, alteingesessene, seit Generationen bestehende Handwerksbetriebe ihrem Gewerbe nachgingen, Geschäfte, Ärzte, Apotheker, der wirtschaftliche Schwerpunkt im Süden Bayerns etabliert war, Promenaden mit Grünflächen, Villen, blühenden, pulsierenden Gassen, Einkaufsstraßen gelegen waren, tobte nun das Grauen und die Zerstörung, sodass die Stadt aus allen Wunden blutete.
Irene wünschte sich nichts sehnlicher, als dass dieser Albtraum zu Ende wäre. Wie gerne hätte sie das Elend hier in der Stadt, die zertrümmerten, rauchenden Ruinen, die Verwüstungen und Zerstörungen der Stadt in Schutt und Asche, Bombenangriffe als nicht geschehen und als ein böser Traum gesehen. Wenn sie die Not der Menschen, den Verwesungsgeruch, der den Menschen oft die Besinnung nahm, sodass sich alle ein Tuch vor dem Mund hielten, sah, überkam Irene das Grauen.
Ein Grünspecht in seinem schillerndem Gefieder hatte sich vor ihren Augen, Zuflucht suchend, auf einen, wie mit Puderzucker angezuckerten Baum ihr gegenüber gesetzt, genauso, als wolle er sie wie ein Bote vom Himmel aufheitern und ihre Sorgen zerstreuen. Beim Anblick dieses kleinen Geschöpfes traten unvermutet ihre glücklichen Kindheits- und Jugenderinnerungen an diese einstmals blühende Stadt vor Kriegsbeginn in ihr Bewusstsein.
Seit Kindesbeinen war sie glücklich gewesen, wenn sie mit ihren Eltern durch die pulsierende Stadt schlendern konnte, die vornehmen Bürgerhäuser, die Sehenswürdigkeiten der Stadt, den Leuchtturm, das Alte Rathaus bewundern oder mit der Straßenbahn Runden drehen konnte. Sie wuchs wohlbehütet im Kreise ihrer Familie auf und besuchte oft mit ihren Eltern die Museen, die Stadtbücherei, etliche Konzert- und Theaterveranstaltungen. Es wurde zur Gewohnheit, dass sie fast jeden Sonntagnachmittag, wenn das Wetter schön war, mit einem Picknickkorb Ausflüge ins Grüne oder eine Bootsfahrt mit dem Dampfer auf dem Inn unternahmen. Wie oft saß sie später mit ihren Backfischträumen stundenlang am Ufer des Flusses, sah den vorbeifahrenden Schiffen zu und wünschte, ihr Traummann würde ihr von einem der Dampfer zuwinken.
Sie atmete die frische Luft ein und versuchte sich in diesem Augenblick der Ruhe und des Friedens kurz zu erholen. Trotz dieser sentimentalen Gedanken empfand sie diese Ruhepause wie ein geborgtes, trügerisches Geschenk, gönnerhaft von einem guten Geist ihrem Schicksal abgetrotzt. Bewusst versuchte sie ihr Leiden und das Elend der leidgeprüften Mitmenschen mit der ständigen Todesangst vor dem Sirenengeheul, herankommenden feindlichen Bombern, Hunger, Angst und Kälte, die Schmerzen der Patienten, der verwundeten, verstümmelten Soldaten mit zerfetzten Körpern in ihrem Krankenhaus und die übergroße Angst vor dem gewaltsamen Eindringen des Feindes auszublenden.
In diesem Moment sah sie auf der Straße dick vermummte, abgemagerte, hungrige, entmutigte Frauen, bedrückt, ohne Hoffnungsschimmer mit ihren quengelnden, hungrigen Kindern an den Händen in der Kälte in Schlangen vor den Lebensmittelgeschäften angestellt. Als könnte ihnen ihr Kriegsspielzeug, nachempfundene Miniaturen von SA-Leuten, SS, Hitlerjugend, Hitler, Göring, Goebbels, Kanonen, Armeelastwagen, Kavalleriepferde, Panzer, in ihrer Angst helfen, umklammerten die Kinder es fest. Frierende alte Männer und Frauen, enttäuscht über die geringe Ausbeute trotz stundenlangen Stehens, zogen sich ihre warmen Hauben und Mäntel schützend an den Körper und ihr warmer Hauch stieg in der kalten Luft auf.
Genauso wie sie selber hatten diese Menschen jede Sekunde Angst um ihr eigenes Leben und das ihrer Familie, wissend, dass jeden Augenblick alles, was ihnen lieb und teuer war, wie ein Kartenhaus in Schutt und Asche liegen konnte. In den Gesichtern dieser leidgeprüften Menschen widerspiegelte sich ihre eigene Angst, als wären alle Stadtbewohner durch Not und Elend zusammengeschweißt wie Brüder und Schwestern.
Nie hätte Irene es für möglich gehalten, dass sie sich gerade jetzt in dieser angsterfüllten Stimmung verlieben hätte können und die große Liebe in Form eines jungen Patienten aus dem Gau Steiermark (früher Südburgenland) namens Karl Ertl in ihr Leben getreten war.
Als Irene Schmidt Karl Ertl, welcher durch einen Granatsplitter verwundet war, das erste Mal in ihrem Krankenhaus sah, merkte sie, wie ein Schauer von Hitze und Kälte abwechselnd und wohltuend in ihrem Körper aufflammte.
Wie verwandelt schwebte sie von einer Sekunde zur anderen in unsichtbare, himmlische Sphären, als wäre sie urplötzlich in eine andere Welt eingetreten. Ihr Herz schlug wie verrückt, ihr Pulsschlag erhöhte sich und sie spürte wie die Röte und die Hitze in ihr Gesicht schoss und ihre Hände zitterten. Am liebsten hätte sie diesen Augenblick lebenslang festgehalten und sich nicht von der Stelle gerührt.
Für einen kurzen Moment drehte sie sich beschämt um, damit er ihre Gefühlsregung und ihre Verlegenheit, wie bei einer pubertierenden Göre, nicht bemerken sollte. In der Angst, sie hätte sich getäuscht, er wäre eine Märchengestalt und wieder unsichtbar, drehte sie sich wieder zu ihm um. Er lächelte sie unsicher an und seine großen, blauen Augen hafteten wie unschuldige Kinderaugen begehrlich auf ihrer brennenden Haut. In diesem Moment wusste sie sofort, dass er der Richtige war und sie sich insgeheim schon lange nach diesem Mann gesehnt hatte.
In seinen Augen glaubte sie die Fähigkeit zu sehen, dass er tief empfinden, stürmisch lieben und jederzeit verzeihen würde können. Wie auf einer Wolke schwebend fühlte sie sich vom ersten Augenblick an zu ihm hingezogen, als würde sie ihn ewig kennen. Sie musste sich vehement gegen ihr innerstes Begehren wehren, denn, wie von einem warmen Maiduft nach langem Schnee und Eis dahingeschmolzen und befreit, wäre sie am liebsten zu ihm gegangen, hätte seine Hand gestreichelt, ihn liebevoll an sich gedrückt und ihm ein scheues Busserl gegeben.
Seitdem Irene Karl das erste Mal gesehen hatte, brachen ihre Gedanken immer wieder wie von selbst aus und steuerten in eine schöne Scheinwelt. Oder war ihre Verliebtheit eine vorgegaukelte Scheinwelt und würde sie sich bald als trügerisch erweisen? Zwischendurch trat ein Gefühl der Unwirklichkeit ein, als ob sie alles nur träumen würde, sodass sie öfters versucht war sich zu zwicken, um festzustellen, dass alles real war.
In der Folge begann sie nachzudenken, ob er sie lieben würde. Sie versuchte insgeheim in ihm Falschheit und Hinterlist zu ergründen, konnte aber keine Anzeichen finden. Vielleicht war ihr diese Scheinwelt als eine Art Schutzmechanismus und Überlebenshilfe vorgegeben, um in dieser grauenvollen Zeit nicht verrückt zu werden und instinktiv vor den Vorboten der Hölle zu flüchten.
Aber vielleicht täuschten sie ihre Gefühle nicht und er würde genauso in sie verliebt sein und mit ihr sein zukünftiges Leben in guten und in bösen Tagen verbringen wollen?
Mehrmals täglich erwischte sie sich, wenn ihre Gedanken bei ihm waren und sie ihn mit verstohlenen Blicken suchte, um wenigstens einen Blick von ihm zu erhaschen, oder sie sich aus unerklärlichen Gründen in seine Nähe stahl, denn wenn sie ihn nur ansehen konnte, war ihr Tag gerettet. Sie konnte sich diese bisher unbekannte Unruhe und Sehnsucht nach einem Mann nicht erklären. Es traf sie wie ein Blitz aus heiterem Himmel. So etwas war ihr bis jetzt noch nicht passiert.
Irene war fest entschlossen, ihrem Glück Raum und Zeit zu geben, es wie einen geheimen Schatz in ihrem Herzen zu bewahren, um in äußerstem Herzeleid und Not ein klein wenig davon zu naschen, als Labsal für die Seele, um die Mühsal ihres Lebens besser zu überstehen und ihr Glück trotz des Schrecken des Krieges bewahren zu können.
Immer öfters versuchte sie die ständige Angst und Sorgen in ihrem Kopf zu verscheuchen, um Freiraum für die neue aufkeimende Liebe zu gewinnen. Abends betete sie inständig, ihr kleines, geheimes Glück würde dem Verderben rundherum standhalten und ewig dauern.
Als Karl Ertl nach einem feindlichen Angriff durch einen Granatsplitter verletzt, umringt von schreienden, wimmernden, verstümmelten, zerfetzten Kameraden und unzähligen Leichen da lag, hatte er zuerst nach kurzem Schock nicht seine eigene Verletzung, sondern nur sein Umfeld wahrgenommen. Er konnte den Anblick so vieler wimmernder Verwundeter, Freunde und Vertrauter, die er gut kannte, fast nicht ertragen, da er jede Gewaltanwendung und jedes Blutvergießen sowohl an Menschen als auch an Tieren verabscheute. Die Ohnmächtigkeit und die Gewissheit, dass er seinen verzweifelten Freunden nicht helfen konnte, ekelte ihn an.
Als er verwundet im Wald lag, hätte er sich vor lauter Schmerzen am liebsten mit seinem Bajonett das verletzte Bein abtrennen wollen. Nachdem er von einem Priestersoldaten, welcher als Krankenträger fungierte und oft unter Einsatz seines Lebens selber Angriffsziel war, geborgen wurde, war er froh nicht übersehen worden zu sein, um nicht verbluten zu müssen. Die Sanitäter des Roten Kreuzes winkten mit einer Rot-Kreuz-Flagge dem im Tiefflug herannahenden feindlichen Flieger zu, um anzuzeigen, dass hier Verletzte seien. Der Pilot des feindlichen Fliegers verstand das Signal und schoss nicht. Während er geborgen und weggetragen wurde und sich schon in Sicherheit wähnte, wurde er wieder von einem Granatsplitter getroffen.
Infolge des Blutverlustes schwanden seine Kräfte. Er glaubte sterben zu müssen. Kurz besah er seine Erkennungsmarke und der Gedanke, dass der obere Teil dieser Erkennungsmarke ihm vor seiner Beerdigung in die Mundhöhle deponiert werden und der untere Teil zur Erfassung der Gefallenenzahlen bald der Wehrverwaltung zwecks Registrierung seines sinnlosen Todes und des Todesortes zugehen könnte, seine Angehörigen von seinem Tod erfahren, er in fremder Erde begraben würde, erschütterte ihn. Wenn er wenigstens seine Stiefel seinem jüngeren Bruder zukommen lassen könnte, damit sein Tod irgendeinen Sinn gehabt hätte.
In seinen Albträumen hämmerte der Kanonendonner, als stünde er im Kugelhagel, dem geheiligten Befehl zum Töten ausgeliefert. Die Bilder vom Stehen im wasserüberfüllten Schützengraben voller Ratten und Mäuse, die Kälte, der Hunger, das Heimweh, die Gräuel und das Gemetzel, das Kreuzzeichen vor jedem Angriff, den Tod immer vor Augen, die morgendlichen Gebete ums Überleben, die abendlichen Dankesgebete überlebt zu haben, verschwanden öfters hinter einer Nebelwand und kamen immer wieder wie ein Geist zurück.
Wie viele Tode war er gestorben? Immer wenn er den Anblick der verstümmelten, blutenden oder toten Kameraden, die Schreie, das Betteln um den Gnadenschuss, das Todesröcheln seiner Kameraden, die sterbenden Pferde vor sich sah, fragte er sich beim Anblick des Grauens fast schuldbewusst, warum er überlebt hatte. Unvergessliche Bilder des Krieges verdunkelten ihm seine Sinne. Wie oft schreckte er auf mit der Angst, allein und verlassen, hilflos dem Inferno der Leichenberge gegenüber und der Gedanke, dass ihn eine Kugel jede Sekunde töten konnte.
Neben der Hoffnungslosigkeit, Resignation, Zukunftsängsten, Angst, sein früheres unbekümmertes Leben nie wieder führen zu können, der Furcht, zur Rechenschaft gezogen zu werden, der Angst um sein Leben und das Leben seiner Familie, war die immerwährende Furcht zugegen, dass die Versorgung und der Nachschub ausbleiben könnte.
Bei jedem feindlichen Angriff kamen die Todesängste wie ein Schreckgespenst hervor und die Angst vor der Zukunft wurde zu seinem ständigen Begleiter.
Niemals durfte er seine Angst, seine seelischen Qualen und sein Leid hinausschreien, keine Gefühle zeigen und allen Schmerz unterdrücken. Folgsam, ohne Hinterfragen des geheiligten Befehls, hatte er wie eine mechanische Marionette zu funktionieren und jede Barbarei mitzumachen.
Verschweigen musste er auch seine Angst vor einem Gaskrieg, seine feste Ansicht, dass der Krieg verloren war und alle Opfer umsonst waren, um nicht als Vaterlandsverräter zu gelten. Jeder wusste, ein zweifelnder Soldat war ein schlechter Kämpfer. Dieses Wissen und die Tatsache, dass dennoch immer jeden Tag so viele seiner Kameraden verletzt wurden, bzw. ihr Leben lassen mussten, sie alle aber Mut, Tapferkeit und Siegessicherheit heucheln mussten, hatten ihn zusätzlich seelisch krank gemacht und so hatte er angefangen, sich wegen seiner Falschheit und Heuchelei zu hassen, was ihn innerlich, wie ein böses Krebsgeschwür, zerfraß.
Die anderen Qualen und inneren Narben, welche mit dem Auge nicht erkennbar waren, musste er vor seinen Kameraden und Befehlshabern ebenso verschweigen, denn sonst wäre er in der militärischen Rangordnung wie ein Drückeberger, Feigling, Simulant oder Deserteur angesehen worden.
Wie oft versuchte er die Dämonen zu vertreiben und seine Gedanken und Träume in einen Friedenstraum, in dem nie wieder Krieg sein würde, zu lenken, wo er sein altes unbekümmertes Leben wieder führen konnte.
Kurze Zeit später, als Karl Ertl das Krankenhaus in Rosenheim vor sich sah, hätte er trotz seiner Schmerzen am liebsten vor Freude laut geschrien, was für eine Erlösung es für ihn war, nicht mehr im Kugelhagel stehen zu müssen und dadurch für einige Zeit dem Leid und Elend, dem Hunger, der Kälte, dem qualvollen Schreien und Stöhnen seiner Kameraden, dem Anblick der verwundeten oder toten Kameraden entflohen zu sein, und dem eigenen Tod ständig ausgeliefert zu sein, zu entgehen. Insgeheim stieß er ein Stoßgebet aus, indem er sich heimlich für seine Ruhepause bedankte.
Im selben Moment glaubte er seine fahnenflüchtigen Kameraden, Kriegsdienstverweigerer, Kameraden, welche eine Krankheit vortäuschten, um nicht an die Front gehen zu müssen, um dem Horror zu entgehen, sich selbst verletzten, um in einem Lazarett sicher zu sein, um ihr Leben zu retten, besser verstehen zu können, obwohl er selber nie zu jenen gehören wollte.
Andererseits bereitete es Karl Gewissensbisse hier im Krankenhaus geborgen zu sein, während seine Kameraden unter Einsatz ihres Lebens kämpften. Es kam ihm irgendwie wie eine egoistische Flucht, als hätte er seine Kameraden im Kampf im Stich gelassen, vor.
Im Krankenhaus machte er bald Bekanntschaft mit anderen verletzten Soldaten, welche ihm erklärten, dass er Glück gehabt hätte, denn sie hatten gesehen, dass sogar das Rote Kreuz beschossen worden war, sodass viele Sanitäter gestorben waren.
Dass hier in diesem Krankenhaus in Rosenheim sein Leben eine derartige Kehrtwendung erfahren würde, konnte Karl Ertl nicht ahnen.
Wie von selbst gesteuert, als eine Fügung Gottes von höherer Macht geleitet, war auch in Karl Ertl in derselben Sekunde, als er Irene das erste Mal sah, die große Liebe eingekehrt.
Karl Ertl hatte noch nie ein schöneres, gepflegteres, sanftmütigeres Mädchen gesehen. Sie war groß, hatte einen aristokratischen Wuchs, als wären ihre Vorfahren Aristokraten gewesen. Ihre großen, braunen Augen faszinierten ihn.
Trotz ihrer 22 Jahre wirkte Irene viel jünger, als hätte sich ihr Körper erst jüngst von ihren zarten Mädchenknospen zur Frau entpuppt. Ihre Gesichtszüge waren ebenmäßig. Eine vornehme Zurückhaltung war Irene in die Wiege gelegt worden. Als er das erste Mal in ihre braunen, unschuldigen Augen sah, stellte er sich vor, ihren wohlgeformten Körper zu streicheln und an den geheimnisvollsten Stellen zu küssen, und ihren Atem und Herzschlag zu spüren.
Sie besaß eine ihr von der Natur gegebene Anmut, eine eiserne Disziplin, sodass ihr die Patienten bald Vertrauen entgegenbrachten, was ihm sehr imponierte. Ihr großes Herz, für ihre Patienten da zu sein, ihr Leid zu mildern, schien für sie das oberste Prinzip zu sein. Er verfolgte sie mit seinen Blicken, wenn sie mit Hingabe geduldig und hilfsbereit ihren Beruf ausübte, für jeden Patienten stets ein freundliches Lächeln hatte. Immer war sie bemüht, den Patienten jeden Wunsch zu erfüllen und dementsprechend beliebt war sie.
Jedes Mal, wenn sie in seiner Nähe war, um ihn zu versorgen, oder was für ihn beschämend war, ihm die Bettpfanne zu bringen, verflog das ständige Hungergefühl, die Schmerzen, die quälende Angst, wieder an die Front gehen zu müssen, wie von selbst.
Sobald ihm seine Schmerzen Freiraum gaben, kreisten seine Gedanken ständig um Irene und er sehnte sich nach ihren Zärtlichkeiten und ihrer Liebe jeden Tag mehr.
Es schien, als wären sie für einander bestimmt. Ihre gegenseitige magische Anziehungskraft führte sie immer wieder zusammen, als hätten sie sich verabredet. Jedes Mal, wenn sie in seiner Nähe war, überkam ihn ein Gefühl, als wäre er an seinem lang ersehnten Ziel angekommen.
Die junge Liebe tat ihm unendlich gut und schien ihn von seinen Sorgen und Ängsten kurzzeitig zu befreien. Jedes Mal, wenn er Irene sah, fühlte er sich wie neugeboren, als würden in ihm neue Kräfte heranwachsen und ihn auf Flügeln ins Paradies tragen. Sein steinharter Panzer in seinem Brustkorb, welcher all seine aufgestaute Wut, Verzweiflung, Resignation eingesperrt hatte und ihn zu ersticken drohte, schien kurzzeitig die auferlegten Ketten zu lockern.
Während ihrer Anwesenheit fühlte er sich in eine andere Welt versetzt. Die Zeit, die er plötzlich für sich selber nutzen konnte, betrachtete er als Geschenk. Er war es nicht mehr gewöhnt, selbständig zu sein und die Zeit für sich zu nützen.
In diesen wohltuenden Pausen verflüchtigte sich zwischenzeitig kurz der Leidensdruck, welcher einer kurzzeitigen Heilung seiner wunden, verletzten Seele gleichkam, und er vergaß für eine Weile seine Albträume und seine ständige Todesangst.
Und trotzdem schreckte er öfters auf, denn wie von verräterischen, listigen Geistern geleitet, als hätten sie ihn der Untreue überführt, trat unvermutet Martha Janisch, seine Braut aus seinem Heimatdorf wie ein platonisches Mahnmal aus einer längst vergangenen Urzeit verschwommen in sein Unterbewusstsein und holte ihn gewaltsam von seiner Glücksleiter herunter.
Bisher hatte er sich immer beim Anblick des zerknitterten Bildes von Martha aus seinem Brotbeutel Trost und den Willen zum Durchhalten und am Leben bleiben zu wollen, geholt und sich nichts sehnlicher als Frieden und Heimkehr zu seiner Martha gewünscht.
Aber jetzt schien das Bild verschwommen zu sein und dieser Trost sich verflüchtigt zu haben. Hatte der Krieg ihre Liebe zerstört?
Ihm wurde im selben Moment bewusst, dass das Bild von Martha in seinem Brotbeutel den Granatsplitter abgelenkt, sein Leben gerettet hatte und er ihr gegenüber zum Dank verpflichtet war. Dadurch war er ins Krankenhaus zu Irene gekommen und Martha hatte ihm platonisch wie ein Wegweiser den Weg zu Irene gezeigt.
Würde sich sein schlechtes Gewissen wegen Martha verflüchtigen und er je wieder ein reines haben?
So lange er sich erinnern konnte, war Martha ihm vermoant (versprochen, vermeint). Marthas und Karls Eltern waren Geidensleute (Gevatter). Der Hausname von Marthas Elternhaus war Weihsteher, da der Geid einige Zeit auf dem Weg arbeitete. Schon als Anna Ertl als Taufpatin das erste Mal ihr Gevatterskind Martha in Händen hielt, welche sie hoffnungsvoll anlächelte, das kräftige Geschrei und die großen Hände sah, wusste Anna Ertl, dieses Kind würde arbeiten und anpacken können. Es hatte sich ein unsichtbares Band zwischen ihnen entwickelt, sodass Anna Ertl heimlich beschloss, dieses Patenkind müsse ihre Schwiegertochter werden.
In Karls Gedanken stand Martha vor ihm als würde sie ihm freundlich zulächeln und ihn bei sich zuhause willkommen heißen. Schon immer war er am liebsten mit ihr zusammen gewesen. Wie oft hatten sie all ihr Freud und Leid und ihre Geheimnisse miteinander geteilt. Sie hatte nur ihm ihren Schatz, versteckt in einem versperrten Kästchen, gezeigt. Schon als Kinder steckten sie immer zusammen, erkletterten die höchsten Bäume, naschten an fremden Obstbäumen, um ihre Welt gemeinsam zu entdecken.
Frühzeitig mussten die Dorfkinder auf den Feldern und Wiesen mitarbeiten, ebenso in den Viehställen. Nachdem die Geidensleute immer schon bei der schweren, händischen Arbeit auf den Feldern, Wiesen und Wäldern, beim Sautanz, Weinlese, Schnapsbrennen, Federnschleißen, Kukuruzhäuten, Schnitt, Heumahd, beim Schlägern von Bauholz, beim Bau einander halfen, waren die Kinder der beiden Familien viel beisammen.
Sie waren unbeschwert und dachten, es würde immer so bleiben. Mit ihrem sonnigen Gemüt, ihrer Gottesfürchtigkeit, Ehrlichkeit und Erdverbundenheit war Martha für ihn ein guter Kamerad und oft wie eine Seelenverwandte. Sie waren mit denselben Ansichten und Zielen aufgewachsen.
Um jeden anderweitigen Verirrungen in der Liebe ihrer halb erwachsenen Kinder vorzubeugen, und ihre Lebensexistenz zu sichern, hatten die Geidensleute die Ehe von Karl und Martha beschlossen.
So wie immer im Dorf wurde von den Müttern in stillschweigender Übereinstimmung mit ihren Ehegatten getrachtet, für ihre Kinder eine gute Partie zu arrangieren, damit ihre Kinder gut versorgt seien. Martha war für Karls Mutter Anna die beste Partie für Karl. Sie war fleißig und sparsam, nicht zimperlich oder verwöhnt. Nachdem sie einen behinderten Bruder namens Adolf hatte, würde sie die Landwirtschaft bekommen und dadurch wäre Karl versorgt. Dabei spielte es keine Rolle, dass Adolf, genauso wie Marthas Eltern, im Haus bleiben, mitversorgt und in gesunden und kranken Tagen gepflegt und bis zum Tod abgewartet werden mussten.
Wenn Anna Ertl abends aus dem Fenster sah und das Gehöft von Martha mit dem großen Misthaufen und der großen Strohtriste vor sich sah, flüsterte sie ihrem Mann stolz zu: „Unser Karl macht eine gute Partie.“ Große Misthaufen und Strohtristen bekundeten, dass viel Grund und Vieh vorhanden waren.
Die Familie Ertl kannte den Besitz der Geidensleute genauso wie umgekehrt die Familie Janisch das Anwesen von Ertl genau kannte.
Die gegenseitige Zuneigung von Karl und Martha entwickelte sich langsam, beständig, bis sie zur Liebe gereift war.
Martha war das schönste und begehrteste Mädchen im Dorf, bodenständig, ehrlich und offenherzig. Später, als sie sich vom Kindsein verabschiedete und zur Frau reifte, hatte sie viel Anwert (Chancen) bei den Burschen. Aber gegen ihre anderen Verehrer hatte Karl leichtes Spiel. Er liebte ihre pausbäckigen, roten Wangen, ihre dicken Zöpfe, ihre Grübchen, wenn sie lachte, und ihre großen braunen Augen, die ihn immer abwartend ansahen, sodass jede Initiative, ihr Zärtlichkeiten oder ein Busserl abzuringen, immer von ihm aus ging. Sie war scheu und zurückhaltend, trotzdem sie ihn liebte. Nie wäre sie aufdringlich gewesen oder hätte sich ihm an den Hals geworfen, denn durch ihre Gottesfürchtigkeit und die Einschüchterungen des Herrn Pfarrers, dass Gott jede Unkeuschheit und körperliche Hingabe vor der Ehe mit dem Fegefeuer bestrafen würde, sah Martha jede körperliche Berührung als unkeusch und als Sünde an. Und so musste Karl entgegen dem Ansinnen ihrer beiden Eltern lange um Martha werben, bis er sein erstes, schüchternes Busserl bekam.
Ihre Frohnatur war ansteckend und wirkte auf ihn immer schon anziehend, sodass er immer gerne in ihrer Gesellschaft war. Nie war sie zwider (grantig). In ihrem Gesicht las er immer Anbetung für sich. Er fühlte, wie glücklich sie in seiner Anwesenheit war.
Als wäre es gestern gewesen, sah er sie jetzt mit roten Wangen, ein bisschen untersetzt (stärker) vor sich. Sie hatte ein schönes Gesicht, makellose weiße Zähne und ihre Augen strahlten, wenn sie lachte. Wie sie wohl jetzt aussah?
Im Geiste sah er Marthas verweintes Gesicht, als ob sie geahnt hätte, dass der Krieg ihr den Liebsten nehmen würde, als er Abschied von ihr genommen und in den Krieg gezogen war. Allerdings hatte sie befürchtet, er würde nicht mehr heimkommen. Dass er sich von ihr trennen würde und sie ihn an eine andere Frau verlieren könnte, war für sie damals undenkbar gewesen.
Von diesem Gefühlschaos überwältigt, warf er sich stöhnend hin und her und das Bild Marthas verblasste und verschwand. Im nächsten Moment griff er in seinem Schwebezustand zwischen Himmel und Erde wie ein Ertrinkender nach einem Rettungsanker und ergriff platonisch Irene. Und der Himmel erstrahlte, als er Irene auf einem Marmorpodest sitzen sah. Irene war wie ein Wunder in sein Leben getreten.
Bei jedem ihrer schüchternen, sehnsuchtsvollen Blicke, den sein nach Liebe sehnender Körper wahrnahm, wurde er sicherer, dass auch Irene ihn heimlich begehrte. Bald verzehrte er sich nach ihrer Liebe und bebte vor Verlangen.
In seiner Sehnsucht malte er sich aus, der Krieg wäre zu Ende, er würde mit ihr gesättigt in einem warmen Bett liegen, sie küssen und sie auch an den verbotenen Stellen streicheln, ihren Atem und Herzschlag fühlen und eins mit ihr werden. Würde dieses Wunder für ihn Wahrheit werden oder war alles nur ein flüchtiger Traum, ein Strohfeuer? Und wie würde er Martha eines Tages gegenübertreten?
Am nächsten Tag, als Irene ihm etwas zum Trinken reichte, berührte er wie zufällig ihre Hand, was einen wohltuenden Glücksstrom in ihrem Körper auslöste. Gleichzeitig löste diese Berührung Unsicherheit und Herzklopfen aus, als wäre es eine unstatthafte Liebkosung. Er sah die aufsteigende Röte in ihrem Gesicht und empfing die verhaltenen Signale des Wohlgefallens ihrerseits wie einen Sonnenstrahl aus dem Paradies.
Irene wandte sich beschämt und erschrocken kurz ab. Hatte er sie tatsächlich berührt und war der Bann gebrochen? Sich nach seiner Liebe verzehrend, war ihr Karls Unaufdringlichkeit und Zurückhaltung unendlich lang vorgekommen. Sie wünschte, er könnte ausdrücken, was sie in seinen Augen zu lesen schien. Ihre bisherigen Verehrer hatte Irene höflich, aber bestimmt abgewiesen, was ihr den Ruf einer „eisernen Jungfrau“ eingebracht hatte. Aber als sie Karl Ertl sah, wusste sie, dass es richtig war, sich für ihn aufzuheben.
Sobald Karl einigermaßen gehfähig war, wartete er auf ihr Dienstende und fragte sie: „Fräulein, darf ich Sie nach Hause begleiten.“ Der fremdländische Dialekt vermittelte ihr das Gefühl von erdiger Heimatverbundenheit. In diesem Moment sangen tausend zustimmende Engelsstimmen unter Schalmeienklängen im Chor für sie Jubellieder.
Am liebsten hätte sie laut geschrien: „Ja.“ Sie unterdrückte einen Freudenschrei und verbarg ihre Freude. Kurz antwortete sie mit belegter Stimme „Ja“.
Als Karl und Irene nachts durch die Stadt schlenderten, nahm er ihre Hand und drückte seinen Körper an sie. Sie wich ihm nicht aus, sondern sie genoss seine Gesellschaft und jede Berührung, auf die sie so lange gewartet hatte. Bei dem Gedanken, dass er mit diesen zärtlichen Händen vor kurzem noch am Drücker der MP unschuldige Menschen getötet hatte, zuckte sie kurz zusammen und bemühte sich sogleich diese Gedanken zu verscheuchen.
Bald begann er sie an der Innenfläche der Hand zu streicheln, drehte sich zu ihr und küsste sie ohne Worte. Ihr Herz hämmerte wie verrückt in der Hoffnung, er würde ihre Nervosität nicht merken. Ihre Verwirrung wollte sie vor ihm verbergen. Er sollte nicht sehen, wie verrückt sie nach ihm war, denn es könnte der Eindruck entstehen, dass sie ein Flittchen und leicht zu haben wäre.
Eine Weile schwieg er. Sie sah seinen warmen Atem in der kalten Nacht aufsteigen und wünschte er würde ihr sagen, was sie sich so lange ersehnte und auf ihrer Haut brannte, nämlich dass er sie liebe. Aber seine Gefühle in Worte zu fassen, schien ihm schwer zu fallen. Irgendwie schien er bedrückt und verlegen zu sein. Und im nächsten Moment fragte er unsicher: „Haben Sie schon einen Bräutigam.“ Sie verneinte, während sie ihn ungläubig ansah. „Wenn ich einen Bräutigam hätte, würde ich nicht mit ihnen hier gehen“, erwiderte sie energisch, fast gekränkt. Das Wort Bräutigam war ihr nicht geläufig. Sie bemerkte sein Aufatmen. Im gleichen Atemzug drückte er sie, als wolle er sich für diese Antwort und ihren Glauben an die Treue bedanken, an sich. Sie spürte seinen Herzschlag und wünschte, sein Herz würde in Zukunft nur für sie schlagen.
Klammheimlich hatte sie schon länger der Gedanke gequält, ob seine Zurückhaltung darin begründet war, dass er etwa verheiratet wäre, und so nahm sie ihren Mut zusammen und fragte ihn: „Sind sie verheiratet?“ Er verneinte schnell, als wäre dieses Thema unangenehm für ihn und begann, bemüht um Gleichgültigkeit, vom kalten Wetter zu sprechen.
Vor ihrem Haustor waren sie stehen geblieben. Er hatte sie fragend angeschaut und gewartet, ob sie ihn hereinbitten würde. Verlegen hatte er sie berührt und sie umarmt. Diese Liebkosung ließ sein Blut in Wallung geraten. Seine Umarmung erwärmte sie wie ein warmer Frühlingsstrahl.
Diese erste warme, liebevolle Umarmung nach so langen Entbehrungen, Schrecken und Kämpfen an der Front tat Karl unsagbar gut. Es war wie Balsam auf seiner Seele. Die bösen Geister und das Grauen des Krieges verschwanden in diesem Glücksmoment wie von selbst. Er bekam weiche Knie und war unendlich glücklich. Alles hätte er dafür getan, um diesen wohltuenden Zustand ewig andauern zu lassen.
Verlegen fragte er sie, ob er sich kurz in ihrer Wohnung ausruhen dürfe, seine Schmerzen im Bein hätten sich zurückgemeldet.
In seinen Augen spürte sie seine Unsicherheit und Befangenheit. Sie nahm ihn an der Hand und zog ihn stumm mit sich. Ihre Eltern waren nicht zuhause. In der Wohnung angekommen, bat sie ihn sich zu setzen.
Irene und ihre Eltern waren noch nicht lange in dieser Wohnung. Nachdem der Vorbesitzer der Wohnung, ein Jude, den zunehmenden wirtschaftlichen Boykott, Entrechtung und Repressalien wie Dienstenthebung aller jüdischen Beamten, Schächtverbot, Verordnung über die Anmeldung des Vermögens von Juden über 5000 RM, Nichtariern der Besuch von Behörden untersagt wurde, Praxisverbot für jüdische Ärzte und Rechtsanwälte, die Reichskristallnacht, wo die Schaufensterscheiben von jüdischen Geschäften von SA-Trupps eingeschlagen, die Geschäfte geplündert, Juden geschlagen und verhaftet, die Aktionen von Hetzreden im Radio begleitet wurden, Juden weder Waffen besitzen noch führen durften, das Schulverbot für jüdische Kinder, Auflösung aller jüdischen Betriebe hinnehmen musste, verstärkte sich bei ihm und allen Juden die Angst, als ihnen am 6. 9. 1941 befohlen wurde, in der Öffentlichkeit einen gelben Stern zu tragen, welcher groß und deutlich auf den Mänteln und Jacken angebracht und ersichtlich gemacht werden musste, und bei Nichtbefolgung die sofortige Verhaftung zur Folge hatte. Wie oft hatte er sich überlegt unterzutauchen, aber wovon sollte er leben? Nachdem es ihn offiziell nicht gab, hätte er keine Lebensmittelkarten bekommen. Oder sollte er sich für Geld einen falschen Pass und Fluchthelfer besorgen und flüchten?
Er wurde wie viele andere Juden, Roma und Sinti, Zeugen Jehovas, Körperbehinderte, Priester, Bibelforscher, Asoziale, Homosexuelle, mehrfach Vorbestrafte, Regimegegner, Kommunisten, Widerstandskämpfer u.a. verhaftet und deportiert. Durch die Vertreibung der Juden wurden viele Wohnungen frei, was auch Irenes Eltern zugutekam. Am 25. November 1941 erging die 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz, wonach alle deutschen Juden, welche emigrierten oder deportiert wurden, ihre deutsche Staatsangehörigkeit und ihr gesamtes Vermögen an das Deutsche Reich verloren. Der förmliche Beschluss zur systematischen Vernichtung der Juden (Endlösung) wurde wahrscheinlich auf der Wannsee-Konferenz vom 20. 1. 1942 getroffen.
Karl sah, wie die Fenster der Wohnung zum Schutz vor feindlichen Bombern und zwecks erschwertem Auffinden der Ziele bei Nacht mit einer Verdunkelungsrolle vorsorglich verdunkelt waren, um dem Luftschutzerlass vom 23. 5. 1939 und 22. 10. 40 Folge zu leisten und nicht Gefahr zu laufen, angezeigt und von der Gestapo als Volksschädling verhaftet zu werden. Ebenso galt die Verordnung für Kraftfahrzeug- und Fahrradscheinwerfer. Auch sah er einen Wassereimer, Sandeimer, Handfeuerspritze, Schaufel und Spaten sowie den Koffer voller Dokumente, wenige Habseligkeiten, Stahlhelm, Gasmaske und nasse Tücher zum Schutz vor beißendem Rauch, ständig griffbereit zur Flucht, um sofort bei jedem Sirenengeheul in den Luftschutzkeller – Juden war der Zutritt verboten – zu flüchten, wo der Luftschutzwart für Ordnung sorgte und eine Respektperson war. Vom Reichsluftschutzbund und der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt war Irene die Volksgasmaske ausgehändigt und in ihrer Handhabung unterrichtet worden.
Während in anderen Wohnungen, wo die Wasserleitungen noch intakt waren, ständig in Eimern gesammeltes Wasser stand, gab es in ihrer Wohnung weder Wasser, Strom noch Gas, denn die Leitungen waren durch Bomben zerstört. Irene heizte den kleinen Herd ein, legte ein paar Scheiter Holz hinein und stellte das mitgebrachte Teewasser auf. Neben dem Herd lag ein Kochbuch mit sparsamen, „falschen“ Gerichten.
Bald breitete sich wohlige Wärme aus. Die knisternden Holzscheite im Herd gaben eine behagliche, wohlige Wärme, während draußen die frierende Natur mit einem weißen Mantel von dicken Schneeflocken versehen sanft ruhend in den Winterschlaf eintauchte, um sich vor dem Erwachen des Frühjahrs auszuruhen und im Schoße der Mutter Erde neue Ernten zu gebären.
Als Karl den Volksempfänger in Irenes Wohnung betrachtete, erinnerte er sich daran, dass Martha denselben zuhause hatte, welchen ihr Vater für 100 kg Weizen eingetauscht hatte. Insgeheim musste er lächeln. Als Martha ihren ersten Volksempfänger bekam, war sie so stolz und drehte ihn so laut auf, dass alle im Dorf hören sollten, dass sie einen Volksempfänger hatten.
Wie oft, wenn Karl vom Volksempfänger die beängstigenden Nachrichten ob dem Näherkommen des Feindes in seine Heimat – sein Dorf lag in der Grenzregion zu Ungarn – hörte, fragte er sich, wie lange der Feind in Ungarn noch aufgehalten werden könne. Er hätte Lust gehabt Radio London zu hören, fürchtete aber, dass die Gestapo mit Sendepeilgeräten durch die Gassen fuhr.
Als hätte der Volksempfänger eine unsichtbare Symbiose zwischen ihm und seiner Heimat hergestellt, spürte er instinktiv ein heimliches Verlangen, seine Lieben in der Heimat vor dem Feind zu beschützen.
Der Duft von Kamillentee stieg in seine Nase. Während Irene in der Küche hantierte, trugen ihn seine Gedanken aus seinem Unterbewusstsein, wie eine Mahnwache, in seine Heimat. Wie oft hatte er mit Martha im Wald Kamille, Kräuter, Beeren, Eibisch, Pilze gesucht und wie oft hatten sie zusammen in ihrer Küche Tee getrunken. Seine plötzlich einsetzenden Kindheitserinnerungen führten ihn in seine Heimat und Heimweh überkam ihn. Er sehnte sich nach der Ruhe und Geborgenheit vor dem Krieg und dem Leben in der Idylle seiner Heimat.
Im Geiste sah er Martha am Herd stehend und der vertraute Geruch von frisch gekochtem Essen trat wie von selbst gesteuert in sein Bewusstsein. Wie alle Frauen im Dorf stand Martha morgens um fünf Uhr auf, kleidete sich mit ihrem bunt bedruckten Leinwand- oder Baumwollkittel, band ein tischeltes (kariertes) Kopftuch hinten zusammen, zog ihre Schürze und Schnürschuhe an und heizte zuerst den Kachelherd mit dem Holz vom eigenen Wald ein. Oberhalb des Kachelofens, wo sich das Backrohr befand, war am Dachboden die Selch, sodass mit demselben Rauchfang, durch einen Schuber geregelt, das Fleisch geselcht wurde. Anschließend musste sie das Vieh füttern, den Stall ausmisten und die Kühe melken. Nach jedem arbeitsreichen Tag kam sie erst spätabends müde zu Bett. Genauso wie ihre Vorfahren die Weingärten, Felder, Wiesen und Wälder, die Viehwirtschaft mit viel händischer, schwerer Arbeit betrieben hatten, sollte auch ihr Leben in den vorgefertigten Bahnen verlaufen.
Die Frauen heizten ihre Herde mit dem Kia (Kienspan) und Spandln (kleinem Holz) ein, kochten die von ihren Müttern und Großmüttern erlernten, altbewährten Speisen wie gelindeten, (Mehl erhitzt) geschmalzenen Sterz, Knödel, Oamali (gebackener Palatschinkenteig), krankerlten (knusprigen) Krumperntinl, Krumperngalatschen (Erdäpfelgericht), Ritschert (Rollgerste), Sulz (gegossene Presswurst) mit Essig, Kernöl und Zwiebel, Krumpernsterz, warmen Krautsalat, obrennten Salat (warmer, grüner Salat) mit warmem Speck und Grammeln, Fosn, Aufgeherts (Germstrudel, Germbäckereien), Hobelscharten, derbige (gezogene) Strudeln mit allerlei Füllen und Ziweben (Rosinen), Malinsen (Strudelteig, der im Rohr gebacken, zerkleinert, in Salzwasser gekocht, abgeseiht, geschmalzen und mit Knoblauch verfeinert wird), Mülifoarfal und selbst gemachte Nudel-, Kartoffel- und Bohnengerichte mit den selbst erzeugten Lebensmitteln nach dem Motto: „Was der Bauer nicht kennt, isst er nicht.“
Wie oft wurde Karl in Marthas Elternhaus wie selbstverständlich von den Geidensleuten gebeten, als baldiges Familienmitglied mitzuessen und ein Glas Uhudler mitzutrinken. Was für eine große Rein voller Sterz Martha auf den Tisch stellte, sofort das Kreuzzeichen machte und zu beten anfing vor dem Essen. Jeder aß mit dem Löffel aus dieser Rein. Am besten schmeckte Karl das Fleisch, welches beim Sautanz fertig gebraten in Gläser gelegt, mit dem Bratenfett bis oben zugedeckt und mit Pergamentpapier verschlossen und zugebunden wurde. Vor seinen geistigen Augen sah er Martha, wie sie das Fleisch konservierte. Das Wasser lief ihm im Mund zusammen, wenn er an diesen köstlichen Schweinsbraten dachte.
Wie Martha heute wohl aussehen würde, und ob sie ihn noch lieben würde, wenn er ihr von Irene erzählen würde, fragte er sich. Und im selben unbeobachteten Moment nahm er wieder einmal reuig ihr abgegriffenes, zerknittertes Bild aus seinem Brotbeutel, um sich Martha auch stellvertretend als Botschafterin für seine Heimat in Erinnerung zu rufen. Jetzt erinnerte er sich, dass er ihr schon längere Zeit nicht mehr geschrieben und ihren letzten Brief nicht beantwortet hatte.
In diesem Moment fühlte er ihre Augen anklagend auf ihn gerichtet. Als Irene rief, wie viel Zucker sie in seinen Tee geben sollte, fuhr er auf.
Verlegen, als würde er, wie ein kleiner pubertierender Junge, bei einer Sünde ertappt, blutrot vor Scham, ließ er das Bild schnell wieder verschwinden, während seine Blicke Irene suchten, um festzustellen, ob sie ihn etwa beobachtet und seine Verlegenheit bemerkt hatte. Sogleich stellte er fest, dass er diese große Liebe nie erfahren hätte, wenn er zuhause bei Martha geblieben wäre.
Karl und Irene trafen einander so oft es ging. Bisher war ihr Leben in völlig verschiedenen Bahnen gelaufen und nun hatte sich ihr Weg schicksalhaft gekreuzt. Er hatte ihr erzählt, dass er aus dem Gau Steiermark, dem ehemaligen Südburgenland komme, wo seine Familie seit Generationen eine kleine Landwirtschaft mit Feldern, Wiesen, Wäldern und Weingärten und mit Kühen, Schweinen, Gänsen und Hühnern betreibe. Staunend hatte sie ihm zugehört.
Trotz der widrigen Umstände, dem Tod und Verderben um sie herum, waren sie unsagbar glücklich miteinander, obwohl ihn die ständige Angst, nach seiner Genesung wieder an die Front gehen zu müssen, wie ein dunkler Schatten verfolgte.
Das junge Liebespaar strahlte vor Glück und ihr Strahlen verbreitete sich auf ihre Mitmenschen wie ein warmer Sonnenschein. Jedermann konnte erkennen, wie Irene durch die Liebe erblühte und hübscher geworden war.
Trotz der mahnenden Worte ihrer Mutter hatte Irene in ihrem Entschluss keine Sekunde gezögert. Lange hatte sie sich Karl gegenüber verweigert, um ihn näher kennenzulernen und hatte ihm nur Liebkosungen gewährt. Ihre Liebe sollte Zeit haben, um sich zu entwickeln und zu reifen, bis sie ihn gut genug kannte und ihre Liebe auf solider Basis stehen würde, obwohl die ungestillte Sehnsucht und das Verlangen brannten. Ihr Verlangen wurde zunehmend stärker und gewann die Oberherrschaft über ihre edlen Ansichten, bis sie ihre bisher festgefahrene Gesinnung, sich keinem Mann vor der Ehe hinzugeben, verwarf und das höchste Liebesglück erfuhr.
Reglos lagen sie nach ihrem ersten Liebesspiel mit rasenden Herzen aneinandergeschmiegt, bis sie sich langsam beruhigten. In seltsamer Stille lag sie in seinen Armen und ihr langes, seidiges Haar umschmeichelte seinen Körper. Er streichelte ihr Gesicht und küsste sie sanft. Die Welle, die über Irene hinwegfloss, die all ihr Denken mit sich riss, und nichts als Wollust hinterließ war stärker und mächtiger, als sie es sich erträumen hatte lassen. Sie genoss sein unstillbares Verlangen, die Zärtlichkeiten und seine Erfahrenheit in der Liebe, obwohl sie sich insgeheim fragte, wo er diese Erfahrung gesammelt hatte.
Aber sie wollte ihr Glück nicht trüben und ihn danach fragen und kein Misstrauen oder Eifersucht aufkommen lassen. Jedwede Störenfriede ihrer Liebe wollte sie im Keim ersticken.
Er stöhnte und sie schluchzte. Ihre Herzen pochten in ihrer Glückseligkeit, bis sich ihr Pulsschlug beruhigte und sie wieder in die Realität zurückkehrten.
Nie zuvor hatte Karl eine solche Erfüllung seiner innersten, verborgenen Träume erfahren. Bisher hatte er gedacht, eine solche große Liebe gäbe es nur in den Romanen.
Sooft es ging, liebten sie sich, als wäre diese Liebe für sie beide zum Rettungsanker bestimmt. Wie gerne vergaß Karl in ihren Armen den Kanonendonner, Tod und Verzweiflung für kurze Zeit, was wie eine Befreiung und Erlösung war.
Aber immer dann, wenn Karl Ertl sich im höchsten Glückstaumel befand, meldeten sich sofort danach wie ein Blitzstrahl aus heiterem Himmel sein schlechtes Gewissen und seine Schuldgefühle ob seiner Untreue gegenüber seiner dörflichen Braut Martha zurück, genauso, als ob böse Geister ihm sein junges Glück missgönnen und sein Vergehen rächen wollten.
Wie oft war Martha in seinen Todesängsten sein Trost und seine Zufluchtsstätte gewesen und jetzt hatte er sie verraten und abgelegt. Wie bei einem Himmelfahrtskommando wurde er sich seiner falschen hinterlistigen Art bewusst.
In solchen Momenten der Offenbarung verachtete sich Karl Ertl ob seiner Falschheit und seiner Heuchelei. Insgeheim machte er sich Vorwürfe, denn er hatte Martha Hoffnungen und ewige Treue und Liebe geschworen und das Versprechen auf eine gemeinsame Zukunft gemacht, das für Martha bindend war. Er hatte es gebrochen und vielleicht würde er es nicht erfüllen können. Er betrachtete schuldbewusst ihr Bild, wobei er sie am liebsten platonisch um Verzeihung gebeten hätte.
Intuitiv spürte Irene öfters, wie sein Blick starr wurde und seine Gedanken in die Ferne schweiften, er oft bedrückt, traurig und schweigsam war, als würde Karl innerlich mit sich selber einen Kampf austragen.
Worüber er grübelte, konnte sie nicht ahnen, wenn sie ihn darauf ansprach, wich er aus, sodass sie allmählich befürchtete, er würde darüber grübeln, sie zu verlassen.
Wie oft nahm ihn Irene zärtlich in die Arme, küsste und fragte ihn, worüber er grüble und was ihm Kummer bereite, während sie ihm versicherte, dass sie ihm gerne helfen würde, seine Sorgen zu teilen. Lange verweigerte er die Antwort, die lange in ihm gärte und ihn quälte. Bis Irene eines Nachts nicht locker ließ und es ihm stockend, wie zäher Schleim von den Lippen kam. Er erklärte mit unterdrückter Stimme, er wisse nicht, ob sein älterer Bruder Toni oder sein Vater zuhause wären, da er schon so lange nichts mehr von zuhause gehört hatte und er deshalb zur Anbauzeit im Frühjahr unbedingt zu Hause sein wolle. Und so hatte er, wie viele andere Männer mangels Arbeitskräfte in der Heimat, um Urlaub für das lebensnotwendige Anbauen der Felder angesucht und bewilligt bekommen.
Er war sich bewusst, dass er wegen seiner Verletzung keine schweren Arbeiten verrichten konnte, aber wenigstens das Pferdegespann anschirren, bespannen und die Zügel in der Hand halten und loaten (lenken) würde er bewerkstelligen können.
Mit seinen Händen, um Worte ringend, unterstrich er gestikreich sein Ansinnen und sie spürte seine angeborene Erdverbundenheit und seine tiefe Verwurzelung mit seiner Heimat, sodass ihr Urvertrauen zu ihm Bodenhaftung bekam.
Wohlweislich verschwieg er, dass ihm sein Aufenthalt in der Heimat auch Luft verschaffen sollte für eine Entscheidung, die er jetzt nicht imstande war zu treffen, um Irene zu schonen und sie nicht zu kränken. Er musste versuchen, seine persönlichen Probleme zu regeln und sich Klarheit mit Martha verschaffen. Sein rücksichtsloses Verhalten belastete ihn. „Wenn man zwischen zwei Stühlen sitzt, fällt man durch“, hieß es zuhause im Volksmund.
Ebenso verschwieg er, dass er zuerst überlegt hatte, einen Brief nach Hause zu schicken, um seinen Eltern von Irene als seiner Braut zu berichten. Oder sollte er sie gleich mitbringen? In seinen kühnsten Träumen hatte er sich auch öfters ausgemalt, Irene zu heiraten und als seine Frau heimzubringen. Aber schnell verwarf er diese Gedanken wieder. Er befürchtete, seine Mutter würde Irene in ihrem Jähzorn und mit ihrem losen Mundwerk verjauken (verjagen). Wenn er Irene ehelichte, wollte er doch so gerne den Segen seiner Familie zu seiner Verbindung, um einen glücklichen Neuanfang zu machen, ohne elterlichen Segen würde seine Verbindung kein Glück bringen. Er konnte Irene hier nicht heiraten, das wäre feig und hinterlistig. An den Verrat an Martha, ihren Eltern und seiner Familie mochte er nicht denken.
Und so war Karl zur Überzeugung gekommen, dass es das Beste war, allein nach Hause zu fahren, um seine Eltern behutsam auf Irene vorzubereiten, denn er befürchtete den strikten Widerstand seiner Eltern und wusste, dass ihm dadurch viel Ungemach bevorstand. Von der Hoffnung genährt, seine Eltern würden in ihrer großen Freude, ihn wieder lebend und gesund zuhause zu haben, geläutert und gnädiger sein und ihm seine Entscheidung, mit Irene künftig leben zu wollen, nicht in Frage stellen, hatte er diesen Entschluss gefasst.
Nach einer kurzen Pause versicherte er Irene, dass er sie am liebsten mitgenommen hätte und es ihm das Herz zerreißen würde, sie hier zurücklassen zu müssen. Aber er könne sich eine gemeinsame Zukunft mit ihr nur in seiner Heimat vorstellen. Aus diesem Grunde müsse er dafür sorgen, dass die Felder bebaut werden, um mit der Ernte für eine gemeinsame Lebensexistenz zu sorgen, damit er eine Familie gründen und ernähren könne. Er wolle Vorkehrungen treffen, ein Nest bauen für ein gemeinsames Leben mit ihr. So wie seine Familie seit Generationen durch harte Arbeit auf den Feldern ihren Lebensunterhalt verdiente, wollte auch er durch der Hände Arbeit unabhängig und wie seit eh und je stolzer Selbstversorger sein, sein eigener Herr und niemanden untertänig sein müssen mit Gottes Segen und im Einklang mit der Natur. Der Krieg würde bald aus sein und dann könnten sie mit einer guten Ernte ihr Leben genießen. Er könne sie unmöglich holen, wenn die Felder nicht bebaut wären, denn wovon sollten sie dann leben.
„Glaube mir, ich werde diese Entscheidung nicht alleine treffen, ich gehe nur, wenn du es auch willst. Es handelt sich nur um eine kurze Zeit, danach, wenn zuhause alle Felder angebaut sind, komme ich wieder. Auch mir fällt es schwer, von dir zu gehen“, erklärte er flehentlich, während er sie am liebsten jetzt geliebt und den Urlaub, den Krieg und alles Ungemach vergessen hätte.
Weiters erklärte er, dass er keinen Beruf gelernt, er kenne nur die Arbeiten in der Landwirtschaft. Das Stadtleben mochte Karl sowieso nicht und das Heimweh und die Sehnsucht nach der vertrauten Umgebung und seiner Heimat begleiteten ihn ständig. Er konnte es sich nicht vorstellen, auf den Trümmern dieser Stadt sich ein gemeinsames Leben mit Irene aufzubauen und eine Familie zu gründen. Wie sollte er sich hier eine gemeinsame Zukunft aufbauen?
Seit Kindesbeinen an wurde er dazu erzogen selbständig zu sein und eine Landwirtschaft zu führen.
Das Landleben, still und abgeschieden, ohne den Lärm und die Hektik einer Großstadt, die Freiheit seiner Entscheidungen, vom Fleiß seiner Hände den Erfolg vor Augen und als selbständiger Selbstversorger zu fungieren, war sein oberstes Ziel. In seiner Heimat lebte man von der Substanz, von der Hände Arbeit, achtete, hütete und jätete jedes Pflänzlein, damit es sich entfalten konnte. Sobald die Zizibe (Kohlmeise) und die Fastenblümerl (Primel) das Frühjahr ankündigten, fing die Arbeit auf den Feldern an.
Mit gewissem Stolz dachte er daran, wie unabhängig und erdverbunden die Bauern in seiner Heimat waren und mit ihren fleißigen Händen selbst ihren Lebensunterhalt verdienten, während die Händler, Hausierer und Viehhändler bei den Bauern als arbeitsscheue Leutanschmierer (Betrüger) verschrien waren.
In seinem Heimatdorf lebte man abgeschieden. Die Bauern waren es gewöhnt, den Grund biologisch und schonend zu bearbeiten, ohne den Einsatz von Chemikalien, und Selbstversorger zu sein. Untereinander sich zu helfen, war oberstes Gebot. Man half sich gegenseitig unentgeltlich aus Solidarität bei einem erlittenen Unglück, beim Bau eines Hauses oder eines Wirtschaftsgebäudes, im Schnitt oder bei Waldschlägerungen oder sonstigen schweren Arbeiten aus, aber auch mit Werkzeugen, Geschirr und sogar Geld.
Alle Heimsuchungen, Naturkatastrophen, Seuchen, Plagen, Krankheiten bei Mensch und Vieh galt es möglichst schonend zu überstehen und das Dorfleben förderte zwangsläufig den Zusammenhalt, da man beim Nächsten Hilfe suchte.
Jede Ernte wurde, auch wenn sie gut zahlte (reichlich ausfiel), sparsam verwendet, damit alles gfuag (genug) ist. Urassn (Verschwendung) war Sünde. Man konnte nie wissen, ob es im folgenden Jahr eine Missernte, oder Hagelschläge geben würde und Not eintrat.
Zuhause litten sie keinen Hunger und niemand musste sich vor den Lebensmittelgeschäften anstellen. Das hatte ihm Martha geschrieben. Die Dorfbewohner konnten sich neben ihren selbst erzeugten Produkten der Landwirtschaft und neben der Abgabepflicht im Sommer von Pilzen und Beeren, Obst, von der Tauben- und Hasenzucht, welche es in jedem Haus gab, vom Tausch und Hamstern, notfalls auch vom Wildern und Fischen gut ernähren.
Karl erklärte, dass er es niemals ertragen könnte, wenn sie hier in Armut, Kälte und Hunger leben müssten, sie sich zusammen mit den anderen hungrigen, abgemagerten Menschen und quengelnden Kindern mit ihren Lebensmittelkarten vor den Lebensmittelgeschäften anstellen müssten, während er zuhause in der Landwirtschaft sein eigener Herr wäre und seine Familie selbständig ernähren könne. Dort könnte er mit Irene eine gemeinsame Zukunft aufbauen, damit sie nicht betteln müssten, denn genau dieses Schicksal wollte er sich und seiner Familie ersparen. Er bekräftigte nochmals, dass er sofort nach dem Anbauen der Felder wiederkommen und sie holen würde.
Uneigennützig verschwieg Irene ihm ihre Träume von ewiger Liebe und einem gemeinsamen Leben bis dass der Tod sie scheiden würde, um ihn nicht in seiner Entscheidung zu beeinflussen. Sie wollte ihn weder ängstigen noch bedrängen oder behindern.
Irene nickte stumm, unfähig etwas zu entgegnen, obwohl ihr das Herz schwer wurde, was bei ihm als Zustimmung ankam. Ihr Verstand begrüßte einerseits seine Entscheidung. Dass er Vorkehrungen für ein gemeinsames Leben machen musste, wertete sie als Versprechen für eine gemeinsame Zukunft, aber ihr Herz wehrte sich trotzdem. Und sie war irgendwie erleichtert zu wissen, was ihn heimlich beschäftigte, denn Irene hatte befürchtet, dass Karl entweder wieder an die Front müsse oder sie verlassen würde. Und dennoch schmerzte sie sein Entschluss, obwohl es das geringere Übel war. Besser er ging nach Hause als an die Front. Dass zuhause auch ihr platonischer Feind in Form von Martha sitzen könnte, ahnte sie nicht.
Trotzdem lief durch ihren Körper ein kalter Schauer der Enttäuschung, als würde sie zusammenbrechen. In ihrer Brust kämpften zwei Seelen. Die eine Hälfte wollte ihn mit aller Kraft halten, während die andere Hälfte ihr riet, ihn gehen zu lassen, sie hätte nicht das Recht, ihn aufzuhalten. Wie gerne hätte sie ihn aufgehalten. Sie wollte ihn keine Sekunde mehr vermissen, er war ihr Lebenselixier, ihr Trost und Rettungsanker geworden, nicht nur in schwierigen Stunden. Sie konnte sich ein Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen.
Wie sollte sie ohne die Gewissheit, dass sie ihn abends wieder sehen würde, um in seinen Armen das Leid und das Elend rund um sie für eine kurze Zeit zu vergessen und Kraft tanken für ihren schwierigen Arbeitstag, leben? Wie sollte sie ihr Leben meistern ohne ihn? Musste sie mit seinem Weggehen auch die Hoffnung auf eine gemeinsame glückliche Zukunft aufgeben? Dass sie insgeheim darüber grübelte, ob ihre junge Liebe die Trennung aushalten oder ob er sein Vorhaben positiv ausführen würde können und ob er zu ihr zurückkommen würde, verschwieg sie wohlweislich.
Irene sah in sein verzweifeltes Gesicht und auf seine Hände, die sich bewegten, als wollten sie eine entschuldigende Erklärung abgeben, es aber nicht vermochten, und kraftlos in sich zusammensanken. Er hatte doch tatsächlich gesagt, er wolle nach Hause und sie hier allein zurücklassen. Dieser Gedanke ließ sie momentan erstarren.
Mit dem Versprechen, so schnell wie möglich zu Irene zurückzukehren und sie anschließend in seine Heimat zu holen, gingen sie gemeinsam kurze Zeit später zum Bahnhof. Beim Abschied auf dem Bahnhof überreichte sie ihm ihr Bild, welches er in seinen Brotbeutel neben das Bild Marthas legte.
Wenn Karl in das traurige, schmerzerfüllte Gesicht von Irene sah, bohrten sich Stiche in sein Herz. Er wollte seiner großen Liebe keinen Kummer bereiten. Es tat ihm in der Seele weh, sie so leiden zu sehen, während er seine Tränen tapfer unterdrückte.
Als er beim Abschied ihre zarten, kleinen Hände in seinen Händen hielt, überkamen ihm Zweifel. Ihm wurde mit einem Schlag bewusst, dass ihre zarten Hände zwar seinem Körper das höchste Wonnegefühl bereiteten, aber, im Gegensatz zu Martha, nie in Erde gewühlt, nie gepflügt, geeggt und gesät hatten, nie ein Huhn zum Essen geschlachtet, keine Kühe gemolken oder den Stall ausgemistet hatten. Sie hatte bisher mit Tieren, Wachstum und Gedeihen einer Saat in der Natur nichts zu tun gehabt.
Irene hatte nie einen dreckigen, stinkenden Stall von innen gesehen, nie von früh bis spät bei jedem Wind und Wetter, egal ob die Schmerzen glousten (klopften), im Freien gearbeitet. Wie oft rieben sich die Bauern abends ihre schmerzenden Stellen mit Vorlauf ein, während die offenen Wunden mit Jod oder Schnaps ausgebrannt (desinfiziert) wurden.
Würde sie dieses harte, arbeitsreiche Leben überhaupt aushalten? Würden diese zarten Hände jemals hart arbeiten und zupacken können, so wie es Marthas Hände konnten, und dem harten Alltagsleben am Land, unter den kritischen Augen seiner Mutter und der Dorfbewohner gewachsen sein? Oder würde sie bald ausgelacht und verspottet werden und aufgeben. In Gedanken verglich er ihre Hände mit Marthas Hände. Wenn er an die abgearbeiteten vom Wind und Wetter rauen, von Schwielen übersäten Hände von Martha, von der schweren, dreckigen Arbeit, dachte, von denen alle Entbehrungen und Hoffnungslosigkeit auf ein besseres Leben abzulesen waren, wurde er ob seines Entschlusses unsicher.
In diesem Moment konnte Karl seine Tränen und seine Trauer, gepaart mit dem Zweifel ob es nicht doch ein Abschied für immer war, nicht zurückhalten. Und so waren sie sich lange weinend und schluchzend in den Armen gelegen, unwissend, was das Schicksal für sie beide bereithalten würde. Lange sah er Irene an, um sich ihr Abbild zu verinnerlichen und unvergesslich zu machen. In ihren Augen sah er die Verzweiflung und Trostlosigkeit ob seines Wegganges. Und die nicht versiegen wollenden Tränen verbündeten sich mit dem unaufhörlich fallenden Schnee und deckten die Welt rund um sie platonisch mit einem weißen Totentuch zu.
Aber schon im nächsten Moment wünschte er, er hätte Siebenmeilenstiefel, um so schnell wie möglich nach Hause zu kommen, alles für Irenes Ankommen daheim einzurichten, um so schnell wie möglich wieder zu seiner Liebsten zurückzukommen.
Als Karl aus Irenes Blickfeld verschwand, wusste sie sofort, dass ihr etwas fehlte, als hätte sie etwas Lebensnotwendiges verloren. Sogleich fühlte sie sich einsamer und verlassener als je zuvor.