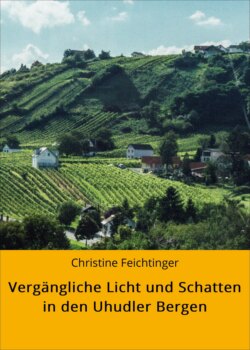Читать книгу Vergängliche Licht und Schatten in den Uhudler Bergen - Christine Feichtinger - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Heimkehr Südburgenland
ОглавлениеKarl war mit seinem Rucksack, Feldflasche, Menageschale, Gasmaske, einem Brotbeutel mit den Bildern von Martha und Irene in den überfüllten Zug in Richtung Heimat gestiegen, wo er nur auf dem offenen Güterwagen einen Platz fand. Er erhaschte einen letzten Blick auf das verweinte Gesicht von Irene und sah ihr weißes Taschentuch noch lange ihm nachwinken. Würde sie ihn gedanklich begleiten?
Die Heimfahrt gestaltete sich gefährlich. Die Feindflieger bombardierten die Züge und beschossen sie mit Bordwaffen. Bei jedem Tieffliegeralarm musste Karl mit den anderen Fahrgästen schleunigst den Zug verlassen und um sein Leben laufen. Dann musste er aus seinem Versteck zusehen, wie der Zug beschossen wurde. Wenn er wieder im Zug war, krochen die Leute bei jedem Fliegergetöse unter die Bänke und wenn die Tiefflieger weg waren, kamen sie bald wieder zurück. Welches Gedränge beim Aussteigen aus dem Zug herrschte, denn jeder wollte der Erste sein.
Als würde Irene ihn begleiten, war ihr Schatten auf seiner langen Reise immer neben ihm. Wie oft griffen seine Hände während seiner stundenlangen Fußmärsche in den Brotbeutel, um einen kurzen Anblick zu erhaschen und sorgsam steckte er es wieder zurück, um es ja nicht zu verlieren.
Es gab keine durchgehende Bahnverbindung mehr und viele Schienen waren zerstört. Wie oft versteckte er sich, um nicht bestohlen zu werden. Meistens nächtigte er bei Bauern im Heu oder im Stall. Sie gaben ihm oft morgens Milch und Brot zu essen. Immer wieder musste er sich ducken und sich verstecken, wenn Bomber über ihn flogen. Er befragte auf seinen Fußmärschen unterwegs alle Personen, die er traf, auch andere Heimkehrer, die zur Anbauzeit heimkehren durften, ob sie etwas von seiner Heimat gehört hätten und wie weit entfernt die Front stand. Bei den Stationen des NSV labte er sich am Eintopf. Er war entsetzt, wenn er die durch Bomben zerstörten Städte sah.
Je näher er seiner Heimat kam, desto mehr stieg Vorfreude auf, aber auch Angst, wie er seine Familie, sein Elternhaus und sein Dorf antreffen würde. Von seiner letzten Übernachtung bei einem Bauern im Stall hatte er sich einen großen, braunen Hasen mitgenommen. Diese große Rasse kannten sie zuhause nicht. Er wollte diesen zuhause mit seinen Hasen für die Zucht kreuzen.
Als hätte der Herrgott selber für ihn das schönste Märzwetter für seine Heimkehr bestellt, war die Luft klar und die Sonne schien wärmend auf sein Gemüt. Nach etlichen gefahrvollen Tagen und Nächten der Heimkehr betrat er am 12.3.1945 den Hotter seines Heimatdorfes nach langer Zeit wieder. Jetzt in der Heimat, ließ er sein stilles Mitbringsel, den unter seinem Arm getragenen Hasen, aus Dankbarkeit für die gute Heimkehr vom heimatlichen Gras fressen.
Wie oft hatte er sich in Todesangst seine Heimat vergegenwärtigt und nun war er, wie in einem Märchen, in eine andere Welt eingetreten.
Wie sehr hätte Karl sich gewünscht, Irene stünde jetzt an seiner Seite und er könnte mit ihr dieses Glück teilen und sie an sich drücken. Aber als sein hungriger Magen knurrte, kam er in die Realität zurück. Wie vertraut ihm alles war. Sein Pulsschlag erhöhte sich und sein Herz hüpfte wie verrückt. Er atmete die gute Luft ein, machte dankbar das Kreuzzeichen und sprach leise ein kurzes Dankesgebet. Am liebsten hätte er sich niedergekniet und den heimatlichen Boden geküsst.
Was für eine idyllische, seit urdenklichen Zeiten sauber von Hand gepflegte Landschaft. Die Natur schien wieder zum Leben zu erwachen. Während er auf den Loasn (Fahrspuren) mit dem vielen Kuh- und Pferdedung ging, sah er die ersten Primeln und Gänseblümchen blühen, und die mit Wintersaat begrünten Äcker.
Als wäre er in eine andere Welt eingetreten, vernahm er das Muhen und Wiehern der Arbeitstiere, das Knarren der alten Äste der Bäume, die Holunderbüsche, aus deren Blüten die Frauen im Sommer Krapfn in Schmalz buken und er hörte lustiges Vogelgezwitscher, wie er es seit Kindesbeinen an liebte. Er sah die Hochstände der Jäger, Futterstellen für die Wildtiere und roch den Gestank eines verwesten Tieres.
Eine krächzende Krähe erhob sich geräuschvoll über ihn und schreckte ihn auf, so als wollte sie ihn vertreiben, damit sie ungestört ihr Nest bauen konnte. Hier an diesem Platz, unter einer großen schattigen Eiche, im Moos, hatte er sich so oft mit Martha getroffen und so oft seine Liebe gestanden.
Anschließend betrat er einen Wald, atmete die gute Luft ein. Er sah die Robinien, welche im Dorf immer fälschlich als Akazien bezeichnet wurden. Diesen Wald kannte er gut, hier hatte er sich sein erstes Zwischl (Astgabelung) von den Wiedl (Weiden) für seine erste Gummischleuder abgeschnitten. Er erinnerte sich, wie er als Schüler mit einem Amper (Kübel) mit dem Herrn Lehrer Lorenz Schmid und den anderen Schülern hierher in diesen Wald gehen musste, um für die Hühner des Herrn Lehrers die Maikäfer als Futter zu sammeln.
Jedes Jahr schnitt sein Vater hier entweder im Frühling, wenn die Weiden im Saft standen und das Laub noch nicht ausgetrieben war, oder im Herbst, wenn die Blätter abgefallen waren, Weidenruten. Die zwei Meter langen Wiedl (Weidenruten) band er zu Bündeln, durch die er zwei Stangen steckte und so nach Hause beförderte. Während die im Frühjahr geschnittenen Ruten vor der Verarbeitung einige Tage ins Wasser gelegt wurden, damit sich die Rinde leichter lösen ließ, wurden die Weidenruten, welche im Herbst geschnitten wurden, gekocht, damit die Rinde abgeschält werden konnte. Dadurch verfärbten sie sich rotbraun. Aus den ungeschälten Wiedl fertigte sein Vater große Körbe mit Henkeln, Obst- und Blumenkörbe. Schwingen (runde bauchige Körbe) und Buckelkörbe mit Schulterriemen aus Leder fertigte er aus Haselnussruten an. Aus dem Besengstauri (Birkenzweigen) erzeugte er Besen.
Von weitem sah er etliche Bäuerinnen, welche in den Eichenwäldern das Lawi (Laub) rechten, um es als Einstreu oberhalb des Strohs im Stall zu verwenden. Mit einem Buckelkorb brachten sie es auf den Krichtlwagen, welcher mit Brettern vermacht war. Die eingespannten Kühe waren zum Schutz vor der Kälte mit Koutzn (Decken) zugedeckt, sie grasten und warteten geduldig auf das Heimfahren. Mit Bitterkeit nahm er zur Kenntnis, dass jetzt großteils nur die Frauen die Landwirtschaft zu betreiben hatten, da die Männer entweder beim Stellungsbau am Südostwall, beim Volkssturm, an der Front verletzt oder vermisst bzw. gefallen waren. Als er näher kam, hörte er sie im gemeinsamen Chor auf ihren Feldern nebeneinander Marienlieder singen, welche wie Klagelieder an sein Ohr drangen.
Karl atmete den frischen Geruch der umgeschnittenen Kiefer ein, wo etwas weiter entfernt eine Frau mit Kopftuch und Schnürschuhen, ein blaues Fiarta (Schürze) umgebunden, mit einem Roafmesser (Reifmesser) die Rinden des Meterholzes schälte.
Auf einem weit entfernten Feld sah er zwei Bäuerinnen beim Tessn (eggen) der Knoarn (Erdschollen) mit ihren Kühen. Eine ging mit einer Goasl (Peitsche) vorne bei den Kühen, während die andere hinten neben der Arn (Egge) ging.
Im selben Moment stellte sich Karl Irene vor, ob und wie sie diese schweren Arbeiten verrichten würde können. Würde Irene überhaupt jemals ihre Heimat und ihre gesicherte Stellung als Krankenschwester in Rosenheim aufgeben?
Und würde sie ob dieser für sie schweren, schmutzigen Arbeit heimisch werden, sich wohlfühlen, ohne Heimweh? Konnte er ihr dies alles zumuten und aufzwingen, unerfahren wie sie war. Würde ihre Liebe dies aushalten und würde Irene diese ihm zuliebe aufgezwungenen Opfer aus Liebe zu ihm lebenslänglich geduldig und stillschweigend auf sich nehmen und konnte er das von ihr verlangen?
Welche Folgen würde es für sie und ihre Ehe haben? Wenn sich Karl vorstellte, wie er womöglich zusehen müsste, wie Irene still vor sich hin litt und ihm jede Hilfe verwehrte, ihn als ihren Feind und Urheber ansah, der sie in dieses Dilemma hineingeritten hatte, sich woanders Hilfe und Trost suchte, er ihre Niedergeschlagenheit und Trostlosigkeit mitverfolgen musste, ohne helfen zu können, ihre stummen anklagenden Augen wie Waffen auf ihn gerichtet ertragen müsste, verfiel er in Unentschlossenheit.
Würde er sich bald schuldig fühlen, wenn er ihren zunehmenden Kummer und ihr Heimweh beobachten müsste? Würde er dann seinen Entschluss, Irene geheiratet zu haben und nicht Martha, einmal bereuen?
Sollte er trotz dieses Wissens Irene in seine Heimat locken und würde es eine gemeinsame Basis geben? Oder würde ihre Liebe wie Eisblumen am Fenster am harten Alltag seiner Heimat zerrinnen und ihr Glück zerschellen?
Und plötzlich sah er eine tiefe Kluft, die sich zwischen Irene und ihm auftat. In diesem Moment kam ihm sein Ansinnen aussichtslos vor. Und trotzdem überkamen ihn gleichzeitig Schuldgefühle, als wäre er ein Verbrecher, dass er ihr eine gemeinsame Zukunft versprochen hatte, sie allein und schutzlos zurückgelassen hatte und nicht wusste, ob er sein Versprechen würde einhalten können. Im selben Moment kam ihm sein Vorhaben unsinnig und aussichtslos vor.
Als Karl weiterging und kurz darauf auf der Anhöhe des Dorfes mitten in den Uhudler-Weingärten und Weinkellern der Bauern stand, sah er, dass die Weinreben im Begriff waren ihr Winterkleid abzustreifen und aus den uralten Reben wie schon seit ewigen Zeiten bald Augen (Knospen) für die jungen Reben hervortreten würden.
Als wäre er in einem anderen Zeitalter heimgekommen, lag seine Heimat wie seit Generationen unverändert und unbeschadet vor ihm. Als gäbe es keinen Krieg auf der Welt.
Wie jung und unerfahren er war, als er seine Heimat verlassen hatte und nun kam es ihm vor, als wäre er als ein alter, erfahrener Mann, der durch die schrecklichen Kriegserlebnisse dem Tod oft näher als dem Leben gewesen war, heimgekehrt.
Er sah eine Reihe nebeneinander liegender Weinkeller, welche alle im gleichen Stil erbaut waren. Die Weinkeller waren aus Holz gezimmert, mit Lehm verschmiert und geweißt. Die meisten waren mit Schab (Stroh) eingedeckt, ohne Strom oder Fließwasser, bestehend aus zwei Räumen und zwei winzigen Fenstern, kleine Häuschen, die an die Häuser der Ureinwohner aus vergangener, längst entrückter Zeit erinnerten.
Gleich hinter den Weinkellern befanden sich die dazugehörigen Weingärten.
Hier auf diesen sonnigen Hügeln gediehen im Sommer die unveredelten Uhudler-Edelrebsorten wie Noah Grün, Othello Blau, Isabella, Ripotella. Dass der Uhudler-Wein blind machen würde, ignorierten die Weinbauern. Zum Schutz vor den Staren klingelten in allen Weingärten die an den Krahschreckern (Vogelscheuchen) befestigten Gegenstände im Wind. Schon als Kind musste Karl mitgehen und den Wand (Weingarten) mit der Haue mindestens viermal im Jahr hauen. Ebenso mussten die Weinreben mit Stroh gebunden und ausgebrockt werden. Wurden neue Setzlinge gesetzt, musste regalt (händisch tief umgestochen) werden.
Diese Weinkeller dienten auch als Ausflugsziel sowohl für die Dorfbewohner als auch für Fremde und waren als eine Art von Zweitwohnsitz auch für das Auskurieren von Familienproblemen beim Uhudler-Wein beliebt und so mancher Jungbauer wünschte sich, seine verhassten Schwiegereltern für immer dorthin verbannen zu können. Die Weinbauern trafen sich mit ihren Spezln und anderen Weinbauern (Freunden) zum Dischpatieren (Diskutieren) über alltägliche Arbeiten, über die Saaten, Ernten usw. Dann verglichen sie ihre mitgebrachten Weine und erklärten, von welchen Trauben der Wein war, ohne das Geheimnis der eigenen Weinherstellung zu verraten.
Mitgebracht wurden nur die besten Weine, während die Männer zuhause nur den minderwertigen Stinglwein (Heckenklescher) tranken, wofür die Trebern ein zweites Mal gepresst wurden.
Wie oft durfte Karl von Kindesbeinen an nachmittags mit seinem Vater Viktor in den Weinkeller mitgehen und Most trinken.
Vor dem Einmarsch Hitlers war Karls Vater Bürgermeister gewesen. Wie oft hatte sein Vater als Bürgermeister den Nachtwächter, den Schinder (Wasenmeister des Aasplatzes), die Gemeinderäte, den Waldhüter und den Herrn Lehrer und Kantor Lorenz Schmid in seinen Weinkeller eingeladen.
Lorenz Schmid, welcher ihm als guter Freund stets behilflich war, ihn bei all seinen politischen Entscheidungen und schriftlichen Anträgen half, ihm nach seinem Ersuchen jedes amtliche Schreiben vorlas und erklärte, Ansuchen für die Gemeinde schrieb und ihn bei allen Amtswegen beriet, zu Ämtern und Behörden begleitete, war er deshalb zu besonderem Dank verpflichtet. Jedes Mal beim Sautanz gab er ihm ein Stück gebratenes Fleisch, Blutwürste und Sauerkraut mit frischen Grammeln und frisch gebackenem Brot.
Denn Viktor Ertl konnte nicht gut deutsch, zumal er nur sporadisch in die ungarische Schule gegangen war. Zwei Monate lang war er in die Bürgerschule gegangen, aber dann hatte ihn sein Vater zu
seinem Missfallen herausgenommen. Nachdem bis zum Anschluss des Burgenlandes an Österreich in allen Schulen ungarisch unterrichtet worden war, waren Viktor Ertl und die anderen deutschsprachigen Kinder sechs Jahre lang in die ungarische Schule gegangen, wenn sie nicht im Dienst bei größeren Bauern waren oder zuhause in der Landwirtschaft arbeiten mussten. Deshalb verstanden und lernten sie nicht viel. Im Winter hatte er sowieso nicht die Schule besucht, da er keine winterfesten Schuhe und Bekleidung hatte. Insgeheim lächelte Karl, wenn er daran dachte, wie sein Vater das Belegen einer Kuh in seinem Kalender eintrug: „Munzi beleckt.“
Alle Gäste im Weinkeller schätzten die Gastfreundschaft von Viktor Ertl, tranken den Wein und schauten zu, wenn er ein saftiges Uhudler-Weinbratl mit knusprigen, im Rohr gegarten Ofenkartoffel briet. Wie schon so oft vorher wurde über das Dorfvorhaben politisiert. Es hätte so manches politische Vorhaben im Dorf unter den kontrahierenden Gemeindevätern ohne die endlos durchzechten, diskussionsreiche Nächten unter der Patronanz der Promille in weinseliger Stimmung stattgefundenen Verhandlungen nicht durchgeführt werden können, wenn nicht der Wein ihre Sinne vernebelt hätte. Spätestens beim letzten Fluchtachterl hatte der Gevatter Wein spöttisch lachend sein Werk oft friedlich vollbracht. Gar mancher Bauer freute sich schadenfroh und verspürte manches Mal Genugtuung, wenn er dem studierten Herrn Lehrer einen Rausch annähen (anhängen) konnte, wo er sich sonst ihm gegenüber minderwertig vorkam, aber beim Weintrinken ihm haushoch überlegen war.
Durch den übermäßigen Alkoholkonsum blühte der Tratsch anschließend im Dorf auf, denn nachdem der Wein sie betäubt hatte, verwechselten die Männer oft zuhause Wahrheit und Unwahrheit.
Wie oft kamen, durch den Wein enthemmt, die negativen Charaktereigenschaften mancher Männer ungehemmt zum Vorschein.
Von den durch ihre manchmal rauschigen (betrunkenen) Männer verärgerten Frauen des Dorfes wurde dieser Ortsteil verächtlich „Sündenpfuhl“ oder „Lasterberg“ genannt. Jedes Mal, wenn die Männer ins Dorf vom Weinkeller betrunken nach Hause kamen, schimpften die Ehefrauen, sie (die Männer) würden schauen „wie ein Uhu“, woher wahrscheinlich der Name „Uhudler“ kommt.
Manches Mal, wenn Karls Vater von seiner Frau Anna Schimpfer bekam, wenn er zu viel trank, die Zeit vergaß und nicht zum Füttern der Haustiere heimkam und seine Mutter die Arbeit seines Vaters auch machen musste, rechtfertigte er sich lachend, dass er trachten müsse, die Fässer zu leeren, damit der neue Wein im nächsten Jahr wieder Platz in den Fässern hätte.
Als Karl Ertl nun an jenem Märztag des Jahres 1945 vor ihrem Weinkeller stand, erinnerte er sich, wie er sich immer fürchtete, wenn er als Kind vom Weinkeller den Uhudler-Wein holen musste, denn wenn er die schwere, quietschende Eingangstür aufsperrte, kreuchten und fleuchten allerhand Fledermäuse, Ungeziefer, Mäuse geräuschvoll aus der Dunkelheit hervor und an ihm vorbei. Schon von seiner frühesten Kindheit an musste er für Zuhause eine Flasche Wein holen, mit dem Weinheber aus Kürbisgewächs vom Eigenanbau vom Weinfass Wein ansaugen, in die mit Strohgeflecht umwundene Flasche mit dem Trochter (Trichter aus Kürbisgewächs) füllen und heimbringen. Der Dunst und der erste Schluck des Weines verursachte ihm als Kind immer Übelkeit.
Das Versteck des Schlüssels für den Weinkeller kannte er. Nun holte er den Schlüssel und sperrte auf, den Hasen unter seinem Arm. Die alte Eichentür quietschte, während er sich bückte, um in den niedrigen Raum einzutreten. Drinnen roch es muffig. In dem uralten von Holzwürmern zerfressenen Gebälk krachte die alte Tramdecke. Ihm kam es jedes Mal vor, als ob die Urahnen hier hausten, alles beobachteten und belauschten und ein Zeichen ihrer Anwesenheit gaben.
Hier war die Zeit vor Jahrzehnten stehen geblieben und es schien, als würden die Vorfahren gespensterhaft durch die offenen Ritzen des alten Gebälks lugen, ob ihr Platz noch immer unverändert auf sie wartete. Wie oft, wenn sich das viele Ungeziefer im uralten Holzbau geräuschvoll bemerkbar machte und der Wein die Sinne der Menschen vernebelte, erschrak der eine oder andere und fühlte sich durch die verstorbenen Seelen seiner Vorfahren als Sünder beobachtet und enttarnt.
An der Wand hing ein von seiner älteren Schwester Maria, welche alle Ritsch nannten, mit blauen Schlingstichen ausgenähtes Deckerl. Darauf stand: „Die Ruhe ist dem Menschen heilig, nur der Närrische hatʼs eilig.“
Wie oft waren seine Eltern mit den Kindern hier im ersten Zimmer des Weinkellers gesessen, um nach der Arbeit zu rasten oder zu diskutieren. Hier standen ein kleiner Transportierofen, ein altes Bett mit einem Strohsack, ein Tisch und eine Bank zum Sitzen, im zweiten, finsteren Raum, dem Pressraum, waren die Weinpresse, der Rebler, ein Trog, ein Amper (Kübel) die schweren Eichenfässer voll Wein und sonstiges Zubehör untergebracht.
Ein paar Uhudler-Trauben waren auf einer mit Draht aufgehängten Stange aufgefädelt, welche seine Mutter für Strudelfüllen getrocknet hatte. Er zupfte sich von den aufgehängten Weintrauben ein paar Kerne herunter, holte sich mit dem Weinheber ein Glas Wein aus dem Fass, setzte sich im vorderen Zimmer nieder und schaute aus dem kleinen Fenster, während er sich eine Zigarette anzündete. Jetzt erinnerte er sich, wie eine verwirrte, alte Frau vor langer Zeit sich in dieses kleine Fenster zu ihrem Weinkeller gequetscht hatte und stecken geblieben war. Sie war dement und schrie nach Leibeskräften immer nur „Amerika, Amerika“ bis sie gefunden und gerettet worden war.
Karl zündete das verrußte Petroleumlämpchen an und der schwache Schein erfüllte den Raum spärlich mit Licht.
Sogleich roch er den unangenehmen Petroleumgeruch, während die Russkäfer und Wanzen hervorkrochen und Schatten warfen.
Jetzt bemerkte Karl, dass der Transportierofen noch warm war. Es musste erst kurz vorher von seiner Familie jemand hier gewesen sein. Wahrscheinlich waren sie mit dem Rebschnitt beschäftigt und rasteten wie immer nachher im Keller bei einem Glas Uhudler-Wein, oder es war ein Weingartennachbar mit einer Flasche Uhudler zum Tratschen hierhergekommen und sie hatten den Ofen geheizt und waren dann zum Füttern der Tiere heimgegangen.
Karl blies in die Gliacht (Glut) und sogleich loderten die Flammen wie Zünglein hoch. Bald legte er Holzscheite nach und das Feuer knisterte und ergab eine behagliche, wohlige Wärme.
Im Backrohr sah er eine gebratene, gut duftende Krumpern (Kartoffel) liegen und sogleich meldete sich sein knurrender Magen zurück.
Als Karl die warme Krumpern in seiner Hand betrachtete, kam ihm in Erinnerung, wie oft er zuhause mit den hungrigen, amerklekerischen (lusterischen) Geschwistern um die letzten heißen Krumpern gestritten und gerauft hatte und wie oft sie aus dem Futterdämpfer, in welchem die Krumpern für die Schweine gekocht wurden, welche gestohlen hatten. Das Wasser lief ihm im Mund zusammen und sogleich verschlang er gierig die Kartoffel als wäre sie ein Festessen.
Wie oft war Viktor Ertl mit seinen Kumpeln (Kameraden) hier gesessen und hatte über die alltäglichen Arbeiten in der Landwirtschaft, das wirtschaftliche Fortkommen, das Anbauen und Gedeihen der Saat, der gefechsten (geernteten) Naturalien, die schlechte Wirtschaftslage, Armut und die große Arbeitslosigkeit dischkuriert (diskutiert).
Karl erinnerte sich an seine Kindheit. Die Not hatte sich in der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre, ausgelöst durch den Börsencrash in New York, klammheimlich wie eine giftige Natter in jedes Haus geschlichen, sodass alle zum äußersten Sparen gezwungen waren. Durch die Weltwirtschaftskrise konnten die Bauern ihre Produkte infolge der mangelnden Kaufkraft nicht kostendeckend absetzen. Die Arbeitslosigkeit, Inflation und Verschuldung vieler Bauern verschärften die finanziellen Probleme. Die hohen Kreditzinsen führten viele Bauern in den Ruin. Auch die Eltern von Karl hatten Schulden.
Durch den plötzlichen und unerwarteten Tod seines Vaters musste Karls Vater Viktor Ertl in jungen Jahren den Hof übernehmen und jedem seiner fünf minderjährigen Geschwister laut der gerichtlich angeordneten Schätzung der Landwirtschaft Erbteilsforderungen im Gegenwert von je sechs Kühen auszahlen. Den Betrag musste er teilweise beim Gericht hinterlegen und der ganze Betrag wurde im Grundbuch einverleibt, was ihm arge finanzielle Probleme bereitete und ihn in arge Zahlungsschwierigkeiten drängte. Die Zwangsversteigerung drohte.
Die Landwirtschaft von Karls Eltern zählte, wie die meisten Landwirtschaften im Dorf, zu den kleinen Landwirtschaften mit vielen hungrigen Kindern. Diese kleinen Landwirtschaften konnten die kinderreichen Familien schlecht ernähren und die Mütter hatten viel Mühe, ihre zahlreichen Kinder satt zu bekommen. Im Haus wurde das Brot eingesperrt. Wie oft bekamen die Kinder Schimpfer, wenn sie unerlaubt, hungrig, das warme Brot, das sich noch mugelte (zu heiss war), anschnitten, noch dazu ohne wie es üblich war drei Kreuzzeichen vor dem Anschneiden auf den Laib Brot zu machen. Und wie oft mussten die Kinder zur Strafe auf spitzen Holzscheiten knien und beten.
Deshalb gingen Karl und sein älterer Bruder Toni sowie alle anderen Kinder, angefangen im Alter von neun Jahren, in den Dienst zu größeren Bauern im gleichen Dorf oder in andere Dörfer, um sich selbst zu versorgen. Die Kinder gingen vom März bis Oktober die meiste Zeit bloßfüßert (barfuß). Im Dienst gingen sie in den dortigen Schulen nur sporadisch in die Schule, da sie vorwiegend arbeiten mussten bzw. in der kalten Jahreszeit keine Schuhe und warme Kleidung hatten, um in die Schule zu gehen.
Bei den wenigen Besuchen zuhause beschwerten sich Karl und Toni über die schwere Arbeit, wenn sie voller Läuse und Flöhe von den Ställen ihrer Dienstgeber vom Dienst heimkamen. Aber ihr Vater erklärte nur, es würde ihnen nicht schaden, arbeiten zu lernen.
Im nächsten Moment fiel Karls Blick auf den Kroatnwitschker (Messer), welcher Toni, seinem ältesten Bruder, gehörte. Wie oft hatten sie damit als Kinder aus Holz Spielzeug, Pfeile und Werkzeuge geschnitzt.
Toni hatte den Kroatnwitschker hier das letzte Mal vor seinem Weggehen dafür verwendet, dass er für jede Butte voller Weintrauben bei der Weintraubenernte in einen abgeschälten Holzstab eine Kerbung eingeschnitten hatte als Kontrolle der besseren oder schlechteren Ernte gegenüber dem Vorjahr.
Karl sah Toni förmlich vor sich, als er damals beim Abschluss der Weintraubenernte einen Juizer (Juchzer) ausstieß aus Freude für die gute Ernte, so wie er es nach jeder Ernte beim Leukauf (kleine Feier) tat.
Und augenblicklich schweiften Karls Gedanken ab an seine glückliche Kindheit mit Toni, als wären die markanten Vorfälle gestern passiert und hätte dieser Raum für immer die Erlebnisse konserviert, während er sich kurz auf den knisternden Strohsack des Bettes legte. Er bemerkte bald, dass der Strohsack nicht mit Stroh, sondern mit getrockneten, zerkleinerten Kukuruzblättern gefüllt war.
Mit Toni teilte Karl seit Kindesbeinen viele Geheimnisse, mit ihm rauchte er seine erste selbst gewuzelte (gedrehte) Zigarette aus Tabak vom eigenen Anbau, wobei sie den Tabak mit Kukuruzstroh streckten, da der Tabak allein scheußlich schmeckte. Das Gemisch von Tabak und Kukuruzstroh trug Toni immer griffbereit in einer getrockneten Saublatter (Blase des Schweines) um den Körper gebunden. Mit den Zeitungsblättern des Stürmers wuzelten (drehten) sie sich die Zigaretten selber.
Jedes Mal bei der Weinlese half der Herr Lehrer Lorenz Schmid als Gegenleistung für den Sautanz und sonstige Naturalien. Schwitzend und keuchend trug er mit einer Butte die süßen Weintrauben in den Bergkeller, wo sie mit einem Trifler heruntergetrifelt (gerebelt) und die Maische in der Presse gepresst wurden. Karl erinnerte sich genau an jenen Tag der Weinlese, als er und Toni mit ihrem Vater Viktor Ertl und dem Herrn Lehrer Lorenz Schmid in den Dreißigerjahren hier an diesem Platz saßen und der Herr Lehrer nach einigen Gläsern sich Mut angetrunken hatte und seinen Vater als Bürgermeister um seinen ausständigen Lohn gebeten hatte. Die Dorfschule war Eigentum der Gemeinde und als Gemeindeschule musste die Gemeinde für das Gehalt des Lehrers und die Instandhaltung der Schule aufkommen.
Als der Herr Lehrer inständig seinen ausständigen zweimonatigen Lohn von Viktor Ertl verlangte, erklärte ihm dieser bedauernd, die Gemeinde hätte nun für ihn kein Geld, denn zuerst müsse ein Saubär gekauft werden, dieser Ankauf sei wichtiger. Denn jeder Bauer müsse seine Schweine zum Belegen zum Saubären bringen. Im gleichen Moment bat er den Herrn Lehrer freundschaftlich, sich mit dem von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Lehrergrund, auf dem er sich Gemüse und das Futter für seine Schweine, Hühner, Hasen anbauen konnte, und mit dem Lehrerwald, wo er das Holz zum Heizen als Deputat (Teil seines Lohnes) bekam, sich zu gfretten (begnügen) und noch kurze Zeit über Wasser zu halten. Als Trost gab er dem Herrn Lehrer ein Stück Geselchtes und Speck mit.
Wie beschämend es für den Herrn Lehrer war, als Toni höhnisch zu lachen anfing ob dieser Absage.
Nie würde der Herr Lehrer das höhnische und beschämende Lachen von Toni Ertl vergessen. So sehr der Herr Lehrer Viktor Ertl schätzte, so sehr verachtete er seinen Sohn Toni Ertl. Schon als sein Schüler war Toni Ertl selbstbewusst, aufrührerisch, leicht zu beeinflussen, für jede Verlockung leicht zu haben und als Rädelsführer und Hitzkopf immer gerne im Mittelpunkt seiner Anhängerschaft gestanden. Für ihn war Toni überheblich, ein sich selbst überschätzendes Großmaul, dessen Noten und Intelligenz zu wünschen übrig ließen.
Wie oft ärgerte sich der Herr Lehrer über die hitzigen, dickköpfigen Grünschnabel im Dorf und wie oft hatte er enttäuscht und niedergeschlagen den Kopf geschüttelt, wenn er am Sonntagnachmittag zusehen musste, wie sich die zwei rivalisierenden Gruppen, nämlich die Hahnenschwanzler mit ihrem Anführer Toni Ertl, und die Sturmscharler im Dorf etablierten und vormals friedlich nebeneinander lebende, fleißige Nachbarbuben nun durch Hetze von gegenseitigem Hass zerfressen sich bekämpften und der Terror und die Radikalisierung im Dorf zunahmen. Wie oft blickten ihn seine ehemaligen Schüler aus höhnischen Augen an, welche sich von ihm unterschätzt und minderwertig behandelt und schlecht benotet fühlten und ihm nun selbstherrlich vorführen wollten, was aus ihnen, trotz seiner ewig gestrigen Verwarnungen, geworden war. Wie oft hatte er ihnen gepredigt, sich nicht blenden und von plumpen Versprechungen verführen zu lassen, es sei nicht alles Gold was glänzt, und ihnen unermüdlich eingetrichtert, sich zu vertragen, sich nicht verhetzen zu lassen, aus der Geschichte zu lernen, ihre Zeit sinnvoll einzusetzen, sich nie wieder gegenseitig zu bekämpfen, da sie alle Österreicher seien.
Resigniert musste er feststellen, dass seine Reden fruchtlos im Wind verhallten. Jeden Sonntagnachmittag marschierten die Hahnenschwanzler und die Sturmscharler singend, getrennt, die Hahnenschwanzler im Untertrum, die Sturmscharler im Obertrum des Dorfes, um sich auszuweichen, und hielten Paraden mit Musik und Fackelzügen ab. Dann kehrten sie meist im Gasthaus ein, wo sie nach einigem Alkoholgenuss sich verspotteten, rauften und blutig geschlagen heimkehrten.
Als am 25. 7. 1934 die Nationalsozialisten einen Putsch in Österreich versuchten, waren auch Toni Ertl und die anderen Mitglieder der dörflichen Hahnenschwanzler dabei. Und als Toni Ertl mit den anderen dörflichen Hahnenschwanzlern, welche gut organisiert waren und Sympathien für die NSDAP zeigten, mit etlichen Lastkraftwagen von mehreren Dörfern gesammelt nach Wien fuhren, um beim Putsch am 25. 7. 1934 in Wien dabei zu sein, am selben Tag mit zerdeptschen (ruinierten) Federn und Hüten nach Hause kamen und beklagten, dass sie nicht ahnen konnten, dass es Tote geben würde, und sie wie beim Mausnen (Federlassen der Hühner wenn sie keine Eier legten) die Federn lassen mussten, schalt der Herr Lehrer Toni Ertl und die anderen Hahnenschwanzler, sie sollten endlich begreifen, was sie mit ihrer Tätigkeit anrichten würden, und Ruhe geben.
Den zerdepschten Hut in der Hand, mit einer Schnittwunde im Gesicht, erklärte Toni Ertl deprimiert, er habe nicht gewollt, dass dieser Putsch derart enden würde und dass Engelbert Dollfuß, der die vaterländische Front am 21. 5. 1933 gegründet hatte, ums Leben kommen würde, während er seine sonnenverbrannte Haut betrachtete.
Dass Toni Ertl und die anderen Hahnenschwanzler nun derart deprimiert heimkamen, erfasste den Herrn Lehrer mit Genugtuung. Vielleicht haben sie nun ihr Lehrgeld bezahlt, einen Denkzettel erhalten und würden nun endlich gescheit werden, dachte er.
Niemals hätte der Herr Lehrer Viktor Ertl, mit dem er gerne beisammen war und gerne mit ihm diskutierte, auf seinen großkotzigen Sohn Toni angesprochen. Er wollte ihn nicht kränken.
Toni Ertl war, wie viele seiner Freunde und Anhänger bestrebt, das alte, arme Leben hinter sich zu lassen und sah einen Lichtblick für ein besseres Leben mit Arbeitsplätzen, Fortschritt, ohne Hunger und Armut, nur in der NSDAP.
Obwohl die NSDAP und alle ihr zugehörigen Institutionen in Österreich vom 19. 6. 1933–12. 3. 1938 verboten waren, arbeitete Toni mit anderen Anhängern der Partei im Untergrund weiter.
Karl kannte alle Geheimnisse von Toni, die er als Illegaler der NSADP hatte, denn so wie in den anderen kinderreichen Familien, wo die größeren Kinder im Winter im Stall und im Sommer im selbst gezimmerten Bett am Heuboden schliefen, zimmerten sich auch Toni und Karl gerne jedes Jahr im Frühjahr Betten für den Heustadel, damit sie vogelfrei waren. Aber auch, weil es im Haus zu wenig Platz für die vielen Kinder gab.
Wie oft schlich sich Toni abends, wenn es schon dunkel war, auf der Leiter vom Heuboden herunter, um unkontrolliert und unbeobachtet sich mit anderen Illegalen im Heimatdorf von Stefan Resner, dem Mann von Tante Mitzi, der jüngsten Schwester seiner Mutter, welcher ein paar Dörfer entfernt wohnte, zu treffen. Er musste einen langen Fußmarsch durch den Wald machen und traf sich dort mit den anderen Gleichgesinnten im Keller eines Gasthauses, wo die Uniformen der NSDAP bereit lagen.
Jedes Mal, wenn jemand Unbekannter sich verdächtig näherte, läutete ein Verbündeter oben im Gasthaus die Glocke, damit sie sich unten im Keller ruhig verhalten sollten.
Wie oft zitterte Karl, wenn Toni nachts vom Heustadl herunterstieg, sich mit anderen Illegalen, welche das Parteiabzeichen verstohlen unter dem Revers trugen, alle im Glauben an ein besseres Leben, traf, um an den verschiedensten Streuaktionen von Flugschriften oder selbst gebastelten Papierhakenkreuzen, Störung von Veranstaltungen und Beschmierungen von Häusern und öffentlichen Gebäuden mit Hakenkreuzen, teilzunehmen. Ihre Parole lautete: „Trotz Verbot nicht tot.“
Karl atmete jedes Mal erleichtert auf, wenn er frühmorgens beim ersten Hahnenschrei die Schritte von Toni hörte und die Leiter heraufsteigen sah. Dann war seine erste Frage an Toni, wie viele Illegale da waren, wer alles da war und was sie heute gemacht hätten.
Eines Morgens im Morgengrauen als Toni ganz verrußt und rauchig stank und angesengte Haare hatte, vertraute er seinem Bruder Karl an, dass er die Hütte des Schleifer-Hans, eines im Dorf im Zigeunerwald ansässigen Roma, als eine Art Mutprobe und zwecks Erfüllung der heimlichen Aufnahmebedingungen angezündet hätte. Obwohl die Flammen meterhoch waren, das Feuer weiter griff und die ganze Roma-Siedlung im Zigeunerwald abbrannte, was von weitem sichtbar war, läutete niemand im Dorf wie sonst bei einem Brand üblich das spezielle Glockengeläute als Alarmzeichen für die Feuerwehr.
Es kam keine Feuerwehr löschen. Hinter dem Gebüsch versteckt lauerte Toni und schaute schadenfroh zu, wie alle Roma-Kinder und Erwachsene schreiend barfuß mit den nötigsten Habseligkeiten wegliefen. Niemand leistete ihnen Hilfe oder gewährte ihnen Unterkunft im Dorf.
Die Roma-Männer versuchten den Brand zu löschen, allerdings ergebnislos. Es brannte die ganze Siedlung der Roma ab. Nachdem alle Hütten aus Holz waren, blieben nur die gemauerten Rauchfänge übrig.
Sogleich nach seinem Geständnis ließ Toni seinen Bruder Karl bei seinem Augenlicht schwören, ihn ja nicht zu verraten.
Aber es war gar nicht notwendig, dass Karl schwieg, denn am selben Tag war der Schleifer-Hans mit seiner Frau und seinen vielen Kindern weinend und schreiend, barfuß, in zerfetzten Kleidern in Karls Elternhaus gelaufen, war auf den Misthaufen gehüpft und hatte wild fuchtelnd geschrien, der Erzengel Gabriel solle mit seinem flammenden Schwert alle vernichten, sodass jeder im Dorf munkelte, der Toni wäre der Brandstifter gewesen.
Fortan musste Karl jedes Mal, wenn Toni ihm die heimlichen Geschehnisse der Nacht anvertraute, ihm das Versprechen geben, ihn ja nicht zu verraten. Karl stand viele Ängste um Toni aus. Wie oft zitterte er, ob er wieder gesund heimkommen würde. Jedes Mal, wenn Toni vom Heuboden auf der Leiter hinunterstieg, rief Karl ihm nach, er solle auf sich aufpassen und gesund wieder kommen.
Nur in Liebesdingen war Toni verschlossen. Eines Abends, als Karl allein war und schon eingeschlafen war, war er erschrocken aufgewacht als er hörte, wie jemand die Leiter zu ihm hinaufkrallte (stieg). Verwundert darüber, dass Toni schon da war, rief er verschlafen: „Toni, bist du schon da?“ Als keine Antwort kam, fühlte er leise Schritte auf sich zukommen und eine Frauenstimme antwortete: „Toni, bist du allein?“ „Wer ist da?“, fragte er erschrocken, auf einmal hellwach. „Wir machen es uns jetzt schön, ich habe mich mit der gʼschmeckerten (gut riechenden) Soaft (Seife) aus Amerika eingeseift, riech einmal, wie gut ich schmecke. Weißt du zu mir kommen immer bessere, gschmeckerte Herren für eine schöne Zeit, die haben mir die Seife gebracht“, flötete die Unbekannte mit süßer, hoher verstellter Stimme, als würde sie zu einem Kind sprechen. Sogleich nahm sie Karls Hand und führte sie zwischen ihre schwammigen, dicken Oberschenkel. Ihr warmer Körper schmiegte sich an ihn. Diese unbekannte Frau voller Wollust begann ihn im Dunkeln zu streicheln und flüsterte ihm zärtliche Worte zu.
Erfahren als seine Lehrmeisterin nahm sie von Karl, im Schutz der Dunkelheit stellvertretend für Toni, Gebrauch, ohne dass er sich rühren traute, geschweige sich wehren konnte vor lauter Erschrockenheit. In Liebesdingen war er gänzlich unerfahren. Er hatte immer gedacht, dass er sein erstes und letztes Liebesabenteuer nur mit Martha haben würde. Und plötzlich küsste ihn diese Unbekannte, stürmisch und leidenschaftlich. Wie zwei Tiere im Dunkeln, einander fremd, gab Karl bald seinen Widerstand auf und ließ sich verführen. Beim Abschied flüsterte sie ihm verschwörerisch zu, er solle sie ja nicht verraten, denn sie sei verheiratet, habe Kinder und wolle ihre Ehe nicht gefährden und ihre Ehre nicht verlieren. Sie wolle ihn bald wieder besuchen.
In dieser Nacht konnte er nicht schlafen. Wer war diese Frau? War es jene geheimnisvolle, unersättliche Frau, die von den Männern des Dorfes verächtlich als „die Frau mit der weißen Leber“ bezeichnet wurde, wie er schon öfters aufgeschnappt hatte. Im gleichen Augenblick fühlte sich Karl schuldig, Toni quasi betrogen und um sein Vergnügen gebracht zu haben. Seine Mutter staunte nicht schlecht, als er am nächsten Morgen den Futterdämpfer einheizte, um sich mit dem erwärmten Wasser sein schlechtes Gewissen ob seiner Untreue gegenüber Martha und seiner Sünde im Bottich abzuwaschen.
Von nun an hatte Karl nicht nur Angst, Toni würde verletzt oder gar nicht heimkommen, sondern auch deswegen, von dieser liebeshungrigen Frau heimgesucht und von Toni erwischt zu werden.
So wartete Karl schlaflos mit klopfenden Herzen bei jedem Geräusch jede Nacht auf Toni, um künftig sein Kommen nicht zu verschlafen. Denn nach diesem Vorfall hatte er mit Toni ausgemacht, dass er die Leiter hinaufziehen werde und dann, wenn Toni heimkam und wie ein Vogel als heimliches Zeichen pfiff, ihm die Leiter hinunterreichen würde.
Schon am nächsten Abend hörte Karl wieder ein flehentliches Flüstern: „Toni lass mich zu dir kommen.“ Toni rührte sich nicht und als Karl ihn am nächsten Tag darauf ansprach, sagte Toni nur: „Das macht nichts, die Depperte geht zum nächsten Heuboden.“
Karl überlegte kurz, ob Toni gewusst hätte, wenn er ihn gefragt hätte, wer diese Frau war. Wie gerne hätte er ihn gefragt. Aber Toni war schon so lange weg. Wie lange hatte er ihn nicht mehr gesehen?
Im nächsten Moment nahm Karl das Bild von Irene und schaute es an. Sofort erwachten seine Gefühle für Irene. Wie oft schon tröstete er sich mit ihrem Bild und verehrte es wie ein Götzenbild. Seine Erinnerungen und sein Verlangen nach ihr überwältigten ihn, wenn er an ihre eng aneinander gekuschelten Körper und ihre Küsse dachte. Seine Sehnsucht nach ihr ließ sein Blut aufwallen und sein Herz pochte wie wild voller Begierde.
Als Karl kurz darauf aus dem Fenster sah, freute er sich, denn er sah den Nachbarn ihres Weingartens, den Steffl-Watschi, beim Rebschnitt.
Er erinnerte sich, wie er als neunjähriger Bub beim Steffl-Watschi im Dienst war.
An seinem ersten Arbeitstag im Dienst musste Karl mit einem Stock neben der im Freien aufgelegten Leinwand stehen, um die Gänse und Hühner wegzujagen, damit sie den Stoff nicht verunreinigten.
Die Bauern bauten den Hoarlinsert (Flachs) an und verarbeiteten den eigenen Flachsanbau. Sie rissen den Flachs aus und trockneten ihn in Bündeln auf dem Feld. Die Frauen brechelten den Flachs im Winter, kämmten ihn, spannen mit dem Spinnrad das Garn, trugen das Garn zum Weber und die dadurch gewonnene Leinwand begossen sie und legten diesen kratzenden Stoff zum Bleichen im Freien in die Sonne. Aus dem Material fertigten sie Handtücher, Geschirrtücher, Hemden und andere Kleidungsstücke an.
Karl half bei den Stallarbeiten, bei den Feld-, Weingärten- und Waldarbeiten. Ebenso half er beim Anschirren der Tiere vor der Ausfuhr auf die Felder und Wiesen, verjagte im Freien die Bremsen und sonstigen Insekten von den Tieren, half bei der Heimkehr, die Tiere zu wassern, wobei die Tiere zum Uisch (Wassertrog) im Hof geführt wurden, wo mit einem an einer Kurbel befestigten Amper (Blechkübel) Wasser vom Brunnen heraufgehoben und in den Wassertrog geschüttet wurde. Oder er schüttete das Wasser in ein Wasserschaff, gab den Wasserprügel zwischen die Henkel des Wasserschaffes, und zu zweit trugen sie das Wasser zum Wassern (Tränken) der Tiere in den Stall. Beim Klebn- (Huf-)Ausputzen und -Schneiden half er die Hufe zu halten. Immer, wenn sich eine Kuh in die Klebn etwas eingetreten hatte, die Hufe eiterten und mehrere Hufe betroffen waren, musste die Kuh auf einem Gestell befestigt und aufgehoben werden, damit der Klebnputzer des Dorfes die Hufe reinigen und schneiden konnte. Daher mussten die Dienstbuben die Hufe aufhalten.
Beim Zuilossn (Belegen) der Kühe beim Gemeindestier, wohin jede Kuh zum Belegen gebracht wurde, stand Karl vorne beim Zaumzeug, damit das Tiere still hielt, und massierte mit der Goasl (Peitsche) leicht den Rücken, damit die Kuh den Rücken zur leichteren Empfängnis krümmte. Er wachte, wenn die Schweine und Kühe ausschütteten (Junge bekamen), ganze Nächte in den Ställen, um aufzupassen, dass die kleinen Farl (Ferkel) nicht erdrückt werden beziehungsweise massierte das kleine, neugeborene Kalb mit Stroh und Heu, damit der Kreislauf angeregt wurde. Ebenso massierte er die Tiere mit Stroh oder Heu, wenn sie Blähungen hatten. Die Dienstbuben halfen in den vielen Winternächten Kern ausschlagen (Kürbiskerne schälen), trugen die getrockneten Kürbiskerne zum Kernausschlager und brachten in einer Kanne das Kernöl und in einem Korb auf dem Kopf den Abfall (Kuchen) für das Verfüttern der Kühe heim.
Das Leder des Zaumzeugs rieb Karl mit der Schmer (Fett) ein, damit es nicht brüchig wurde, das Kummet mit Lederöl, um es winterfest zu machen. Das Aluminium putzte er mit Sidol, sodass es glänzte.
Die Dienstbuben putzten jeden Tag Kühe und Rösser, nur am heiligen Christtag, Pfingstsonntag, Ostersonntag nicht. Dienstbuben gingen an den kirchlichen Feiertagen und an kleinen Bauernfeiertagen, am 2. Feber zu Maria Lichtmess (Kerzenumzug und Dienstbotenwechsel), 3. Feber Blasiustag (Blasiussegen der vor Halsweh schützt), 17. März Patrizitag, 4. Mai Tag des hl. Florian, 8. und 13. Juni hl. Antonius und hl. Patrizius, Schutzpatrone für Wirtschaft und Vieh in die Kirche und machten nur die Stallarbeit, auf den Feldern wurde nicht gearbeitet.
An diesen heiligen Tagen mussten sie den Stall nicht ausmisten, sondern brauchten nur Stroh über das alte verschmutzte Stroh geben, welches einen Tag vorher bereitgestellt worden war, um an diesen Tagen nur das Notwendigste zu arbeiten. Auch im Haus wurde nur das Notwendigste getan. Nicht einmal die Küche wurde an diesen heiligen Tagen ausgekehrt.
Die Dienstbuben schliefen im Winter in den warmen Ställen und im Sommer auf den Heuböden oder Futterkammern der Bauern und bekamen Kost und Quartier. Zum Essen in der Früh wurde mit Brot eingebröckelter Malzkaffee verzehrt, mittags gab es von der für alle in der Tischmitte stehenden Rein, und abends bekamen die Buben ein Stück Brot, wenn sie in die Küche kamen. Einige Dienstbuben waren nur über den Sommer im Dienst, während ihre Eltern auf der Grünarbeit waren. Als Lohn bekam Karl von seinem Dienstherrn einen Anzug und seine Eltern bekamen jährlich einen Sack Getreide.
Im gleichen Augenblick erinnerte sich Karl an jenen denkwürdigen, unvergesslichen Abend, als Karl infolge einer Verletzung zuhause war und der Steffl-Watschi in sein Elternhaus gelaufen kam und weinend von weitem schrie: „Für mich scheint keine Sonne mehr, mein Leben hat keinen Sinn mehr.“
Dabei schnäuzte er sich ins Schnaiztiachl (Taschentuch). Unter ständigem Schluchzen begann er vom schrecklichen Unglück in seinem Haus zu erzählen.
Wie schon oft zuvor waren Walzler (Arbeitssuchende) ins Dorf gekommen und hatten sich beim Bürgermeister Viktor Ertl gemeldet, um Arbeit gefragt, und wurden anschließend von Viktor Ertl in abwechselnde Häuser zugewiesen, wo sie Quartier und Verpflegung bekamen. Über die von ihm zugewiesenen Häuser hatte Viktor Ertl genau Buch geführt.
Als nun zwei Walzler mit ihren Buckelkörben voller Werkzeug in das zugewiesene Haus des Steffl- Watschi kamen und zuerst um Arbeit fragten und ihnen der Steffl-Watschi erklärte, es gäbe nichts zum Tun, anschließend um Essen gebettelt hatten und ihnen der Steffl-Watschi erklärte, er könne ihnen nichts geben, er habe selber nichts, waren sie trotzdem hartnäckig geblieben und gingen nicht weg. Der Steffl-Watschi wurde zornig und vertrieb sie fluchend mit der Heugabel. Kurze Zeit später, als der Steffl-Watschi und alle Hausbewohner auf dem Feld bei der Arbeit waren, ging der Heustadel in Flammen auf, wo die zwei kleinen eingesperrten zwei- und vierjährigen Mädchen, nachdem ihnen seine Frau Mohnhäuptel gekocht und den Saft zu trinken gegeben hatte, schliefen. Sie erstickten im Rauch. Dieses Unglück sorgte im Dorf für Entsetzen und Trauer.
Gleich danach, als der Steffl-Watschi am selben Abend in die Küche der Familie Ertl eingetreten war und vom tragischen Vorfall erzählt hatte, war, wie zur Bekräftigung seiner Worte, durch die wahnenden (zugigen) Fenster der Wind so heftig hineingefahren, dass der Docht des Petroleumlämpchens wie ein schlechtes Omen erlosch und es stockdunkel wurde. Unter Tränen fragte er Toni, ob er beim Begräbnis als Sargträger fungieren würde. Und Karls Eltern Viktor und Anna Ertl fragte er, ob sie bei den Vorbereitungen für das Begräbnis und dem Tour (Totenmahl) helfen würden.
Wie es der Brauch verlangte, wurde das vordere große Zimmer außer den Kleiderschränken im Haus vom Steffl-Watschi für die Aufbahrung der zwei kleinen Mädchen ausgeräumt. Die Fenster und Spiegel verhängt und verdunkelt, von der Kirche Heiligenbilder, das große Kreuz an der Stirnseite der Särge aufgestellt, wo die toten Mädchen in weißen Kleidern mit Rosenkränzen in Händen in Weihrauchdämpfen aufgebahrt lagen, daneben ein Weihwasserkessel mit einem Buxbaumbüscherl zum Ohtacken (Kreuzzeichen geben) aufgestellt.
Trotzdem die Familie der Verstorbenen drohte, unter diesem Unglück zusammenzubrechen, mussten brauchhalber am nächsten Morgen die Hennen und ein Schwein für den Tour (Totenmahl) für die engsten Verwandten aus den umliegenden Dörfern abgestochen, Suppennudel zubereitet, Fosn (Strudel) gefüllt mit Ziweben (Rosinen), Bagl (Guglhupf) und Brot gebacken und der Wein geholt werden.
Am Abend kamen die Leute, wünschten Beileid (kondolierten) und anschließend wurde gewachtet (gebetet und gesungen), Brot und Wein gereicht. Die engsten Verwandten hielten die ganze Nacht Wache und hielten sich mit Schnaps wach, während die Hausleute schlafen gingen.
Sobald die Särge aus dem Haus waren, musste das vordere Zimmer für den Tour (Totenmahl ausgeräumt und mit Tischen und Bänken eingerichtet werden für die engsten verwandten Trauergäste, sowie Lehrer, Pfarrer, Ministranten und Mesner.
Schon morgens halfen Viktor und Anna Ertl. Es wurde Hühnersuppe, gekochtes Hendlfleisch mit Semmelkren, Rote Rounen (Rüben), Schweinsbraten, Geselchtes mit Kartoffelsalat, Strudel und Wein beim Totenmahl aufgetragen.
Am Tag des Begräbnisses gingen Toni und andere Burschen mit Rosmarinsträußerln am Revers, symbolisch mit Mädchen in weißen, langen Kleidern, einem Kranzerl im Haar als Kränzlerinnenpaare eingehängt, so als würden sie die entgangene Hochzeit der verstorbenen Mädchen feiern, hinter dem Pfarrer und Ministranten und folgten dem Sarg.
Beim anschließenden Totenmahl wurden alle Trauergäste immer aufgefordert zu essen und zu trinken, denn dies wäre die Hochzeit der verstorbenen Mädchen. Toni brachte keinen Bissen hinunter und so war dieses tragische Erlebnis für Toni ein Grund mehr dafür gewesen, der Armut zu entfliehen, seinen Eltern nicht mehr zur Last zu fallen, Arbeit zu suchen, um ein besseres Leben zu führen.
Nach dem Begräbnis erklärte er, er wolle kein Unterhaspel mehr sein, es wären noch genug hungrige Mäuler im Haus zu stopfen, er wolle künftig sein Brot selber verdienen und ein besseres Leben haben, er würde nach Deutschland arbeiten gehen.
Nachdem der Heustadel des Steffl-Watschi samt Heu und Stroh niedergebrannt war, das Vieh sich teilweise losgerissen hatte und verschwunden, praktisch die Lebensexistenz in Flammen unterging, spendeten die Dorfleute Stroh und Heu und fortan ging der Steffl-Watschi mit einem von Viktor Ertl als Bürgermeister ausgestelltem Brandbrief von Dorf zu Dorf, um für einen Neubau zu sammeln.
Im selben Moment erinnerte sich Karl an den 11. 3. 1938, wo um 19.50 Uhr Bundeskanzler Kurt Schuschnigg im Radio bekannt gab, dass die Regierung „vor der Gewalt weiche“, er „kein deutsches Blut vergießen wolle“, und mit den Worten „Gott schütze Österreich“ schloss.
Wie Toni sich freute, als am 12. März 1938 deutsche Truppen, unter Jubel und ohne militärischen Widerstand, in Österreich einmarschierten. Im Gegensatz zu Toni war Karl von Anfang an kein glühender Verehrer Hitlers, denn Toni gehörte bereits seit 1937 mit einigen Freunden zur illegalen Hitlerjugend und bezahlte monatlich 50 Groschen Mitgliedsbeitrag.
Dass Deutschland wegen der massiven Aufrüstung hoch verschuldet war und die österreichischen Gold- und Devisenreserven gut gebrauchen konnte, Österreich wegen seiner geographischen Lage und wegen seiner reichhaltigen Rohstoffe wie Eisenerz, Magnesit, Grafit, Wasserkraft und Erdöl für die deutsche Industrie wichtig war, wussten die Dorfbewohner nicht. Außerdem waren Millionen Österreicher für das Deutsche Reich als Soldaten und Arbeitskräfte von großer Bedeutung.
Allerdings gab es im Dorf beim Einmarsch Hitlers nicht nur jubelnde Befürworter, sondern viele hielten, genauso wie Viktor und Anna Ertl, ihre Meinung zurück.
Es gab hinter vorgehaltener Hand und hinter verschlossenen Türen Diskussionen, wie es ihnen unter den Deutschen ergehen würde. Öffentlich traute sich niemand seine Meinung sagen.
Karl erinnerte sich, wie sich ihr Dorf verändert hatte. Wie von einer unsichtbaren bedrohlichen Welle überrollt, war ihr Dorf ahnungslos, wie aus einem tiefen Winterschlaf, aus ihrer einfachen Welt gerissen worden. Die Bauern im Dorf waren Selbstversorger, es waren ein Schneider-, Schuster-, Schlosser- und Schmiedemeister und eine angelernte Geburtenhelferin ansässig. Viele der Bauern waren der Meinung, dass ihnen unter den Deutschen nichts passieren könne, da sie als Bauern Selbstversorger wären und Grund und Boden hätten. Sie kamen oft lange nicht aus dem Dorf hinaus.
Alle Dorfbewohner lebten seit Generationen bisher friedlich nach dem Wort Gottes, dem Kalender der kirchlichen Feiertage und nach den alteingesessenen Sitten und Gebräuchen.
Nun war eine höhere Macht eingetreten und hatte die alten Werte und Vorstellungen in den Hintergrund gestellt.
Für Viktor Ertl und viele andere im öffentlichen Dienst stehende Personen veränderte sich die Zeit maßgeblich, denn Viktor Ertl wurde unfreiwillig seines Bürgermeisteramtes enthoben.
Denn wie andere politisch „Unzuverlässige“, Gegner und Widerstandskämpfer des neuen Regimes, hohe Beamte, Bürgermeister, Bezirkshauptleute, Polizisten und Gendarmen sowie abtrünnige Nationalsozialisten, welche sogleich nach dem Einmarsch Hitlers am 12. 3. 1938 entweder verhaftet, versetzt, ihres Dienstes enthoben oder in das Konzentrationslager Dachau deportiert wurden, war auch Viktor Ertl als Bürgermeister seines Amtes enthoben worden. Die freigewordenen Stellen in den Bereichen Verwaltung, Bildung, Schulwesen, Wirtschaft, bäuerliche Organisationen, Exekutive, Justiz und Zeitungswesen wurden mit „zuverlässigen“ Nationalsozialisten besetzt.
Gleich darauf hatte ein neuer, politisch zuverlässiger Bürgermeister, welcher vom Kreisleiter ernannt wurde, die Geschäfte von Viktor Ertl übernommen. Und als Viktor Ertl den Schlüssel des Gemeindeamtes übergeben musste, unterdrückte er die aufsteigenden Tränen. Womit hatte er diese Ungerechtigkeit verdient und seine Abberufung verursacht? Er hatte seine Amtsgeschäfte immer zur Zufriedenheit aller geregelt und immer versucht, eine für alle akzeptable Lösung zu finden, wodurch er allseits beliebt war. Wie oft wurde er mit Naturalien hierfür belohnt. Nach dem Vorschlag des neuen NS-Bürgermeisters wurden die Gemeinderäte bestimmt. Fortan übernahmen die Spitzenfunktionäre der NSDAP, der Ortsparteiobmann, NS-Bürgermeister und der Ortsbauernführer die Macht im Dorf. Zusammen mit dem Ortsgruppenleiter, welcher für mehrere Gemeinden zuständig war, sorgten sie als verlängerter Arm des NS-Regimes fortan für parteifreundliches Verhalten im Dorf.
Heimlich, im Schutz der Dunkelheit, kamen, trotzdem inzwischen ein neuer, politisch zuverlässiger Bürgermeister bestellt wurde, nach wie vor die Dorfleute vertrauensvoll und gewohnheitsmäßig mit ihren Sorgen und Problemen zu Viktor Ertl.
Gleich darauf ersetzten die „zuverlässigen“ Nationalsozialisten im Gemeindeamt das Kreuz mit dem Bild von Adolf Hitler und in den nächsten Tagen überwachte die Partei die Telefongespräche.
Das Amtsschild wurde mit dem Hakenkreuz, welches als Symbol der NS-Herrschaft und Hoheitszeichen des Deutschen Reiches nach 1938 u. a. auf Amtsschildern, Fahnen, Lampions, Schuhanziehern, ja sogar als Glimmer für Weihnachtsbaumspitzen allgegenwärtig war, ausgestattet.
Als der Dorfschullehrer Lorenz Schmid, ein Gegner des NS-Systems, der vorher nächtelange Diskussionen mit Gleichgesinnten zwecks Errichtung einer Gegenbewegung in seiner Wohnung führte, gegen einen „politisch zuverlässigen“ Lehrer ausgetauscht wurde, schien es ihm, als würde ihm der Boden unter den Füßen weggezogen werden. Seine Lebensexistenz war dahin, was nützte ihm seine Ausbildung, wenn er seinen geliebten Beruf nicht ausüben konnte, womit sollte er zukünftig Geld verdienen? Vorerst musste er sich bei den Bauern verdingen.
Karls jüngerer Bruder, Josef, den alle Zwumpl nannten, weil er so klein war, fühlte sich schuldig, den Lehrer vertrieben zu haben. Er war ein aufgeweckter, fröhlicher Junge, dem der Schalk ständig im Nacken saß. Denn Zwumpl hatte den Herrn Lehrer Lorenz Schmid einen Tag vor seinem Austausch dadurch geärgert, dass er mit einem Stecken den Herrgott am Kreuz mit Speck fütterte und daraufhin hatte der Herr Lehrer wütend und händeringend die Klasse verlassen, um sich zu beruhigen.
Und als der neu eingesetzte, zuverlässige Herr Lehrer in Uniform in die Klasse trat, mit erhobenen rechten Arm „Heil Hitler“ bellte, die Schüler den Gruß erwiderten, glaubte Zwumpl zerknirscht, dass Lorenz Schmid wegen des Ärgernisses mit ihm weggegangen wäre.
Als dann sogleich der neue Herr Lehrer das Kreuz in der Klasse durch Fahnen, Hakenkreuze und Hitlerbilder ersetzte, dachte Zwumpl, dass er das Kreuz nur deswegen weggäbe, damit er den Herrgott am Kreuz nicht mehr ärgern und füttern könne.
Karl Ertl dachte lächelnd an jenen darauffolgenden Sonntag nach dem Einmarsch der deutschen Truppen, als er mit seinen Eltern, Toni und seinen Geschwistern und anderen Dorfbewohnern, wie sonst auch jeden Sonntag, zur heiligen Messe in einem Fußmarsch von einer Stunde über den Wald zur Wallfahrtskirche ging.
Wie meistens während des langen Fußmarsches hatten sein Vater und seine Mutter infolge des schönen Wetters und aus Sparsamkeit ihre Schuhe auf dem Weg in der Hand getragen und waren bloßfüßig (barfuß) gegangen. Unterwegs sagten sie etwaigen Personen, denen sie begegneten entschuldigend, dass sie die Schuhe drücken würden. Kurz vor der Wallfahrtskirche vor dem Dritteläuten (Zusammenläuten) wischten sie ihre Füße mit einem mitgebrachten Fetzerl ab und zogen die Schuhe an.
Karl hatte seine Haare mit Brillantine eingeschmiert, um Martha zu gefallen. Karl und Zwumpl und die Buben hatten ihre neuen Anzüge und Schuhe an. Sie gingen hinter ihren Eltern, sodass diese nicht sehen konnten, dass sie bald mit den heruntergefallenen Eicheln gazten (schossen). Bald fingen Karl und Zwumpl mit den anderen zu streiten und zu raufen an. In ihren Taschen hatten sie von zuhause Eier, manchmal auch Plutscheier (faule Eier) eingesteckt, damit sie sich nach der heiligen Messe für den Heimweg am Zuckerlstand Süßigkeiten kaufen konnten. Einige Buben hatten noch das Schwerferlgeld (Trinkgeld) vom Viehhändler eingesteckt, welches die Kinder beim Viehverkauf bekamen, sodass sie sich damit etwas kaufen konnten. Die Buben freuten sich jedes Mal auf die Süßigkeiten.
Aber durch die Rauferei gingen die Eier von Karl und Zwumpl kaputt und das Gewand wurde durchnässt und schmutzig, sodass sie nicht nur wegen der sinnlosen Abnützung ihrer neuen Schuhe, sondern auch wegen der Verschwendung der Eier und wegen ihres schmutzigen Gewandes Schimpfer bekamen.
Nicht alle im Dorf wussten, dass Hitlers Truppen schon in ihrer Gegend waren.
Als die Familie Ertl vor der Wallfahrtskirche angekommen war, waren schon viele Leute, auch Martha mit ihren Eltern, dort versammelt. Und als Martha und ihre Eltern von Stefan Resner, dem Schwager von Viktor Ertl, welcher ein glühender Verehrer Hitlers war, und anderen Messebesuchern mit „Heil Hitler“ begrüßt wurden, glaubten sie, es wäre ein Scherz. Bisher grüßten die Katholiken sich untereinander immer mit „Grüß Gott“.
Erst als Stefan Resner ihnen glaubhaft versicherte, dass Hitlers Truppen hier in der Gegend waren, glaubten sie es.
Der Geid, Marthas Vater, war rot geworden vor Scham über seine Unkenntnis. Um seine Verlegenheit und Wut, vor allen blamiert worden zu sein, zu überspielen, räusperte er, sich spuckte seinen Motschka (Kautabak) aus und machte im nächsten Moment einen Bauernschnäuz. Dann spiazelte (spuckte) er nieder.
Plötzlich hatte Karl einen Stich im Herzen verspürt und kam in die Gegenwart zurück. Ihm wurde bewusst, dass er nun jederzeit Martha begegnen konnte. Mit einem Schlag wusste er, dass er der Realität mit Martha nicht mehr ausweichen konnte. Wie sollte er ihr entgegentreten?
Würde er hier in der Heimat rückfällig und schwach werden und so wie seine Vorfahren seit Generationen sich den Sitten und Gebräuchen unterwerfen, seinem Eheversprechen um des Friedens willen zustimmen. Warum war Irene immer präsent an allen Orten, wo er sich befand? Warum gelang es ihm nicht, sie zu vergessen? Würde er in Gedanken immer nur Irene lieben und stellvertretend Marthas Körper als seine Ehefrau verwenden?
Im gleichen Moment wurde er wehmütig. Er schaute aus dem Fenster des Weinkellers und betrachtete die hügeligen Weingärten, die Wiesen, Felder und Wälder, welche seit Generationen von denselben Familien nachhaltig, unter äußerster Schonung des Bodens, biologisch gedüngt mit dem Stallmist der Hühner, Kühe und Schweine, bearbeitet wurden.
In Gedanken versunken kroch in Karl plötzlich die Angst wie eine Schreckgespenst hoch, wenn er sich vorstellte, die Rote Armee würde hier bald in diesen idyllischen Ort gewaltsam eindringen, sich für den erlittenen Horror in ihrer Heimat entschädigen und rächen, in den fruchtbaren Boden mit den feindlichen Geschoßen tiefe Krater schießen oder durch Bombenkrater die Bewirtschaftung der Felder erschweren und den Ertrag ihrer Felder schmälern. Ein kalter Schauer lief über seinen Rücken, wenn er daran dachte, der Feind könnte, bestärkt durch seine Macht und Siegessicherheit, nach altem überlieferten Kriegsrecht überzeugt, der besiegte Feind sei sowohl mit seiner Person, seiner Familie und seinem Besitz seine hart erkämpfte und verdiente Kriegsbeute, hier alles seit Generationen hart aufgebaute Vermögen, welches wie ein Wunder bisher von Bomben verschont geblieben war, plündern und brandschatzen, morden, Frauen und Mädchen vergewaltigen, die Bewohner unterdrücken, drangsalieren, entrechten und alles Vermögen in Rauch aufgehen lassen und in Schutt und Asche versenken.
Karls Gedanken schweiften zurück zu Toni. Wo bekämpfte er gerade den Feind? Sehnte er sich nach zuhause und nach ihm?
Jenes tragische Ereignis im Dorf, wo Toni als Sargträger fungierte und ihm die Armut der Menschen und das traurige Schicksal der arbeitslosen Walzler in aller Härte aufzeigte, hatte ihn zusätzlich davon überzeugt, der Not und Armut in seiner Heimat zu entkommen und nach Deutschland arbeiten zu gehen, um eigenes Geld zu verdienen und auf eigenen Beinen zu stehen, um ein besseres Leben führen zu können.
Er wollte in Deutschland beim Autobahnbau arbeiten. Das NS-Regime förderte in Deutschland öffentliche Arbeiten wie Straßen-, Autobahnbau, Kasernenbau, Flugplatzanlagen, wobei wichtig war, dass in erster Linie Menschenkraft eingesetzt wurde, damit Menschen Geld verdienen, die Kaufkraft steigen und die Industrie angekurbelt werden sollte.
Toni Ertl wurde mit Stefan Resner und seinen Freunden wie viele burgenländische Bau- und Landarbeiter aus kinderreichen Familien über das Arbeitsamt oder NS-Kanäle als „Gastarbeiter“ nach Deutschland vermittelt, wo sie die großen Aufbauleistungen des NS-Regimes kennenlernten und vorgeführt bekamen. Sie wurden dort beim Autobahnbau und in der Rüstungsindustrie benötigt. Sie schwärmten von den Fortschritten – wie bei vielen seiner Freunde war auch in ihm der Traum vom eigenen Volkswagen geweckt worden – und waren nach ihrer Heimkehr die besten Befürworter Hitlers.
Und als Toni Ertl mit Stefan Resner und seinen Freunden vor der für den 10. 4. 1938 von Hitler beschlossenen Volksabstimmung, welche die Verschmelzung der Nationen und des Nationalsozialismus vollziehen sollte, zurückkam, war ein anderer Toni heimgekehrt, gereift, entschlossen, die große Armut in seiner Heimat zu lindern und die Ziele seines Führers zu unterstützen und zu erreichen. Toni, Stefan Resner und seine heimgekehrten, halb erwachsenen, fast wehrpflichtigen Kameraden versuchten ihre Eltern und alle Verwandten und Bekannten zu überreden, für den Anschluss Österreichs an Deutschland zu stimmen, in der Überzeugung, ein besseres Leben zu erwirken, nicht wissend, was ihnen bevorstand.
Toni bedauerte nur, dass er zu wenig Geld verdient hatte, um sich einen Volkswagen zu kaufen. Wie gerne hätte sich Toni einen Volkswagen gekauft und wäre wie zum Beweis des Wohlstands in Deutschland unter Adolf Hitler damit stolz heimgefahren, um den Dorfleuten zuhause vor Augen zu führen, wie gut es den Deutschen geht.
Stefan Resner, Toni Ertl und seine Freunde organisierten für die NSDAP Parteikundgebungen sowohl in deutscher, ungarischer als auch in kroatischer Sprache in jenen Orten, wo sich anderssprachige Bevölkerungsschichten befanden. Die Post und die Schüler, auch Zwumpl, brachten riesige Mengen Propagandamaterial als Wahlwerbung ins Haus. Ein Radio kam kostenlos in das Gasthaus, damit die Propagandareden des Führers gehört werden konnten.
Als Redner bei den Parteikundgebungen wurden die neuen NS-Machthaber, Stefan Resner und Toni Ertl, nicht müde, für den Anschluss zu werben. Stefan Resner betonte: „Bei uns wird es ohne Hitler keinen Aufschwung, keinen Fortschritt, keine Arbeitsplätze geben, ohne ihn werden wir immer arm bleiben. Österreich kann alleine nicht bestehen und ist nicht lebensfähig.“ Er sprach sowohl von den Segnungen der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt (NSV), welche die Ämter Organisation, Finanzverwaltung, Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe, Volksgesundheit, Propaganda und Schulung bekleidete, vor allem im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit tätig war, bedürftige Familien unterstützte und Kindergärten betrieb als auch von der NS-Frauenschaft (NSF), welche wirtschaftliche und krankenpflegerische Tätigkeiten ausübte.
Quasi als lebenden Beweis rief Stefan Resner Toni Ertl, der den Fortschritt in Deutschland persönlich genauso wie er wahrgenommen hatte, an das Rednerpult. Toni las die selbst geschriebene Rede von der Innenseite seines Kappls ab und erklärte, dass er in Deutschland gearbeitet hatte und den Fortschritt gesehen hatte. „Ich habe die großen Aufbauleistungen und wie gut es in Deutschland wirtschaftlich steht, mit eigenen Augen gesehen. Der Führer ist bestrebt, dass jeder Deutsche einen Volkswagen haben soll.“ Im nächsten Moment sprach er von der politischen Organisation KdF (Kraft durch Freude), welche Reiseveranstaltungen, Wandern, Seereisen, Bunte Abende, Gymnastik-, Schwimm- und Nähkurse, Konzerte, Erwachsenenbildung etc. für die Bevölkerung veranstaltete. Dass damit gleichzeitig ein körperlich gesundes, kriegstüchtiges Volk gemacht werden sollte, konnte er nicht wissen. Dann hämmerte er seinen Zuhörern ein, dass die Juden allein an der wirtschaftlichen Not, an allem Elend und aller Verzweiflung der Jahrzehnte vorher schuld seien.
Mit erhobener Stimme rief Toni, dass nur Hitler den Wirtschaftsaufschwung in Deutschland gebracht habe, dass auch hier ein Hitler gebraucht werden würde, um denselben Aufschwung zu ermöglichen, um der Armut ein Ende zu bereiten. Dies würde nur mit Hitler gelingen. Ohne Hitler würden die Errungenschaften der neuen Zeit niemals hier eintreten.
Gewöhnlich schloss er die Rede mit den drohenden Worten, dass alle Skeptiker durch ihr Nein den Aufschwung verhindern würden und dies vor ihren Kindern zu verantworten hätten.
Abends berieten sich die Eheleute Ertl im Ehebett flüsternd hinter verdunkelten Fensterbalken wie sie abstimmen sollten und wie immer lauerte Zwumpl, um etwas zu erhaschen und seinen Brüdern brühwarm weiterzuerzählen.
Im Elternhaus von Karl gab es auf der vorderen Seite des Hauses das Schlafzimmer, sodass darin die Kinder und die Eltern auf Strohsäcken schliefen, darunter auch Zwumpl. Im Ehebett schlief auch ein Kind, in der danebenstehenden Wiege lag das kleinste Kind, welches durch die Sprießel (Gitterstäbe) schaute. Jeden Abend hutschelte (schaukelte) Viktor Ertl das kleinste Kind ein.
Aus der Not geboren, gfretteten sich (improvisierten) die Leute in vielen Dingen. In der Wäschetruhe mit den vier Läden schliefen in jeder Lade, eingewickelt in selbst genähte Windel, ein Kind. Hatte sich das oberste Kind nass gemacht, wurden die darunter liegenden Kinder auch nass. Zwumpl lag mit drei anderen Kindern in einem Bett, wobei die Füße zweier Kinder in der Mitte des Bettes zusammenstanden. Wie immer stellte sich Zwumpl schlafend, um das Getuschel seiner Eltern zuerst neugierig zu belauschen und anschließend das seltsame Gerangel im quietschenden Bett zu verfolgen.
Für Viktor und Anna Ertl hatte sich die neue Zeit wie ein Felsblock auf ihre Herzen gelegt. Was würde ihnen unter den Deutschen blühen?
Stillschweigend und gottergeben hatten die Eheleute Ertl, wie so viele anderen Dorfbewohner – jene die ihre Arbeit verloren hatten – festgestellt, wie sehr sich die Menschen und das Dorfleben verändert hatten.
Dort, wo früher alles Geschehen, jede Neuigkeit öffentlich diskutiert wurde, sowohl im Elternhaus von Karl als auch auf der Gasse, verstummte jetzt jede flüsternd geführte Diskussion, als ob sich hinter jeder Ecke Spitzel und Denunzianten befänden. Denunzianten, welchen die Bürgerpflicht eingetrichtert wurde, jede kritische Aussage gegen Hitler und das NS-Regime anzuzeigen, hatten ihre Augen und Ohren überall. Sogar auf den Streichholzschachteln stand „Feind hört mit“. Ständig fühlten sich die Leute beobachtet und belauscht. Misstrauen und Missgunst verbreiteten sich wie eine bösartige Krake.
Geheimnisvoll wurden zwischen den Bauern im Dorf heiße Diskussionen geführt, ob man bei der Volksabstimmung am 10. April 1938 für den Anschluss sein sollte. Sobald ein Dritter dazukam, verstummte der Dischgur, genauso, als säßen die Spitzel im Schatten. Nur wenn im Elternhaus von Karl das Radio spielte oder die Kinder laut waren oder die grünen Holunderblätter mit ihrem Mund bespielten, oder mit der Maulwetz (Mundharmonika) spielten, traute man sich tagsüber leise sprechen.
Während dieser Zeit der lähmenden Angst, Einschüchterungen, Unterwerfung, des bedingungslosen Gehorsams, traute sich keiner öffentlich seine Meinung sagen, sondern nur hinter vorgehaltener Hand immer beobachtend, ob keine Zeugen anwesend waren.
Geschürt durch Misstrauen, Not und Neid wurden aus den besten Nachbarn Feinde. Vorherige Freunde, Verwandte, beste Nachbarn waren jetzt gespalten, bespitzelten und denunzierten sich als Feinde, viele in der Hoffnung, im neuen System Karriere zu machen und Macht über andere zu haben.
Einige der Befürworter des neuen Systems lauerten im Hintergrund und verschwiegen vorerst vorsichtshalber ihre Sympathien für die neue Partei, wollten die Volksabstimmung abwarten, sich quasi ihre Gesinnung bestätigen lassen, um sich dann zu den Siegern zu zählen.
Und so berieten sich die Eheleute Ertl im Ehebett flüsternd hinter verdunkelten Fensterbalken an jenem Abend, wie sie abstimmen sollten.
Sie besprachen, wie die ihnen gut bekannten und geschätzten Herren Lehrer, Bezirkshauptmann, welche fähige Leute waren und sich verdient gemacht hatten für die Heimat, ebenso wie Viktor Ertl selbst als Bürgermeister, abgesetzt worden waren. Der Jude Isidor Holz, Inhaber der Greißlerei im Dorf, war vertrieben worden, andere Gegner des neuen Regimes hatten erfahren müssen, wie hart gegen sie vorgegangen wurde.
Sie staunten, wie sich vorher unscheinbare Leute jetzt einschmeichelten und anbiederten, sich als Anhänger des neuen NS-Systems deklarierten und wie schnell Emporkömmlinge, Bücklinge, Wendehälse nun an die Macht drängten. Eben viele Leute, welche durch die Weltwirtschaftskrise arm und arbeitslos waren und jetzt wie Ertrinkende nach einem Strohhalm griffen und sich der Partei anschlossen.
Viktor Ertl fehlte seine Arbeit als Bürgermeister und der Umgang mit der Dorfbevölkerung. Er hatte gut mit den abgesetzten Personen zusammengearbeitet und nun wusste er nicht, was aus ihnen geworden war.
Wie gerne dachten die Ertls an dieses vormalige friedliche Zusammenleben im Dorf zurück.
Sie erinnerten sich, wie unbelastet sie vorher lebten und wie vertrauensvoll sich die Dorfbewohner untereinander in allen Dingen des Lebens anvertrauen konnten, einander selbstlos halfen, wenn Not am Mann war. Wie oft hatte Viktor Ertl unter seinem persönlichen Einsatz ehemalige Kontrahenten in seinen Bergkeller geladen und beim Uhudler-Wein zu vermitteln versucht. Unzählige Ungereimtheiten hatte Viktor Ertl als Bürgermeister oft mit viel Bauernschläue, ohne amtliche Wege begehen zu müssen, regeln können. Wenn sich eine Partei in die Gemeindestube beklagen kam, schickte er den Kloarichter (Gemeindediener) nach der anderen Partei, um dann in Ehe- oder Ehrenbeleidigungssachen, Grenzstreitigkeiten etc. zu vermitteln. Öfters zahlte der schuldige Teil die kleine Gebühr des anderen für die Amtshandlung mit, damit die Streitigkeiten beendet waren. Von jeher war das Bürgermeisteramt für Viktor Ertl eine Anlaufstelle, er hatte Autorität, sein Wort war Gesetz im Dorf. Die Dorfbewohner hatten Vertrauen zu ihm, er kannte alle Geheimnisse der Dorfbewohner, ohne diese anvertrauten Geheimnisse zu verraten oder zu missbrauchen.
Und jetzt wurde er von allem ausgeschaltet und musste hilflos zusehen, wie sich die neue, angsteinflößende Zeit stillschweigend, rücksichtslos ihren Weg bahnte und wie ein bösartiges Krebsgeschwür alle Institutionen und Lebensbereiche stillschweigend unterwanderte.
Dass er nun seines Bürgermeisteramtes, aus seiner Sicht schuldlos, enthoben wurde und die Anliegen der schutzbefohlenen Dorfbewohner nicht mehr vertreten konnte, kränkte ihn. Viktor Ertl freute es aber, wenn er unter der größten Geheimhaltung noch von vielen Dorfbewohnern als heimliche Anlaufstelle für ihre Probleme angesprochen wurde. Jeder wusste, dass er ein korrekter, verlässlicher Mann war, der nicht aus eigener Schuld sein Bürgermeisteramt losgeworden war. Sympathisanten des neuen Systems betrachteten dies missgünstig.
Auch fehlte ihm der Kontakt mit dem Lehrer Lorenz Schmid. Wenn er daran dachte, wie viele schöne Stunden er mit dem Lehrer sowohl in seinem Bergkeller als auch bei den Tour (Totenmahl), Hochzeiten, Taufen verbracht hatte und wie gute Freunde sie geworden waren, wurde er traurig.
Dazu kam, dass ihm seine wichtigste Einkommensquelle beim Juden Isidor Holz, Inhaber einer Greißlerei und eines Gasthauses, für den Viktor Ertl im Winter mit dem Schlitten, im Sommer mit dem Pferdegespann allerlei Fuhrwerksdienste gegen Entgelt geleistet hatte, durch das neue NS- Regime entzogen wurde. Auch einen Teil seines Weines hatte Viktor Ertl Isidor Holz zwecks Weiterverkauf verkauft.
Nachdem die nationalsozialistische Rassenpolitik die Menschen in „wertvolle“ und „minderwertige“ Rassen kategorisierte, die „nordische Rasse“ (Arier) zu „Herrenmenschen“ idealisierte, die Juden, Zigeuner, Menschen slawischer, afrikanischer und asiatischer Abstammung zu „Untermenschen“ deklassierte, jede Höflichkeit gegenüber Juden untersagte und der geschäftliche Umgang mit Juden bereits seit März 1938 verboten wurde, traute sich niemand mehr, das Geschäft des Juden zu betreten.
Viktor Ertl konnte nicht verstehen, warum alle nun den bisher unbescholtenen Juden meiden sollten. In seine Greißlerei kamen die Bauern und tauschten ihre Eier, getrocknete, geschälte Kürbiskerne, Schwammerl gegen Zucker, Salz, Malzkaffee, Soda, Petroleum, Zünder, Waschpulver, Salzleckstein, Laugenstein, Löschkalk, Blaustein, Feuerzeugbenzin zum Einfüllen in das Feuerzeug, Germ und Gewürze ein.
Er wurde von allen Dorfbewohnern immer als fleißiger, verlässlicher, gesetzestreuer Mann geschätzt.
Wie gerne kamen die Männer im Dorf abends zu ihm in die Schankstube, um mit ihm oder anderen Gästen zu trinken, Karten zu spielen und viele sahen dort ihre ersten Kondome. Sein legendärer, Generationen überdauernder Ausspruch war, wenn er am Fenster zur Straße stand: „Die Leute arbeiten immer, wann machen die ihr Geld?“ Allerdings ärgerten sich Ehefrauen oft über ihn, da er ihren betrunkenen Männern, obwohl sie kein Geld hatten, viele Zechen und Einkaufsschulden stundete und aufschrieb, Geld verlieh, Dollars von Familienangehörigen aus Amerika oft anstatt zum Zweck finanzieller Familienaufbesserung zweckentfremdend für Zechen annahm, Schuldscheine ausstellte und etliche Wälder und Liegenschaften zum Verdruss der Familienangehörigen in seinen Besitz brachte.
Isidor Holz war ein gewiefter Geschäftsmann, der zweimal wöchentlich in einem halbtägigem Fußmarsch mit seinem umgehängten Rucksack Tabakwaren von der nächsten Stadt holte.
Er war ein sehr sparsamer Mensch. Denn jedes Mal, wenn er das Stamperl Schnaps zu voll einschenkte, trank er herunter. Wenn die Gäste fortgingen und noch Reste in ihren Gläsern hatten, schüttete er die Norgl (Reste) zusammen und verkaufte sie wieder. Wenn er früher als sonst, vor dem Mitternachtsgang des Nachtwächters, oder wenn die Jäger von der Jagd spät heimkamen, schlafen ging, stellte er das Bier vor die Tür, um keinen Geschäftsentgang zu haben. Ebenso nahmen sich die Bauern beim Vorbeigehen morgens um 4.00 Uhr früh, wenn sie mit ihren Sensen, den Wetzsteinen im Kumpf, die Wiesen mähen gingen, das bereitgestellte Bier mit. Und die Kunden bezahlten am nächsten Tag mit ihren von Verwandten aus Amerika geschickten Dollars, welche ihrer Familie zugutekommen sollten, und tranken noch einige Stamperl Rum und Schnaps.
Genauso schickte der Jude seinen Buben sofort los, um seine guten Stammkundschaften zu holen, wenn der Bäcker und Fleischhauer ihre Waren lieferten, damit sie kostenlos zum Trinken kamen, denn nach ein paar Deziliter Wein zahlten die Lieferanten die ganze Zeche.
Nachdem Viktor Ertl den kleinen Sohn von Isidor Holz nach einem Pferdebiss mit seinem Pferdewagen ins Krankenhaus brachte, war ihm der Jude ein Freund geworden.
Diese besondere Freundschaft entwickelte sich an jenem Unglückstag im Winter, als er den vor Schmerzen wimmernden kleinen Sohn des Juden nach einem Pferdebiss ins Gesicht im Hof liegen sah. Die Zähne des kleinen Jungen waren herausgefallen und überall war Blut im Schnee. Der Jude wusch das Blut ab, während die Mutter des Buben über ihn gebeugt nur schmerzlich stöhnte. Nachdem die unbefestigten Fahrwege durch viele Schlaglöcher von Autos nicht befahrbar waren, beförderte Viktor Ertl mit dem Pferdeschlitten den Verletzten zum nächsten Krankenhaus. Er hatte auf seinem Pferdeschlitten eine dicke Federntuchent für den Sohn untergelegt und eine Tuchent zum Zudecken gebracht, ebenso warme Ziegel zum Aufwärmen zwischen die Tuchenten gegeben. Dann fuhr er mit ihm in das 15 km entfernte Krankenhaus.
Wie oft befürchtete er, wenn es heil (glatt) war, einen Achsenbruch und oft musste er wegen der vielen Schlaglöcher absteigen, mit dem mitgebrachten Krampen die Löcher zuhacken, Reisig darüberlegen, um weiterfahren zu können.
Wenn der Jude in der weit entfernten Synagoge bei Versöhnungsabenden, wo viele Christen dabei waren, den Rabbiner, welcher ein guter Freund des katholischen Priesters war, beten und predigen hören wollte, bat er öfters Viktor Ertl, ihn hinzubringen. Dann spannte Viktor Ertl seine Pferde vor die Kutsche des Juden und saß stolz auf dem Kutschbock, während er seine Pferde dirigierte. Dort bewunderte Viktor Ertl die Kales (Kaleschen) und Pferde der anderen Juden. Wenn der Jude zu den Gebeten nicht kommen konnte, schickte er dem Rabbiner oft Suppenhühner und anderes Geflügel mit.
Wie oft hatte Holz mit seinen Verdiensten als Soldat im Ersten Weltkrieg geprahlt und wollte und konnte sich die Verfolgung der Juden zuerst nicht vorstellen. Als den Juden und Zigeunern das Stimmrecht laut Runderlass des Bundeskanzleramtes vom 16. 3. 1938 für die Volksabstimmung am 10. 4. 1938 entzogen wurde, nach dem Anschluss vielfach Bargeld, Möbel konfisziert, etliche Juden von der Gestapo verhaftet, Ausgangssperren verhängt wurden, und er weitere Verfolgungen fürchtete, zudem feststellte, dass sich keine Kundschaft mehr in sein Geschäft traute, abends ein Stein durch sein Küchenfenster auf seinen Teller geworfen wurde, seine Hausmauer mit „Saujude verschwinde“ beschmiert wurde, war er, nachdem er seinen Sohn abends um die Adresse seiner entfernten Verwandten in Amerika schickte, aus dem Dorf verschwunden, was viele Schuldner im Dorf freute.
Bevor er ging, versteigerte er wie alle anderen Auswanderer im Dorf sein ganzes Inventar, jedes Backblech, jeden Kopfpolster, alles, was nicht niet- und nagelfest war, alles bewegliche und unbewegliche Inventar. Viktor Ertl ersteigerte beim Lizitieren eine Schnupftabakdose, welche er Toni schenkte. Beim Lizitieren stritten sich die Bieter, einer gab sogar einem anderen Bieter einen Stoß, sodass dieser in der Mistlache landete.
Als sich Isidor Holz Geld in seine Manteltasche einnähte und vom Gendarmen durch das Fenster dabei beobachtet wurde, musste er den Mantel da lassen.
Und so hatte Viktor Ertl seine wichtigste Einkommensquelle verloren.
Gleich nach dem Weggang des Juden gingen am selben Abend einige hocherfreute Schuldner und vormalige Eigentümer der Wälder, welche Isidor Holz billig in seinen Besitz gebracht hatte und ihm deshalb vorwarfen, er hätte sie im betrunkenen Zustand betrogen, zu hohe Zechen aufgeschrieben, noch eventuell vorrätige Waren, Gegenstände und Bargeld plündern. Aber einige suchten auch insgeheim nach ihren Schuldscheinen.
Anna Ertl fürchtete jede Neuerung. Ihr fiel es schwer, mit dem neuen NS-System ohne jede Kritik und mit dem bedingungslosen Gehorsam zu leben. Und so wurde Anna Ertl, welche ihr Herz immer auf der Zunge trug, oft von ihrem Mann ermahnt, ihre Zunge im Zaum zu halten und zu schweigen.
Sie konnte und wollte nicht dulden, dass sie als freie Bauern und Selbstversorger, welche von ihrem eigenen Grund und ihrer fleißigen Hände lebten, sich unterwerfen sollten. Gleichzeitig befand sie sich in einem Gewissenskonflikt. Dass sie nun einerseits den rechten Arm heben und die Worte „Heil Hitler“ anstatt „Grüß Gott“ als Begrüßung verwenden musste, sah sie als heidnisch an, als Gotteslästerung, als eine Sünde, die von Gott bestraft werden würde. Den Herrn Pfarrer begrüßte sie nach wie vor mit „Gelobt sei Jesus Christus“, er antwortete „Von nun an bis in Ewigkeit“ und sie erwiderte „Amen“.
Ebenso widerstrebte es ihr, dass sie als Eltern nun eine Erklärung unterschreiben mussten, dass ihre schulpflichtigen Kinder freiwillig zur Religionsstunde in die Sakristei der Kirche gehen mussten und nicht wie bisher in die Schule.
Als gläubige Christin sah sie es aber als ihre Pflicht, die Worte der katholischen Bischöfe, welche den Anschluss an Deutschland befürworteten – Evangelische tendierten nach Deutschland, um dem katholischen Österreich den Rücken zu kehren –, zu befolgen.
Als aber ihr geliebter Herr Pfarrer verhaftet wurde, war sie bis aufs Mark erschüttert darüber, dass ihr Pfarrer als ein Stellvertreter Gottes auf Erden, nach dessen Geboten und Verboten sie bisher gelebt und welche ihr gesamtes Leben bestimmt hatten, dessen irdische Macht für sie unantastbar war, wie ein Verbrecher abgeführt und durch eine andere Macht beherrscht und bezwungen wurde. Er hatte bisher allen Sündern die Ohrenbeichte abgenommen und ihnen Buße auferlegt, mit der ewigen Verdammnis im Fegefeuer und der Hölle gedroht. Er war bisher die Richtschnur für ihr Leben gewesen.
Wer hatte ihn angezeigt und warum? Wie oft hatte sie mit dem Herrn Hochwürden sowohl als Vorbeterin des Rosenkranzvereins als auch bei Taufen, Hochzeiten, Begräbnissen zu tun. Jeden Sonntagnachmittag, wenn sich die Männer zur Feuerwehrversammlung trafen, betete sie mit den Mitgliedern des Rosenkranzvereins, wobei Lorenz Schmid vor seinem unfreiwilligen Weggang immer orgelte. Auch ging sie immer zum Herrn Pfarrer, damit er die Briefe ihrer Schwester aus Amerika vorlas und sie beantwortete, so wie er auch sonstige Briefe für seine Schäfchen schrieb oder beantwortete.
Bei jedem Wutschi (Kirtag) lud sie den Pfarrer, nachdem er die von ihr bestellte Messe gelesen hatte, zum Mittagessen nach Hause ein. Wie oft lobte er sie wegen des guten Essens, wenn sie ihm Hendlsuppe mit selbst zubereiteten Suppennudeln, gekochtes Hendlfleisch mit Semmelkren, Backhendl mit Erdäpfelsalat u. a. kredenzte. Besonders wegen ihrer Hobelschoartn (süßer Germteig in Fett herausgebacken) und der Biachlkropfn oder Schmerkropfn (Butterkrapfen, Blätterteig), welche sie mit der Schmer (Bauchfett) des Schweines mit der größten Sorgfalt zubereitete, lobte er sie. Im Sommer musste sie den Blätterteig in den Brunnen, im Winter in den Schnee zum Kühlen geben, während des mehrmaligen Auswalkens und Klopfens.
Wenn er sie auch bei der nächsten Predigt von der Kanzel herunter tadelte, sie hätte die Suppe während des Tischgebetes serviert, so ärgerte sie das, aber bald vergaß sie es wieder.
Wie oft hatte sie ihm ein paar Münzen zugesteckt, damit er nach der heiligen Messe für sie und ihre Lieben betete. Die Frauen kontrollierten genau, wie viel Münzen die anderen gaben und erhöhten die Spende immer wieder.
Jeden Sonntag saß sie zusammen mit der Gvatterin (Goatl), der Mutter von Martha Janisch, in derselben Kirchenbank. Niemals hätte sich Anna Ertl in die erste Kirchenbank gesetzt. Böse Zungen behaupteten, in den ersten Kirchenbänken würden die alten Kommandore und Wirtschaftsräte (alte Frauen) sitzen, um sich den nächsten Tratsch zu holen. Die Goatl sagte immer, die Gebete kriechen in den Himmel, der Gesang fliegt in den Himmel. Bevor die heilige Messe anfing, flogen die Köpfe in der ersten Reihe neugierig hin und her und mokierten sich darüber, dass die jungen Frauen bloßkopfert (ohne Kopftuch) gingen, durchsichtige Strümpfe oder sündhafte, weit ausgeschnittene, enge Kleider anhatten und sogar weiße Kleider trugen, was für verheiratete Frauen unschicklich war, da sie nicht mehr unbefleckt wären. „Das ist kein Ghea’tsi (es gehört sich nicht), zu unserer Zeit hätte es so etwas nicht gegeben“, raunte die eine der anderen verächtlich zu. Oder sie musterten die Kinder, ob sie ihren Vätern oder anderen Männern ähnlich sahen.
Im Dorf wusste keiner, warum ihr Pfarrer weg und wohin er gekommen war. Hinter vorgehaltener Hand wurde gerätselt, ob er sich gegen den neuen Hitler-Gruß geäußert und immer mit Grüß Gott geantwortet hätte. Andere behaupteten, er hätte die Jugendlichen ermuntert, lieber in die Kirche anstatt zu den Parteikundgebungen zu gehen, gegen den Nationalsozialismus gewettert und die Beflaggungsvorschriften nicht eingehalten.
Anna Ertl war äußerst beunruhigt nicht zu wissen, weshalb und wohin der Herr Pfarrer gekommen war. Und sie wusste auch nicht, ob und wann er wiederkommen würde.
Ständig und unermüdlich redeten Toni, Zwumpl und auch Stefan Resner den Eheleuten Ertl zu, bei der Volksabstimmung mit „Ja“, für die Vereinigung zu stimmen, denn unter den Deutschen würde es ihnen gutgehen.
Toni bedrängte seine Eltern ständig, für den Anschluss zu stimmen. Er betonte ununterbrochen, dass sich seine Hoffnung auf mehr Arbeitsplätze und einen Wirtschaftsaufschwung nur mit Hitler erfüllen ließe, da es auch den Deutschen seit Adolf Hitler gutgehe.
Jedes Mal, wenn Toni Ertl seinem Vater zuredete, bei der Volksabstimmung mit „Ja“ zu stimmen, antwortete Viktor Ertl, dass er durch das neue NS-Regime sowohl sein Bürgermeisteramt als auch seine beste Einkommensquelle beim Juden verloren hätte. Und Toni Ertl antwortete jedes Mal, dass dies das kleinere Übel sei.
„Wenn ich genug Geld in Deutschland verdient habe, komme ich mit einem Volkswagen heim und werde euch ausführen“, prahlte er.
Seine Eltern zeigten sich davon unbeeindruckt. Toni wusste, dass er seiner Mutter mit einem Auto nicht imponieren konnte. Sie hätte es als Teufelswerk verdonnert. Ebenso schenkte sie dem Hokuspokus der Propaganda keinen Glauben.
In ihren Augen zählten nur die Arbeit und das, was sie fechsten (ernteten). Alle technischen Hilfsmittel verteufelte sie.
Wenn Stefan Resner die Eheleute Ertl bedrängte, Parteimitglied zu werden und für den Anschluss zu stimmen, verschwiegen sie vorsichtshalber ihre Gesinnung, um abzuwarten. Nie hätten sich die Eheleute Ertl getraut, gegenüber Stefan Resner sich ablehnend zu Hitlers NS-System zu zeigen, aus Angst vor den Folgen.
Ebenso lag Zwumpl seinen Eltern ständig in die Ohren. Zwumpl wurde durch den neuen NS-Lehrer ein neues Bewusstsein eingetrichtert, wie wichtig die Jugend wäre und wie wichtig es sei, große Taten zu vollbringen.
Wie gut er schon Marschieren gelernt hatte und wie viele neue Lehrmittel in die Schule gekommen waren, er konnte nur Vorteile für ihn sehen. Mit Begeisterung verfolgte er aufgeregt die Propaganda und sah seine Aufgabe darin, die Welt zu verändern und Gutes für sein Vaterland zu tun. Zuhause löcherte er, genauso wie seine Schulfreunde ihre Eltern, ob sie reinrassig, Arier, wären. Der Ahnenpass wurde ein wichtiges Dokument.
Zwumpls Begeisterung hatte auch einen anderen persönlichen Beweggrund. Insgeheim war er, so wie viele andere Schüler froh, dass der strenge Herr Pfarrer mit seinen sadistischen Neigungen durch das NS-System weggekommen war, vor dem er so viel Angst hatte. Wie oft musste Zwumpl unter diesem strengen Herrn Pfarrer als Strafe 100-mal schreiben „Die Kirche ist wichtiger als die Kuh“, wenn er anstatt in die heilige Messe „Halten“ (die Kühe auf die Wiese treiben) musste. Ebenso wurde er bestraft, wenn er die heilige Messe an einem anderen Ort besuchte und von dem dortigen Priester keine Bestätigung hierfür brachte. Die drakonischen Strafen des Pfarrers waren gefürchtet. Er schrieb alles in Kurrentschrift an die Tafel und die Kinder sollten es abschreiben. Nachdem sie die Kurrentschrift nicht lesen konnten, schrieben sie etwas anderes in ihr Heft. Dann schlug er ihnen mit dem mitgebrachten Staberl auf die Fingerspitzen, sodass sie überhaupt nicht schreiben konnten, und aus Angst und Schmerzen nässten, er band die Mädchen mit ihren Zöpfen auf den Rücken zusammen, beschimpfte jedes Kind mit einem angeschmissenen Tiernamen, insbesondere jene, die ihm keinen Sautanz brachten und infolge von ihm keine guten Noten und keinen Grunzlmuamkalender als Dank bekamen. Die Buben hatten zum Schutz vor seinen Schlägen unterhalb einer Hose eine Lederhose an, damit die Schläge des Pfarrers nicht so wehtaten.
Nie hätten sich die Schulkinder zuhause getraut, sich über den Herrn Pfarrer zu beklagen, denn dieser war, als geweihter Stellvertreter Gottes, für die Dorfleute unantastbar. Wenn doch ein Schüler zuhause klagte, sagten die Eltern: „Du wirst schlimm gewesen sein, umsonst wirst du keine Schläge bekommen haben.“
Außerdem war Zwumpl als Ministrant stinksauer, wenn er nach der heiligen Messe so viele Gebete, welche von den Frauen angeschafft und bezahlt wurden, kniend mitbeten musste und ihm seine Knie jedes Mal höllisch schmerzten.
Für ein paar Münzen von diesen Frauen betete der Herr Pfarrer nach der heiligen Messe kniend mit den Ministranten und den Kirchengehern ein paar Vaterunser oder ein Gsatzl vom Rosenkranz. Der Herr Pfarrer las die Namen und die Hausnummer der Auftraggeberin von seinem Zettel ab und betete für eine gute Meinung, für eine gute Hinfahrt oder Heimkunft nach oder von Amerika, für einen guten Ausgang ihres Prozessverfahrens oder für die Verstorbenen. Die Frauen hielten ihre Rosenkränze in der Hand, um mitzuzählen und busselten den Rosenkranz am Anfang und Ende des Gebetes ab. Jede dieser Auftraggeberinnen hoffte, dadurch ihren Ablass von ihren Sünden zu bekommen, dem Fegefeuer und der Hölle zu entkommen bzw. dass sich das Himmelreich wieder um einen Spalt weiter für sie öffnen würde.
Und so hatten sich für Zwumpl durch das neue NS-System seine geheimsten Wünsche wie von selbst erfüllt, nämlich keine Angst und Schläge mehr vom Herrn Pfarrer zu bekommen.
Wie viele andere Eltern auch, wussten die Eheleute Ertl nicht so recht, was sie von Tonis und Zwumpls Begeisterung für das neue NS-System halten sollten. Mit einem Seufzer sagte Anna Ertl: „Wie leicht die Jugend zu beeinflussen und zu verführen ist und alles glaubt, was sie vom neuen NS-System hört.“
Die Frage, was die neue Zeit bringen wird, in der die Jugend gleich einer Gehirnwäsche zum blinden Gehorsam, zu Treue, eiserner Disziplin, Hingabe an die NS-Weltanschauung und zu peinlichster Pflichterfüllung gegenüber dem Führer und dem Vaterland gedrillt wurde und als wichtiger Teil des Aufschwungs und eines großen Reiches anzusehen war, beschäftigte Viktor und Anna Ertl ständig, denn gleichzeitig merkten sie, wie ihre Söhne ihnen entfremdet wurde, ihre Worte nicht mehr zählten, ihnen die elterliche Gewalt und Autorität wie schmelzendes Eis in der warmen Sonne entzogen wurde. Sie mussten feststellen, dass sie von Zwumpl rotzfrech behandelt und wegen ihrer Ermahnungen von ihm verlacht, als altmodisch, sich dem Fortschritt verwehrend, abschätzig behandelt wurden. Dazu wurde er von den neuen Machthabern noch ermutigt. Wie oft schrie er sie trotzig an, sie würden mit ihren alten Ansichten allen Fortschritt verhindern.
Natürlich wollten sie Toni und Zwumpl nicht im Wege stehen und gerne glauben, dass sich ihre Zukunft im Sinne der Propaganda der Nationalsozialisten auch hier verbessern würde, und sie deshalb für den Anschluss stimmen sollten.
Dem Fremden immer skeptisch gegenüberstehend, beängstigte Viktor und Anna Ertl nicht nur der allgemeine Drill der Hitlerjugend mit ihren Heim- und Sportnachmittagen, wo sie Schulungen im Exerzieren, Wehrertüchtigung (geistige und körperliche Ertüchtigung der Menschen zum Kriegseinsatz), Aufmärsche im Dorf, Gruppenappelle, Sport, Geländemärsche, Fahnenappelle absolvierten, sondern insbesondere der Gelände - und Schießdienst mit Kleinkalibergewehren.
„Es wird schon nicht so schlimm werden“, meinte Viktor Ertl leise flüsternd, im Bemühen, seine Frau zu beruhigen, um sie zur Liebe umzustimmen. Und bald darauf hörte Zwumpl, wie sein Vater seine Mutter bedrängte. Sie versuchte ihn mit den Worten „Du kriegst nie genug“ in der immerwährenden Sorge vor einer unerwünschten Schwangerschaft und aus Angst vor dem herrschenden Sittenkodex und dem Tratsch der Leute abzuwehren. „Was werden die Leute sagen, wenn ich alte Frau neben unseren großen Kindern noch einen Wechselbalg bekomme. Wir haben schon genug hungrige Mäuler zu stopfen.“
Anna Ertl kannte keine Begierde, Lust und Erfüllung. Diese Worte waren für sie leere Hülsen, die sie als Phantasiererei und Hirngespinste sündhafter, unkeuscher, unausgelasteter Menschen mit tierischem Trieb abtat. Wenn sie ihren Alltag genauso wie sie selbst mit harter Arbeit ausfüllen würden und ihnen abends die Glieder glousen (schmerzen) würden, und sie müde die Augen schließen würden, würden ihnen diese sündhaften, unkeuschen Gedanken vergehen.
Nirgends sonst fand Anna Ertl mehr Befriedigung, als wenn sie tagsüber viel gearbeitet hatte, abends todmüde ins Bett fiel, nach dem Nachtgebet an ihren erfüllten Arbeitstag dachte, sich freute, wie viel Arbeit sie geleistet hatte, und den Arbeitsplan für den nächsten Tag überdachte.
Da hörte Zwumpl wie sein Vater mit bittender hoher Stimme auf seine Frau einredete und bald darauf das übliche vertraute gleichmäßige Geräusch des knirschenden Strohsacks im gleichen Rhythmus und danach einen unterdrückten Seufzer seines Vaters, sodass er am nächsten Tag viel zu erzählen hatte.
Karl Ertl sah sich im Weinkeller um und kam in die Gegenwart zurück. Müde von den langen Fußmärschen heimwärts zog Karl seine Schuhe aus und legte sich in das Bett, in dem er einst mit Martha die Glückseligkeit empfangen hatte, als wolle er dadurch sein damaliges Glück fühlen, festhalten und wieder zurückholen, wie damals, als das Feuer knisterte und die Flammen ihre Herzen wärmten und ihr Verlangen stillte. Er war zu aufgewühlt und konnte nicht schlafen.
Seine Gedanken schweiften plötzlich völlig unvorhergesehen zu Irene. Als liege sie vor ihm, streichelte er in Gedanken ihr weiches Gesicht. Er spürte ihre zarten Hände an seinem Körper und ein Schauer der Erregung durchfuhr ihn. Wie oft war er mit ihr den Gipfel der Lust emporgeklettert.
Schon im nächsten Moment wanderten Karls Gedanken in vergangene Zeiten. Vor jenem Palmsonntag, dem 10.4.1938, dem Tag der Volksabstimmung, hatten Zwumpl und die kleineren Geschwister wie sonst auch die Palmkätzchen aus dem Wald geholt. Am Palmsonntag nahm Anna Ertl die Palmkätzchen in die Kirche mit, um sie weihen zu lassen und um sie dann anschließend auf das Feld zu stecken, damit die Ernte vor Unwetter geschützt werden würde. Es galt der Spruch: „Meis (Mäuse) und Rotzn (Ratten) hinaus, der Palmbuschen kommt ins Haus.“
Dieses Jahr hatte Zwumpl aufgepasst, dass seine jüngeren Geschwister die Palmkätzchen beim Heimweg nicht abzupften, denn sonst hätte er wie im letzten Jahr nochmals welche holen müssen.
Niemals zuvor hatte Viktor Ertl von Wahlbetrug oder Wahlfälschung gehört und niemals zuvor hatte Karl seinen Vater so wütend gesehen. Denn bereits beim Eingang in das Wahllokal wurde Viktor Ertl skeptisch vom Ortsbauernführer Sepp Tuider, der breitbeinig, höhnisch grinsend da stand, empfangen. Vor den anwesenden Ortsgruppenwahlleiter, Kreiswahlleiter, Wahlkreis-Inspekteur wurde er gefragt, ob er mit ja oder nein stimmen würde.
Nachdem Viktor Ertl diese Bevormundung vor den Anwesenden ärgerte und ihm dadurch wieder einmal vor Augen geführt wurde, wie machtlos und verhöhnt er als ehemaliger Bürgermeister von Tuider wurde, wurde er zornig.
Unzählige Male musste Viktor Ertl für den bauernschlauen Sepp Tuider nach dem Volksspruch „Um den Weg und um den Roan (Grundstücksgrenze) ist die Welt zu kloan (klein)“ vermitteln, da Sepp Tuider immer versuchte, seine Grundstücke zu vergrößern, um sich immer mehr Fläche von den angrenzenden Grundstücken anzueignen.
Sepp Tuider war gewieft und versuchte ständig andere zu übertölpeln. So hatte er einmal versucht, nach dem Verkauf einer Kuh nicht die gesunde verkaufte Kuh, sondern eine andere Kuh loszuwerden,
in der Hoffnung, dass es nicht entdeckt werden würde. Am Tag, als der Viehhändler die gekaufte Kuh holen kam, gab er jene Kuh her, die den Fehler hatte, dass sie am Euter kitzelig war und sich nicht melken ließ. Als der Viehhändler diese Kuh weiterverkaufte, fiel der Mangel auf und die Streitparteien kamen zur Schlichtung zum Bürgermeister Viktor Ertl.
Ein anderes Mal wettete er angeheitert mit einem betrunkenen Bauern im Gasthaus, der behauptete, seine Kuh gäbe die meiste Milch im Dorf. Und als Sepp Tuider morgens in dessen Stall, lässig mit einer Pfeife im Mund, dies überprüfen wollte, warf dessen Frau ihm ihren Melkschemel entgegen und verletzte ihn, sodass er sich zu Viktor Ertl beschweren kam.
Wie oft, meist nach dem Wutschi (Kirtag) oder Feuerwehrball hatte sich die Frau des Ortsbauernführers in der Gemeindestube bei ihm als Bürgermeister über die Untreue ihres Mannes beklagt, vom Streit erzählt und ihm ihre blauen Flecken gezeigt, wenn sie von ihrem Mann geschlagen wurde. Er war als Weiberheld verschrien. Ständig war Sepp Tuider in außereheliche Affären, Streit und Raufereien mit eifersüchtigen Ehemännern verwickelt.
Wie oft hatte seine Frau ihm im Streit Vorhaltungen gemacht ob seiner Untreue und beim Streit blaue Flecken und Striemen von seiner Goasl (Peitsche) davongetragen.
Wütend über Sepp Tuider stimmte Viktor Ertl auf dem Stimmzettel mit „Nein“ ab. Sepp Tuider kontrollierte seinen Stimmzettel und sagte höhnisch: „Du pfeifst eh schon aus dem letzten Loch, schau dass du richtig wählst, sonst kauf ich dich noch auf.“ Darauf erwiderte Viktor Ertl in Gedanken: „Ich wünsche dir einen grünen Hof.“ Was so viel bedeutete, als dass sein Hof tschari (zugrunde) gehen sollte.
Bei der Volksabstimmung über die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich am 10. April 1938 gab es im Burgenland 169 775 Ja-Stimmen und nur 63 Nein-Stimmen, in 297 von 324 Gemeinden, sogenannten Führergemeinden, gab es nur Ja-Stimmen. Während die Befürworter jubelten, flossen bei den Gegnern Tränen über den Verlust des Vaterlandes. Nur ein Staat der Welt, nämlich Mexiko, protestierte gegen die Aggression Hitler-Deutschlands.
Mit dem Anschluss wurde das österreichische Recht durch deutsches Recht ersetzt, der Schilling mit einem Kurs von 1,5 Schilling für 1 RM umgewechselt und alle Devisen und Goldreserven abgezogen.
Wie stolz Zwumpl war, als er bei der anschließend veranstalteten Siegesfeier nach der Volksabstimmung vor der Kaserne, wo die Soldaten des Bundesheeres jetzt auf Adolf Hitler vereidigt wurden, neben der Hitlerjugend, dem BdM (Bund deutscher Mädchen) staunend daneben stand.
Bald würde auch er zu den Pimpfen gehören und Mitglied des Deutschen Jungvolkes sein.
Auch Maria, Ritsch genannt, Karls ältere Schwester, damals noch nicht verheiratet, stand in der Reihe im BdM (Bund deutscher Mädchen) in ihrem dunkelblauem Rock, ihrer weißen Bluse, und Kniestrümpfen und schwarzem Halstuch, hinter ihrer Führerin. Wöchentlich trafen sich die Mädchen im BdM beim geselligen Beisammensein um Heimat- und Parteilieder zu singen, Nähen und Hauswirtschaft zu lernen, zu basteln, Sport, Gruppenspiele und Wanderungen zu unternehmen.
Ritsch schaute verliebt auf ihren heimlichen feschen Bräutigam Franz Leitner, dem Sohn vom Krumpern-Sepp, wie er im Hausnamen genannt wurde, da er immer die schönsten Erdäpfel im Dorf hatte. Franz Leitner stand in der Reihe der HJ (Hitlerjugend) und blinzelte ihr verliebt zu.
Wie gerne hätte sie sich für ihn geschminkt, aber Schminken, Schmuck tragen, war neben dem Rauchen beim BdM verboten.
Befriedigt stellte sie nach kurzer Zeit fest, dass sich wie eine stillschweigende Allianz seine Blicke immer öfters mit ihren kreuzten, seine Augen ihre Bewegungen verfolgten und sie nicht losließen.
Selbst in ihren schönsten Phantasien hatte sie sich nie vorstellen können, dass es eine so große Liebe überhaupt geben könnte. Franz unterschied sich von den anderen Männern, die sie bisher verehrten, um Welten.
Sie hatten sich durch ihren Aufenthalt im BDM-Lager einige Zeit nicht gesehen. Hatte die Liebe diese erste Trennung überdauert? Unsicher schaute sie ihn an.
Wie jedes Mal, wenn er in ihrer Nähe war, überkam sie eine Unruhe und ihre Beine und Hände zitterten vor Sehnsucht und unerfüllter Begierde. Sie fühlte seine scheuen Blicke wohltuend auf sie gerichtet und hoffte, er würde sie noch immer begehren.
Er schickte ihr ein heimliches Busserl und so wusste sie, dass er abends wieder fensterln kommen würde. Und vielleicht würde er ihr wieder am Fenster schwören, dass er nur an sie denke, von ihr träume, sie heiraten wolle und ihr ein Busserl geben.
Sie hatten sich einige Zeit vorher heimlich getroffen, aber geliebt hatten sie sich nicht. Zuerst hatte Ritsch von ihrem Tagesablauf im BDM-Lager, der um 6.00 morgens mit Weckruf begann, anschließendem Frühsport, Ankleiden und Bettenmachen, 7:00 Uhr Appell mit Hochziehen und Hissen der Fahne, Vortrag des Tagesspruches, Frühstück, Antreten zum Dienst, Ruhepause, Jause von 17:00–18:00 Uhr, dann Gespräch und Diskussion über die Tagesereignisse, ideologische Schulung, Rassenideologie und Führerglaube, um 18:30 Uhr Appell mit Einholen der Fahne, um 19:00 Uhr Abendessen erzählt. Um 20:00 Uhr, wenn dann der Tag durch das gesellige Beisammensein, das Singen von Heimat- und Parteiliedern, Nähen, Hauswirtschaft sich dem Ende neigte, war sie wie jeden Tag müde ins Bett gefallen und hatte ihm versichert, dass sie nur an ihn gedacht hätte.
Ritsch freute es, dass sie dort ihre Nähkenntnisse verbessern konnte. Gleich darauf besah sie jede Einzelne von ihr genähte Uniform der Buben in der Hitlerjugend. Etliche Uniformen der Buben hatte sie im Austausch von Naturalien genäht, sodass sich die Hasen in ihrem Stall dadurch vermehrten. Meist brachten die Buben drei Hasen als Entgelt.
Dann glitt ihr Blick zu den wehenden Reichskriegsflaggen, welche die bisherigen rotweißroten Fahnen ablösten. Ebenso wie andere Frauen hatte sie vor der Abstimmung viele Hakenkreuzfahnen genäht, denn erst nachher waren die ersten Originalfahnen ins Dorf gekommen. Dass diese von ihr gefertigten Fahnen noch lange – bis zum Ende des NS-Regimes – wehen würden und fortan die Bevölkerung an den nationalen Feiertagen ebenso am Führergeburtstag zum Beflaggen der Hakenkreuzfahne verpflichtet war, wusste sie zu diesem Zeitpunkt nicht.
Noch nie hatten sie im Dorf eine solche Parade gesehen. Alles kam Zwumpl vor wie ein Traum, ein wunderbares, wahr gewordenes Märchen. Er bewunderte die mit aufgeklebten oder aufgemalten Hakenkreuzen und Fähnchen geschmückten Geschäftsportale und Auslagen. Dass die Ortsparteileitung der NSDAP die Geschäftsleute dazu zwang und bei Nichtbefolgung mit Boykott oder Geschäftsschließung drohte, viele aus Existenzangst die Anordnungen befolgten, wusste Zwumpl nicht. Die Nürnberger Gesetze verboten den Juden das Hissen der Hakenkreuzflagge. Dass er sich unter so vielen gleichgesinnten Uniformierten, die sich jetzt schon zu den Siegern, Richtern und Bezwingern über Regimegegner erhoben, befand, freute ihn. Und genau zu diesen wollte auch er zählen. Staunend betrachtete er die Gestapo (geheime Staatspolizei), welche bald mit ihrer hemmungslosen Verfolgungstätigkeit Angst und Schrecken verbreiten sollte. Als ein glühender Verehrer Hitlers wünschte sich Zwumpl, der Führer wäre persönlich hier. Wie gerne hätte er ihm die Hand gedrückt.
Im Menschenheer zogen auch Viktor und Anna Ertl wie viele andere nicht aus Überzeugung, sondern aus Angst vor Belästigungen und Verfolgungen mit Fackeln mit. Viktor Ertl sah etliche vormals illegale Anhänger der NSDAP, die vorher ihr Parteiabzeichen unterhalb ihres Reverskragens getragen hatten, sich jetzt stolz präsentierten und ihn siegessicher anlächelten. Förmlich vor den Augen eines jeden Betrachters blühten die Befürworter Hitlers auf. Sie hatten durch die Volksabstimmung ihre Bestätigung erhalten und gehörten zu den Siegern.
Immer mehr Leute strömten zur Siegesfeier. Als die Worte der Redner vom Lautsprecher wie abgefeuerte Geschoße auf die eingeschüchterten Zuhörer niederprasselten, erschrak Anna Ertl.
Als Resner in Uniform auf einem mit Hitlerbildern und Hakenkreuz geschmückten Rednerpult stehend bekanntgab, dass nur ein paar Neinstimmen im Dorf waren, brach frenetischer Jubel aus. Dann sprach er ergriffen von der großen Mutter Germania, deren Kinder sie nun alle geworden waren. Er brachte seine Freude über das Ergebnis der Volksabstimmung zum Ausdruck, erklärte, dass es die richtige Entscheidung war, Österreich allein nicht bestehen könne und es nun nur mehr bergauf gehen würde. Die Befürworter hätten mit ihrer Gesinnung Recht, denn nur Hitler würde den Wohlstand bringen. Am Ende seiner Rede rief er mit lauter, befehlshaberischer Stimme, erhobenem, drohendem Zeigefinger als wäre er Hitler persönlich zu den Nein-Wählern: „Zieht hin mit den Juden und Zigeunern, für Volksverräter ist kein Platz in unserer herrlichen, deutschen Volksgemeinschaft. Wir werden den Schandvertrag von Versailles außer Kraft setzen und die deutsche Ehre und Freiheit wiederherstellen. Führer befiehl, wir folgen dir.“
Alle sahen, wie sehr sich Stefan Resner als Redner bemühte, den Führer Hitler nachzuahmen. So sehr er sich bemühte, er kam nicht an das Original heran, denn niemand wusste, dass Hitler bei einem Schauspieler Unterricht im Reden nahm und vor einem Spiegel seine Gebärden einstudierte, diese photographisch festhalten ließ, um sie verbessern zu können. Es liegt die Vermutung nahe, dass er auch seine Augen trainierte, um sein Gegenüber dahingehend zu beeinflussen, um durch die Kraftübertragung seiner Augen seine Interessen seinem Gegenüber wie eine Waffe aufzudrängen. Ebenso trainierte er täglich seinen rechten Arm mit einem Expander, oft am offenen Fenster, um die endlos langen Paraden und Grüße ohne Zittern zu überstehen.
Danach pflanzte Stefan Resner symbolisch einen Baum. Mit Sieg-Heil-Rufen und Freudenkundgebungen wurde die Feier beendet.
Niemand wusste, welche Zukunft ihnen bevorstand und Viktor Ertl war das Lachen vergangen.
Hatte Viktor Ertl zuvor über Stefan Resner, die vielen Arbeitslosen, welche marschierten und sangen, illegale Anhänger, welche ihr Parteiabzeichen unter dem Revers trugen, gelacht und sie für verrückt gehalten, so musste er nun unumstößlich und widerstrebend feststellen, dass sie zu den Siegern und er zu den Verlierern gehörte. Nun hatte sich das Blatt hundertprozentig gewendet und er musste lernen, Stefan Resner und seine Freunde respektvoll zu begegnen, um keinen Ärger bei diesen fanatischen Befürwortern Hitlers aufkommen zu lassen. Viel zu groß war seine Angst vor Verrätern und Denunzianten, welche ehrgeizig daran arbeiteten, Karriere im NS-System zu machen.
Mit dem ersten Aufwachen der Natur nach langem, hartem Winterschlaf zeigte sich im Einklang, als wäre es so besprochen, ebenso im Jahre 1938 wie zur Bestätigung der Propaganda, der erste einschmeichelnde Fortschritt des neuen NS-Systems, wie ein zartes, aufkeimendes Pflänzlein nach strengem Frost, welches bei der Bevölkerung große Sympathiewellen hervorrief. Neben sonstigen Sammlungen für die Bedürftigen machte sogar das Militär im Bezirksvorort eine unentgeltliche Ausspeisung an Bedürftige.
Es ging ein unsichtbares befreiendes Aufatmen in den Köpfen der Menschen durch das Dorf. Durch die Entschuldungsaktion, Kredit- und Investitionshilfen, Erhöhung der Erzeugerpreise, Senkung der Düngemittelpreise, Mechanisierung durch das NS-Regime sollte die Verbesserung der Landwirtschaften vorangetrieben werden mit dem Hintergedanken, für einen eventuellen Kriegseintritt besser vorbereitet zu sein als im 1. Weltkrieg. Besonders die Sozialleistungen wie Ehestandsdarlehen, Kindergeld oder Mutterschutz wurden äußerst freudig begrüßt.
Für die Anhänger der Partei boten sich viele Berufs- und Karrierechancen, insbesondere durch die Säuberungen der Gegner und Vergrößerung der militärischen Bereiche. Es war eine allgemeine Aufbruchstimmung bemerkbar.
Nachdem ein Stier, der zum Rückzahlen der Raten gedacht war, im Elternhaus von Karl Ertl verendet war, hatten sich für Viktor Ertl wegen der aushaftenden, grundbücherlich einverleibten Erbteilsforderungen und des vorhandenen Schuldenrückstandes für den Hausbau große Zahlungsschwierigkeiten aufgetan. Für Viktor Ertl und die anderen verschuldeten Bauern, wo vielfach die Zwangsversteigerung drohte, hatte sich durch die Entschuldungsaktion, wobei bis zum 31. 12. 1938 Entschuldungsanträge zu stellen waren, die Möglichkeit aufgetan, die Schulden langfristig und niedrig verzinst in ein staatliches Darlehen umzuwandeln.
Die Arbeitslosenraten sanken. Um vom Weltmarkt unabhängig zu werden beziehungsweise bei einem eventuellen Kriegseintritt besser gerüstet zu sein und um die Ernährung der Bevölkerung besser sichern zu können als im letzten Krieg, wurden die landwirtschaftlichen Produkte gesteigert und ein Festpreis festgesetzt. Bald kamen billige Düngemittel und ein verbessertes Saatgut aus dem „Altreich“ ins Dorf.
Mit der Nachzahlung der Kinderbeihilfe hatte Viktor Ertl sich eine Pferdemähmaschine und für Ritsch eine neue Nähmaschine gekauft. Von dem restlichen Geld legte er sich sein erstes Sparbuch an.
Sobald die ersten Knospen zum Leben erblühten, die Sonne stärker und wärmer wurde, zimmerte sich auch Karls Freund und der Bräutigam von Ritsch, Franz Leitner, ein Bett, um in der Heuholpan zu schlafen, um mit seinen Freunden unkontrolliert mittels einer Rauberleiter zu spechteln und sonstige Geheimnisse der Nacht zu ergründen.
In jener Unruhnacht vor dem 1. Mai des Jahres 1938 hatten Karl Ertl und Franz Leitner ein unvergessenes, äußerst unangenehmes Erlebnis ausgerechnet mit dem Ortsbauernführer Sepp Tuider. Erstmals war an diesem Abend auch Zwumpl dabei. Es war Brauch, dass die Burschen in dieser Nacht im Dorf ihren unbeliebten Dorfbewohnern allerhand Schabernack trieben. Zwumpl hatte vorgeschlagen, beim Ortsbauernführer Tuider Schabernack zu treiben, denn er stand daneben und hatte gesehen, wie unter der Aufsicht des Ortsbauernführers bei der Verteilung von Schuhen, Kleidungsstücken an bedürftige, kinderreiche Familien nur parteifreundlich Gesinnte etwas davon bekamen und er als ehemaliger Bürgermeistersohn mit leeren Händen heimgehen musste. Später hatte er gehört, dass der Ortsbauernführer die Restpaare am Schwarzmarkt verkaufte. Alle 14 Tage ging der Ortsbauernführer mit der Sammelbüchse des Winterhilfswerkes des Deutschen Volkes, welches der NS Volkswohlfahrt unterstellt war, sammeln. Ebenso ging er für die NSDAP von Haus zu Haus Frucht sammeln und als Viktor Ertl zu wenig gab, ließ er ihn austrommeln. Auch dafür wollten sich Zwumpl und Karl Ertl rächen.
Um den Ortsbauernführer zu fianzln (ärgern), versteckten sie in seinem Hof Werkzeuge und den Anhänger. Ebenso verstreuten sie mit einem lautlosen Schubkarren vom Misthaufen überall Mist. Auch versteckten sie allerlei Naturalien und Dinge auf dem Misthaufen. Sie warfen viel Stroh in die Mistlacke.
Als Zwumpl die Rechen im Schweinestall verstecken wollte, lief ihm eine Ratte in seinen Hosenstrumpf. Sofort grenzte er die Ratte mit seinen Händen ein und Franz Leitner schlug mit einer Heugabel die Ratte innerhalb seines Hosenstrumpfes tot. Als der Ortsbauernführer den Hund bellen hörte, war er blitzschnell aufgestanden und boazte (hetzte) den Hund auf die Eindringlinge. Dieser fiel Zwumpl an, biss ihn, sodass er mit einer offenen Fleischwunde und einer zerrissenen Hose voller Schmerzen und Tränen heimhumpelte.
An jenem 1. Mai 1938 war es morgens bei Sonnenaufgang noch kühler, aber bald wärmten die warmen Sonnenstrahlen die Erde und erfreuten die Gemüter und die Gewächse der Natur.
An diesem Tag war auch Franz Leitner in Karls Elternhaus gekommen, unter dem Vorwand, die Pferdemähmaschine anzuschauen. In Wahrheit war dieses Ereignis ein willkommener Anlass für ihn, Ritsch zu sehen, und um sich zu vergewissern, ob sie wusste, dass der Maibaum vor ihrem Haus als Liebesbeweis von ihm aufgestellt worden war, und um sie zu fragen, ob sie zu den Maifeiern kommen würde.
Auch Stefan Resner und seine Frau Mitzi, die jüngste Schwester von Anna Ertl, waren gekommen.
Zwumpl lief voraus, um ihnen das Wunderwerk vorzuführen. Resner wusste, dass Viktor Ertl verschuldet war und sagte triumphierend: „Deine Tschekn (Erlagscheine) möchte ich nicht zum Zahlen haben. Sei froh, dass du deinen Hof jetzt durch die Entschuldungsaktion von den Schulden freikriegst, wenn Hitler nicht gekommen wäre, wärest du und viele andere Bauern schon tschari (zugrunde) gegangen. Und dass du jetzt einen so guten Preis für den Wein bekommst, hast du auch dem Führer zu verdanken. Endlich nimmt sich jemand unserer Probleme an. Siehst du, was du dir jetzt durch die Kinderbeihilfe alles leisten kannst. Die Kinderzucht ist besser als die Rinderzucht. Bald kannst du dir auch den Strom einleiten lassen. Nun musst auch du einsehen, dass es unter Hitler besser wird. Du wirst sehen, dass es von nun an nur bergauf geht und uns die Errungenschaften des neuen NS-Systems allen Segen und Wohlstand bringen werden.“ Wie zur Selbstbestätigung ergänzte er im Sinne des neuen NS-System: „Endlich ist die Not vorbei, jetzt wird alles besser.“ Dabei klopfte er Viktor Ertl aufmunternd auf die Schultern.
Mitzi hatte ihrem Mann mit leuchtenden Augen zugehört. Wie klug und redegewandt er war. Wie immer, wenn er begeistert über die Errungenschaften und den Fortschritt des NS-System sprach, zog er alle in seinen Bann. In seiner Euphorie für Hitler lief er zur Höchstform auf. Er hatte schon immer für dieses System geworben und vorausblickend erkannt, dass der Fortschritt kommen würde. Sein nie enden wollender Einsatz für das neue NS-System hatte sich gelohnt und nun profitierten alle davon. Er war ihr Held. Dass er für seinen Einsatz so wenig Dank und Anerkennung bekam, kränkte sie insgeheim.
Sie nickte stumm und bekräftigte, dass sich Vieles durch die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV) verbessert hätte.
„Nie werde ich die schöne Fahrt vergessen.“ In Gedanken versunken, erinnerte sie sich an die Fahrt im März 1938, welche durch eine Aktion durch die „Kraft durch Freude“ unter großem Propagandaaufwand, begleitet von der Presse, stattgefunden hatte.
Durch die „Urlaubsaktionen der Nationalsozialistische Volkswohlfahrt“ wurde mit anderen Kindern auch ihr kleiner Bruder ausgewählt und durfte einen mehrwöchigen Erholungsaufenthalt im „Altreich“ verbringen.
Danach waren alle zum Maibaumaufstellen auf den Dorfplatz gegangen, wo sich schon einige Leute versammelt hatten.
Auch Sepp Tuider mit seiner Frau war da. Frau Tuider stand etwas abseits unter einem Nussbaum. Wie hatte sie auf ihren Mann hereinfallen können, sinnierte sie. Gewiss, er war ein hübscher, stattlicher Mann. Sein Hitlerbart stand ihm gut. Er hatte ihr Treue und die große Liebe geschworen, aber bald nach der Heirat hatte sie erkennen müssen, wie sehr sie sich in ihm getäuscht hatte und wie er gleich einem Jagdfieber immer auf der Suche nach Frauen war und für wie unwiderstehlich er sich hielt. Besonders die schwer zu erobernden Frauen reizten ihn. Denn wenn es ihm gelang, eine als unerreichbar geltende Frau zu erobern, stieg sein Selbstbewusstsein und die Erkenntnis, als Liebhaber allen anderen überlegen und einzigartig zu sein. Desto mehr er sich bestätigt fühlte durch seine Eroberungen und sich darin sonnte, desto hilfloser und schwächer wurde sie neben ihm. Wie oft stritten sie und jedes Mal bestritt er sie zu betrügen. Sie wusste, dass er log. Denn gutgemeinte Freunde hatten ihr vertraulich zugeflüstert, wie sehr er sich im Gasthaus prahlte, er könne jede Frau haben und hätte hinter jedem Heuhäufel eine Frau geliebt. Ihm könne keine Frau widerstehen.
Jetzt beobachte sie ihn, wie er nach einem neuen Objekt seiner Begierde suchte. Seine vor Begierde lechzenden Augen schienen jede Frau im Geiste auszuziehen und zu verschlingen. Mit Abscheu erinnerte sie sich an seine vielen Affären und an ihr Entsetzen, wenn sie feststellen musste, dass zuhause Naturalien fehlten, welche sie schwer erarbeitete, und er diese zu seiner jeweiligen Geliebten gebracht hatte.
Er war jetzt immer wenig zu Hause und begründete dies mit seiner wichtigen Funktion als Ortsbauernführer. Nebenbei hörte er sich um, wer Vieh zu verkaufen hätte und verständigte die Viehhändler. Seit seiner Machtzuweisung fühlte er sich in seinem Tun bestärkt, als hätte er Narrenfreiheit.
Wie oft hatte sie ihn beobachtet, wenn seine Hände verstohlen zwischen den Schenkeln der Frauen in ihren für ihn aufreizenden glitschigen (rutschigen), boascherten (bauschigen) Kirtagskleidern strichen. Wie oft hatte sie mitleidige Blicke auf sich gefühlt und Schwiegermütter hinter sich tuscheln gehört, dass das Fensterbrett zu ihren Schwiegertöchtern morgens kotig gewesen wäre und jeder wusste, dass ihr Mann dort gewesen war. Jeden Samstagabend war Sepp Tuider wie ein brunftiges Tier unterwegs, um seine tierischen Triebe zu befriedigen, während er zuhause vorgab jagen zu gehen. Spähend schlich er sich an Häuser heran, um zu erkunden, ob die Hunde mit ihren Besitzern auf der Jagd waren. Lüstern freute er sich darauf, die nackten Frauen beim Baden zu beobachten. Er wusste, dass sie dann das Wasserschaff in die Küche trugen, um sich mit warmem Wasser in der warmen Küche zu baden. Nachdem an den Fenstern die untere Hälfte mit Vorhängen verdeckt war, musste er immer auf davor stehende Bäume klettern, um die nackten Frauen zu sehen. Und so kannte er auch in den umliegenden Dörfern jede Frau im nackten Zustand.
Schmerzlich musste Frau Tuider durch eigene Beobachtungen feststellen, wenn sie ihm öfters nachts in den Wäldern und Äckern heimlich gefolgt war, wie er junge Mädchen traf und wie ounlassig (zudringlich) er war. Am nächsten Tag sah sie aber auch hin und wieder die blutigen Spuren der Abwehr an seinem Gesicht.
Um sich abzulenken, glitt ihr Blick zum Maibaum. Inzwischen wurde der Maibaum mit Girlanden aus geflochtenem Immergrün und verschiedenfarbigen Blumen aus Krepppapier, in flüssiges Wachs getaucht, geschmückt. Es wurden Wurst und Weinflaschen aufgehängt und der Maibaum aufgestellt. Zur allgemeinen Volksbelustigung wurden Spiele durchgeführt, wobei der Maibaum erklettert wurde, um die aufgehängten Festgaben zu erreichen.
Als nun Zwumpl auf den Maibaum kletterte und sein verletzter Fuß zum Vorschein kam, sah Sepp Tuider, dass er frott (offen) am Fuß war und wusste sofort, dass er in der vergangenen Nacht der Missetäter war, als er den Hund auf ihn hetzte, und jagte ihn erbost davon, während alle anderen tanzten.
Karl lächelte insgeheim. Wie glücklich und unbeschwert sie damals waren, als der lang herbeigesehnte Fortschritt eintraf. Niemand konnte damals ahnen, welches Ungemach auf sie wartete. Aber als die ersten Schattenseiten des neuen NS-Systems auftraten und mit der Sudetenkrise im Sommer 1938 die Masseneinberufungen stattfanden, begann für viele die Angst vor Einberufungen ihrer geliebten Söhne, Brüder und Väter.
Karl sah die Einkerbungen auf dem Holzstab und sogleich wanderten seine Gedanken wie von selbst gesteuert zu Martha und jenen verhängnisvollen, heißen Sommer im Jahre 1938, als der Geid im Müliplitschler-Haus beim Dreschen half und ebenso für jeden geernteten Sack Getreide in einen Holzstab eine Einkerbung hineinritzte.
Flimmernd fielen die heißen Sonnenstrahlen in diesen schwülen Tagen auf die sonnengereiften Getreidefelder, welche bald geerntet werden mussten. Die roten Mohnblüten zwischen den Burgunderfeldern wogten im leisen Windsäuseln hin und her, welches einem Kopfschütteln der Menschen glich, als wären sie genauso unschlüssig was die Zeit bringen wird wie den Menschen.
In diesem Sommer zeigte sich für die Geidensleute, dass nicht alles Gold war, was glänzte, und sich hinter der schönen Fassade das Böse versteckte. Die Goatl hatte abergläubisch Schlimmes geahnt, nachdem das Storchenpaar in diesem Jahr wie ein böses Omen ausgeblieben war. Dadurch verstand sie es als einen Wink des Himmels, dass dies nichts Gutes bedeuten konnte und nicht ohne Folgen bleiben würde. Trotzdem sie sich zur Abwehr öfters bekreuzigte, um das Böse abzuwenden, sollte sich das als erfolglos herausstellen.
Vor dem Schnitt mussten die Sensen und Sicheln auf dem Dengelstuhl gedengelt (geschärft) werden und der mit Erde ausgestattete Dachboden für das Aufschütten der Frucht hergerichtet werden. Die Mäuselöcher wurden mit nasser Erde und Stroh verschmiert und dann der ganze Dachboden mit einem Gemisch aus warmem Kuhdung und Wasser mit einem alten, ausgedienten Weißwodl (Schrubber) und Peimpstl (Pinsel) aufglent (aufgetragen). Einen Tag vorher hatte Zwumpl die Fußböden im Haus und auf der Gredn (Vorraum) aufglent (frisch überzogen), während seine Mutter die Säcke flickte.
Wie immer, wurde im Schnitt das angebaute zeitige (reife) Getreide gefechst (geerntet). Die Männer mähten mit dem Sengstrechel und schärften diesen mit einem Wetzstein. Die Frauen banden die Garben und stellten je neun Garben zu einem Fruchtmandl zum Trocknen auf. Anschließend wurde das Feld zwischen den aufgestellten Fruchtmandln mit einem Holmirechen abgestreift, damit keine Ähre verloren ging. Die kleinen Kinder lagen währenddessen in der Hitze oft unter einem Bleinkert (Decke) in der Fuhring (Mulde) oder spielten mit Erdbrocken oder Insekten und aßen Erde. Beim Gehen war es wax, sodass ihre Fußsohlen schmerzten. Wenn sie in den angrenzenden hohen Kukuruzfeldern verschwanden, begann die Angst der Mütter.
Als im Müliplitschler-Haus gedroschen wurde, war der Geid vom Vortag noch nicht nüchtern, was man an seinem schief aufgesetzten Hut sah. Wie öfters, wenn er den Rahm ablieferte, hatte er sich am Vortag im Gasthaus betrunken. Das Pferdegespann wartete, an einem Baum angehängt, vor dem Gasthaus auf ihn. Erst spät an diesem regnerischen Abend in der Dunkelheit stieg er betrunken auf den Pferdewagen, schlug die Pferde, sodass sie erschreckt im Galopp davonliefen und die Milchkannen nur so hin und her schärfelten (purzelten) und er vom Wagen fiel. In der Dunkelheit liefen die Pferde allein weiter, verfingen sich im Wald, sodass ein Jäger sie befreien musste. Zuhause versuchten sie angeschirrt samt ihrer Anhängevorrichtung und dem Wagen in den trockenen Stall zu laufen, sodass ein Stück der Mauer herausgerissen wurde. Patschnass war der Geid nach langer Zeit zu Fuß heimgekommen und hatte zitternd geschrien: „Mutter, die Hexen haben mich übergehabt.“
Ständig kreisten die Gedanken vom Geid, genauso wie bei allen Familien, angstvoll über die Sudetenkrise und einen bevorstehenden Krieg und sein bevorstehendes Schicksal. Der Geid befürchtete, bald einberufen zu werden. Was würde dann aus seiner Familie werden? Am meisten Sorgen machte er sich um seine Kinder Martha und Adolf, seinen geistig behinderten Sohn. Wer würde für Adolf, seinen behinderten Sohn, der als Kind in die Froas (Frais) gefallen war, sorgen, wenn er nicht mehr da war?
Um sich zu beruhigen und sich von seiner Furcht abzulenken, suchte er wie öfters Trost im Alkohol. Während der Arbeit wurde den Männern Most gereicht, aber der Geid wusste, dass im kühlenden Brunnen der Uhudler-Wein für das Mittagessen, in einem Amper (Kübel) heruntergelassen, hing. Jedes Mal, wenn er vom Dachboden herunterstieg, kurbelte er mit einer Kurbel den Wein vom Brunnen heraus und trank, sodass er bald stänkerisch wurde.
Als die Goatl mit dem Geid schimpfte: „Trink nicht so viel Wein, du bist betrunken“, schrie er zurück: „Ich werde nicht betrunken, ich vertrag viel Wein, ich bin geeicht.“
Stefan Resner ärgerte, dass es hier keinen Strom gab. In seinem Ärger schrie er: „Wenn ihr Strom hättet, ginge alles leichter.“ Angriffslustig erwiderte der Geid: „Was brauchst du dich prahlen mit dem Strom, wenn in eurer Gemeinde drei Familien gleichzeitig dreschen, fällt das Stromnetz wegen Überlastung aus.“
„Du sei ruhig, warum kommst du nicht schneller vom Dachboden zurück“, entgegnete Resner wütend.
Daraufhin wurde der Geid zornig und lallte: „Du Siebengscheiter, wegen dir und deinem Hitler wird es bald Krieg geben im Sudetenland. Im nächsten Moment erhob er die rechte Hand, salutierte so heftig, dass sein Hut herunterfiel und schrie: „Ein Volk, ein Reich, ein Führer, derselbe Dreck wie ender (früher). Heil Moskau, den Hitler soll der Teufel holen.“
Marthas Blut stockte, ihr Herz drohte zu zerspringen. Wie gerne hätte Martha jetzt, wie sonst auch immer, wenn ihr Vater zuhause über Hitler schimpfte, den Volksempfänger laut aufgedreht, dass ihn niemand hören konnte. Denn nachdem der Geid von Stefan Resner nach dem Kirchenbesuch vor allen Kirchengehern ob seiner Unwissenheit blamiert wurde, hatte er sich sofort einen Volksempfänger beschafft. Martha hatte es jedem erzählt, damit alle wissen sollten, dass sie nun auch gut informiert seien.
In Stefan Resner pulsierte das Blut vor Zorn. Eine derartige öffentliche Beleidigung des Führers konnte er nicht hinnehmen. Er empfand es als seine Bürgerpflicht, seine Loyalität gegenüber dem Führer darzutun, und den Geid anzuzeigen. Stillschweigend hoffte er, sich dadurch beim NSDAP-System beliebt und Karriere zu machen.
Im selben Moment ging er weg, um eine Anzeige zu machen, obwohl sich alle anderen bemühten, ihn im Hinblick auf die zukünftige Verwandtschaft davon abzuhalten, insbesondere die Goatl. Als Stefan Resner sah, wie sehr Martha weinte, meinte er nur lapidar, Ordnung und Zucht seien das Gebot der Stunde. Dann war er eiligst verschwunden.
Als der Geid kurze Zeit später von der Gestapo abgeführt wurde, schien jeder Winkel im Dorf verstummt zu sein. Die auf der Gossn stehenden Zuschauer flüsterten sich ängstlich hinter vorgehaltener Hand ein paar Worte zu und verschwanden. Auf dem Dorfplatz, wo früher unbekümmert über alles gesprochen wurde, traute sich niemand mehr über das NS-System zu schimpfen, Martha schnürte es beim Abführen ihres Vaters die Kehle zu. Wie ein Verbrecher wurde er vor aller Augen abgeführt. Wie würde sie mit dieser Schande weiterleben können? Sie hatte irgendwie auf ein Wunder gehofft, dass ihm jemand zu Hilfe eilen würde und es sich als ein böser Scherz herausstellen würde, aber umsonst. Nun konnte sie ihren Verdienst bei der mehrmonatigen Grünarbeit in Deutschland, welche sie bereits mit einem hiesigen Parteiführer vereinbart hatte, vergessen. Dabei hatte sie sich bereits, so wie es im Dorf üblich war, schon von ihren Verwandten verabschiedet.
Die Goatl begann zu schluchzen: Gerade jetzt, in der gnädigsten Zeit, muss das geschehen“, jammerte sie. Noch immer optimistisch drehte sich der Geid zu seiner Familie um und schrie angeheitert: „Wir kommen wieder.“
Auch die Eheleute Ertl waren schockiert und wären aus Schande am liebsten im Boden versunken. Dass Stefan Resner imstande war, eine solche Tat rücksichtslos an ihrer zukünftigen Verwandtschaft zu begehen, erschütterte sie.
Bald darauf wurden im Dorf auch andere Personen verhaftet und die ersten Hausdurchsuchungen durchgeführt, sodass viele ahnten, dass das vermeintlich gute Schlangengesicht lange Schatten warf. Niemand traute sich mehr öffentlich über die NSDAP zu schimpfen, denn sofort wurde ihnen von den neuen Machthabern gedroht: „Wenn du nicht spurst (folgst), kommst du ins KZ.“ Keiner im Dorf wusste, was „KZ“ bedeutete. Mangels Information stellten sich die Leute das KZ wie ein Arbeitslager vor.
Kurz hatte Karl sich umdrehen wollen, als er einen stechenden Schmerz in seinem verletzten Bein gespürt hatte. Das alte, durch Holzwürmer durchlöcherte Holzbett mit dem Strohsack erinnerte ihn an Martha. Er hatte mit ihr hier im ghoam (Geheimen) eine glückliche Zeit verbracht. Er fühlte sich geborgen in der vertrauten Ruhe und Abgeschiedenheit und dem Wohlgefühl in seiner Heimat. Augenblicklich fiel er in einen tiefen Schlummer und seine Träume holten ihn zurück in jene glückliche Zeit mit Martha in dieser vertrauten Umgebung.
Wohin der Geid gebracht wurde, wusste weder sie noch sonst jemand.
Martha tat es ahnt (leid) um ihren Vater. Am schlimmsten war für Martha die Ungewissheit, nicht zu wissen, ob es ihrem Vater gut ging, wie lange er dort bleiben musste beziehungsweise ob er überhaupt wieder heimkommen würde.
Wie oft hatte Karl seine Martha hier im Weinkeller im flackernden Schein des Petroleumlämpchens getröstet, wenn sie sich über die Verhaftung ihres Vaters ärgerte. Wie oft hatte er zugehört, wenn sie ihm von ihrem Tagesverlauf im RAD-Barackenlager, welches mit einem Luftschutzbunker außerhalb des Dorfes errichtet wurde, erzählte, wo sie während des Tages zu Arbeiten in landwirtschaftlichen Betrieben, Spitälern, Fabriken und anderen öffentlichen Einrichtungen verpflichtet waren. Gegen Ende des Krieges wurden sie während ihres einjährigen Dienstes beim Flugmeldedienst, später beim Flugabwehrdienst eingesetzt. Sie fuhr mit einem Fahrrad hin. Zuerst hatte Karl sie auf seinem Fahrrad auf der Stange sitzend mitgeführt. Dann hatte die Goatl ihrer Schwester nach Amerika geschrieben und gebeten, ein paar Dollar für den Ankauf eines Fahrrades zu schicken. Als das Fahrrad gekauft war, hatte Karl ihr Fahrrad fahren gelernt. Martha war es gewohnt, so wie bisher links zu fahren, aber Karl hatte ihr eingebläut, sie müsse nun unter den Deutschen, nachdem der Rechtsverkehr eingeführt und die Beschilderung der Straße neu gestaltet wurde, rechts fahren.
Hier, in diesem Bett, hatten sie sich das erste Mal geliebt, nachdem sie in trauter Zweisamkeit ihren Geburtstag gelobt (gefeiert) hatten. Karls einzige Liebeserfahrung mit der Frau mit der weißen Leber war schon lange her. Aber damals war es ohne sein Zutun geschehen, nun musste er es geschickt anstellen, damit es auch Martha jetzt und in Zukunft gefallen würde. Wie oft hatte er den Moment herbeigesehnt und nun war er unsicher. Auf Geheiß der inneren Neugier ertastete er zärtlich ihre verborgenen Stellen, welche Martha anstandshalber sanft abwies. Er war erstaunt, wie wenig sie sich wehrte, also fuhr er, ihr Einverständnis vorausgesetzt, fort. Wie unerfahren Martha war. Sie wusste nicht, was sie machen sollte, und so schlang sie ihre Hände um Karls Hals und ließ ihn zögernd gewähren. Allmählich entspannte sich Martha, spürte die Erregung und ihr Körper sehnte sich nach seinen Zärtlichkeiten, bis ihre seit Kindesbeinen streng anerzogene Keuschheit und Gottesfürchtigkeit in einem dichten Nebel der Glückseligkeit verschwand. Bis jetzt war ihr Unterleib ein Tabuthema. Aber jetzt war ihr bewusst, dass er eine wichtige Funktion zu erfüllen hatte.
Einerseits schalt sie sich, sich Karl zu leichtfertig hingegeben zu haben, eine Sünde begangen zu haben, und war erstaunt, trotzdem dabei Glück erfahren zu haben. Anderseits frug sie sich insgeheim, ob es ihm gefallen hatte? Ob sie ihm gereicht hatte und sie ihm alle Wünsche erfüllen konnte? Würde er sie wieder begehren?
Wie schamhaft und scheu Martha war und immer Angst vor der Entdeckung ihrer Sünde, welche laut ihrer Empfindung hier im Weinkeller gemacht wurde, hatte. Wie so oft versuchten diese Weinkeller hoch über dem Dorf thronend vergebens, alle Sünden und heimlich geschlossenen, unstatthaften Bündnisse zu vertuschen. Sie verbargen viele Geheimnisse des Lebens und so manche vorher gute Beziehung unter den Leuten wäre beim Bekanntwerden des Geschehens hier geplatzt. Gevatter Wein stand lachend daneben, forcierte die teils lasterhaften Geschehnisse und hob so manche Untugend hemmungslos aus der Taufe, während den Kindern in der Schule beigebracht wurde: „Schnaps, Bier, Wein, das lasse sein, sitzt darin ein Teufelein!“ Mit Martha hatten die lasterhaften Teufel Nachsicht. Sie verbündeten sich mit ihr und verschwiegen alles, aber die Engel in der Kirche mahnten Martha, um sie auf den rechten Weg zu weisen und ließen sich nicht täuschen.
Unerfahren wie Martha war, fürchtete sie, dass jedermann ihre Sünde am Sonntag bei der heiligen Messe an ihrem Gesicht ablesen könnte. Sie wusch sich sorgfältig, als ob sie die Spuren der Liebesnacht abwaschen könnte. Dann betrachtete sie ihr Spiegelbild und prüfte, ob sie sich verändert hatte. Sie war froh, keine Veränderung feststellen zu können, dennoch war sie insgeheim stolz, in den Kreis der Frauen aufgenommen worden zu sein, die das Geheimnis der Liebe erfahren hatten. Vor der Kirche traute sie sich niemanden in die Augen zu schauen. Unglücklicherweise passierte ein Missgeschick. Vor jenem Maria Himmelfahrtstag hatte sie gebeichtet und als sie der Herr Pfarrer fragte ob sie Unkeuschheit getrieben hatte, verneinte sie, denn sie wusste nicht, was er meinte. Sollte sich diese Lüge rächen? Nachdem vor der heiligen Kommunion nichts gegessen werden durfte, fiel sie, am Mittelgang der Kirche stehend, um. Wie immer, wenn ein junges Mädchen umfiel, gab es reichlich Stoff für Vermutungen, ob sie etwa schwanger sei, von wem und ob es bald eine Hochzeit geben würde, was jedes Mädchen am meisten fürchtete. Kein Mädchen wollte entehrt und als Flitscherl verschrien werden. Und als Martha nach der Ohnmacht wieder zu sich kam, glaubte sie vor Scham im Boden versinken zu müssen. Nun war sie im ganzen Dorf zum Tratschobjekt geworden. Sie fürchtete, dass der Tratsch in allen bösartigen Varianten und Vermutungen ausarten und ihren guten Ruf schädigen würde.
Gewissermassen fühlte sich Karl schuldig für das Missgeschick und den Tratsch. Jetzt fuhr ein Schauer der Empörung durch seinen Körper. Er schalt sich einen Narren. Wie hatte er sich so verirren können. Er musste den Weg zu Martha wieder finden, er brauchte noch Zeit. Warum sollte er das vorgefertigte Gefüge, die Mühen und Plagen ihrer Eltern und Vorfahren ignorieren und zerstören und den unbequemen Weg mit Irene gehen. Martha und er waren seit jeher füreinander bestimmt. Es war alles von langer Hand für sie beide vorbereitet. Er musste sich nur ins fertige Nest begeben. Bald würde Irene immer mehr in den Hintergrund treten und ihr Bild verblassen. Gleich morgen würde er Martha besuchen.