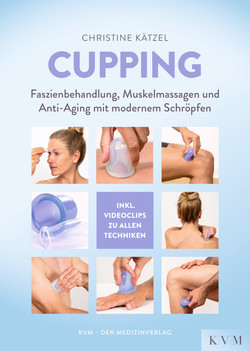Читать книгу Cupping - Christine Kätzel - Страница 7
Оглавление1 — CUPPING: DREIDIMENSIONALE MASSAGE MIT UNTERDRUCK
1.1 Geschichte des Schröpfens
Schröpfen ist ein seit Jahrtausenden angewendetes naturheilkundliches Therapieverfahren und zählt zu den ältesten Heilmethoden der Menschheit. Man schätzt, dass das Schröpfen schon seit ca. 5.000 Jahren angewendet wird.
Ursprünglich kommt das Schröpfen aus der traditionellen chinesischen Medizin und wurde dort zur Stimulierung von Akupunkturpunkten angewendet. Es zählt zu den ausleitenden Verfahren. Es wurde in vielen Kulturen mit den unterschiedlichsten Mitteln angewendet, z. B. mit Tierhörnern, Bambussegmenten oder Metallgefäßen.
Doch schon im alten Ägypten wurden Schröpfköpfe aus Glas verwendet. Im antiken Griechenland wurde das Schröpfglas zum Zeichen des Arztes. Es war ein heiliges Symbol des Asklepioskultes. Das glockenförmige Schröpfgefäß wurde zur Gottheit Telesphorus erhoben und auch auf Münzen aufgeprägt.
Im Mittelalter wurde dieses Verfahren auch von Hildegard von Bingen (1098–1179) angewendet. Sie hat das Schröpfen in ihrem Werk „Causae et curae“ beschrieben und dadurch in Europa verbreitet. Dabei wurden Schröpfgläser verwendet, die direkt auf die Haut aufgesetzt wurden.
In diesen Gläsern wurde Unterdruck durch Erhitzen erzeugt: Man brannte am bzw. im Glas Watte ab und setzte den Schröpfkopf direkt auf die Haut. Die Luft im Schröpfglas kühlt ab und der dadurch entstehende Unterdruck zieht das Gewebe in das Schröpfglas hinein.
Dabei gab und gibt es noch immer zwei Arten der Schröpftherapie:
• blutiges, auch nasses Schröpfen
– Hier wird das zu behandelnde Haut- areal kurz angeritzt und das Schröpfglas mit Unterdruck aufgesetzt.
– Der Unterdruck zieht dann Blut und Lymphe aus dem Gewebe.
• unblutiges bzw. trockenes Schröpfen
– Hier wird das Schröpfglas mit Unterdruck auf unversehrte Hautareale aufgesetzt.
Abb. 1.1: Römische Schröpfköpfe aus Metall, etwa 1.–3. Jahrhundert nach Chr.
(© Dr. Henri Kugener, Innsbruck)
Abb. 1.2: Römischer Schröpfkopf aus Metall, etwa 1.–3. Jahrhundert nach Chr.
(© Dr. Henri Kugener, Innsbruck)
Abb. 1.3: Mittelalterliche Darstellung eines Baders mit seinem Patienten. Die Schröpfköpfe werden angesetzt (Holzschnitt um 1481) (Quelle: Wikipedia)
Abb. 1.4: Antike Schröpfköpfe aus Glas, hergestellt im 7.–13. Jahrhundert nach Chr. (© Dr. Henri Kugener, Innsbruck)
Schröpfen heute: Cupping
Nachdem das Schröpfen eine ganze Zeit in Vergessenheit geraten war oder nur noch wenig von Naturheilkundlern angewendet wurde, ist es jetzt mit neuen Methoden und anderem Material wieder aktuell. Mittlerweile nutzt man zum Schröpfen keine Gläser mit Saugball oder Vakuumpumpe mehr, sondern Silikon-Saugnäpfe. Diese sind individueller einsetzbar und praktischer für Transport oder Aufbewahrung.
Durch das neue Material sind die therapeutischen Möglichkeiten erweitert worden. Gleitende Techniken oder die Anwendung im Gesicht, für eine Durchblutungsförderung und damit Verminderung von Falten, sind jetzt möglich.
Abb. 1.5: Traditionelle Schröpf- und Massagegläser.
Abb. 1.6: Moderne Schröpfsauger (Cups) aus Silikon in verschiedenen Formen und für unterschiedliche Körperregionen.
1.2 Schröpfen in der traditionellen chinesischen Medizin
Das Schröpfen „Ba Guan“ wird in der TCM (Traditionelle chinesische Medizin) schon seit über 2.000 Jahren angewendet. „Ba Guan“ gehört dabei in den Bereich der äußeren Medizin.
Das Schröpfen ist in der TCM eine unspezifische Reizbehandlung. Sie soll Giftstoffe ausleiten und damit die körpereigene Abwehr stärken. Sie gehört zu den physikalischen Techniken. Schon im alten China kannte man den Zusammenhang zwischen bestimmten Punkten bzw. Bereichen neben der Wirbelsäule (Blasenmeridian), mit den inneren Organen und den Shu- oder auch Zustimmungspunkten. Heute wissen wir, dass es dort Zusammenhänge mit dem vegetativen Nervensystem gibt. Der Verlauf des Blasenmeridians stimmt außerdem mit dem Verlauf der Rückenfaszie (s. Abb. 1.14) überein. In der TCM sind Veränderungen oder Schmerzen an den Zustimmungspunkten von Bedeutung. Beim Abtasten in den Bezirken spürt man harte Stellen, die druckschmerzhaft sind. Es gibt auch Ashi-Punkte, schmerzhafte Punkte, die wir als Triggerpunkte kennen.
Mit dem Cupping, der modernen Form des Schröpfens, können wir direkt auf diese Punkte und auf den Zustand des Gewebes Einfluss nehmen.
Die Wirkung des „Ba Guan“ in der TCM
• Vorbeugende Wirkung
• Mechanische Wirkung auf die Haut: Erwärmung und Stimulierung
• Entfernung krankmachender Faktoren (z. B. Wirkung auf die Ashi-Punkte)
• Regulierung des Gleichgewichts zwischen Yin und Yang
• Lösen von Blockaden in den Meridianen
• Regulierung der Mikrozirkulation im Körper
• Unterstützung der Entgiftung des Körpers
• Reflektorische Wirkung auf das Nerven- system und weiterleitend auf die inneren Organe
• Öffnung der Poren
• Stoffwechselanregung und damit Gefäß- erweiterung, Anregung des Immunsys- tems, innere Entgiftung
Insgesamt wird „Ba Guan“ als eine unspezifische Behandlung mit vorbeugender Wirkung beschrieben. Aber es gibt auch Anleitungen für spezifische Probleme am Bewegungsapparat und für kosmetische Behandlungen.
Abb. 1.7: Der Verlauf des Blasenmeridians neben der Wirbelsäule.
1.3 Cupping, das moderne Schröpfen
Cupping kommt aus dem Englischen und bezeichnet das moderne Schröpfen. Während man früher mit Glas- oder Metall-Schröpfköpfen gearbeitet hat, verwendet man heute Silikonschröpfköpfe, sogenannte Cups, die auf die nackte Haut aufgesetzt werden. Diese Behandlungsmethode, die u. a. bei Verspannungen, Rückenschmerzen oder auch bei Cellulitis eingesetzt werden kann, funktioniert einfach und schnell zu Hause.
Beim traditionellen Schröpfen wird ein glockenförmiges Gefäß, ein sogenanntes Schröpfglas, auf die Haut aufgesetzt. Damit ein Unterdruck entsteht, wird die Luft im Glas erhitzt. Das erreicht man, indem man in Äther getränkte Watte anzündet und kurz in das Glas hält. Danach setzt man das erhitzte Glas auf die nackte Haut. Durch den Unterdruck, der beim Abkühlungsprozess der Luft im Inneren des Glases entsteht, wird das Gewebe in das Glas hineingezogen. Dieser Unterdruck kann auch mechanisch oder elektrisch durch eine Vakuumpumpe erzeugt werden.
Da unter den Silikonglocken der Unterdruck nicht so stark ist wie unter einem Glasschröpfkopf, wird das Gewebe schonender behandelt und es treten weniger Nebenwirkungen auf. Zudem muss man die Luft in der Schröpfglocke weder erhitzen noch eine Vakuumpumpe einsetzen. Durch einfaches Zusammendrücken mit den Fingern und direktes Aufsetzen auf die nackte Haut erzeugt man Unterdruck und das Gewebe wird in den Cup eingesogen. Unter den Cups entsteht, je nach Dauer der Anwendung und Zustand des Gewebes, ein leicht rötlicher, roter bis blauer Fleck, der eine Weile bestehen bleiben kann.
Mit dieser neuen Form des Schröpfens können Sie leicht und ohne großen Aufwand unterschiedlichste Beschwerden behandeln, Ihre Faszien gleitfähiger machen, die Muskelspannung senken, die Durchblutung stärken und somit eine schnelle Regeneration fördern.
Abb. 1.8: Traditionelle Schröpfgläser mit Vakuumpumpe.
Abb. 1.9: Typische Hautabdrücke nach der Anwendung.
Abb. 1.10: Der Cup wird mit den Fingern zusammengedrückt und auf die nackte Haut aufgesetzt.
Abb. 1.11: Der im Cup aufgebaute Unterdruck saugt das Gewebe an.
Abb. 1.12: Der Unterdruck im Cup erzeugt einen rötlichen Abdruck auf der Haut, der auch mal stärker sein kann.
1.4 Was passiert eigentlich beim Cupping?
Wo wirkt Cupping und welche Wirkung hat es auf unsere Faszien?
Wenn wir mit Cupping an unserem Körper arbeiten, erzielen wir eine Wirkung in erster Linie über unsere Haut und unsere Faszien. Diese Wirkung ist aber nicht lokal begrenzt. Über die Faszien wirkt das Cupping auch auf weiter entferntes Gewebe.
Faszien, auch Bindegewebe genannt, die alles im Körper miteinander vernetzen, sind ein spannendes Gewebe in unserem Organismus. Erst die aktuelle Forschung konnte mit modernen Methoden zeigen, wie wichtig die Faszien für unseren Körper sind.
Faszien sind ein Spannungsnetzwerk, das unseren ganzen Körper durchdringt, umhüllt und alles miteinander verbindet. Dieses Spannungsnetzwerk ist keine isolierte Struktur. Im Gegenteil: das komplette Gewebe in unserem Körper muss als ein zusammengehöriges Ganzes betrachtet werden. Durch die Vernetzung über diese Faszienketten (s. Abb. 1.14–1.18) wirkt das Cupping auch auf andere Bereiche in unserem Körper. Außerdem gibt es direkte Verbindungen zwischen der Haut und tieferen Strukturen. Auch Muskeln sind strukturell direkt mit den Faszien verbunden und bilden körperweite Muskel- und Faszienketten. Zudem existieren auch Verbindungen von Organen zu bestimmten Hautarealen und vieles mehr. Mit diesem Wissen können wir mit Cupping auf unseren ganzen Körper einwirken.
Abb. 1.13: Lebendiges Fasziengewebe unter endoskopischer Betrachtung (Guimberteau J.-C., Armstrong C.: The Architecture of Living Fascia © Handspring Publishing Ltd., 2015).
Wichtige myofasziale Ketten: Rückenlinie
Abb. 1.14: Oberflächliche Rückenlinie (blau) von hinten und von der Seite.
Wichtige myofasziale Ketten: Frontallinie
Abb. 1.15: Oberflächliche Frontallinie (blau) von vorn und von der Seite.
Wichtige myofasziale Ketten: Seitenlinien
Abb. 1.16: Seitlinien (blau) von vorn und von der Seite.
Wichtige myofasziale Ketten: Spirallinien
Abb. 1.17: Spirallinien (blau) von vorn und von der Seite.
Wichtige myofasziale Ketten: Armlinien
Abb. 1.18: Armlinien (blau) von vorn und hinten.
10 Fakten über unsere Faszien –
Faszien haben viele und spannende Aufgaben in unserem Körper. Hier sind 10 Fakten zu unserem Spannungsnetzwerk Fasziengewebe.
1. Kontinuität
Faszien verbinden unseren ganzen Körper mit- und untereinander. Ununterbrochen gibt es eine ganzheitliche Verbindung über und durch den ganzen Körper. Darüber kann man mit Cupping auch eine Fernwirkung erreichen.
2. Elastizität und Kraftentladung
Eine wichtige Eigenschaft: Faszien sind flexibel und elastisch, gleichzeitig aber auch zugfest und widerstandsfähig. Ähnlich wie ein Gummi mit Jo-Jo-Effekt unterstützen die Faszien damit die Muskulatur bei kräftigen Bewegungen.
3. Kontraktion
Stabilität und Verspannung: Die Zellen in den Faszien können sich unabhängig von der Muskulatur zusammenziehen und somit die Spannung erhöhen. Damit sorgen sie unter anderem für eine aufrechte Haltung und stabile Beinachsen.
4. Bewegungs- und Gleitfähigkeit
Die Faszien sorgen in jeder einzelnen Zelle, in jedem Muskel, in allen Gewebsschichten und zwischen den Organen für Gleitfähigkeit. Davon hängt unsere Gesamtbeweglichkeit ab.
5. Formgebung
Faszien formen unseren Körper durch ihre Stütz- und Bindefunktion und sind damit auch für das Erscheinungsbild des Körpers verantwortlich.
6. Hydration
Die Matrix der Faszien besitzt eine hohe Wasserbindungsfähigkeit. Eine Faszie besteht zu 68 % aus Wasser, das in gelförmigen Zustand gebunden ist. Das ist zum einen wichtig für die Bewegungs- und Gleitfähigkeit insgesamt, zum anderen sorgt diese Wasserbindung für den Transport von Nähr- und Botenstoffen sowie von Abfallprodukten aus unserem Stoffwechsel.
7. Sinnesorgan
Im Fasziengewebe befinden sich viele verschiedene Sensoren und Nervenzellen, die aufgenommene Informationen an das Gehirn weiterleiten. Diese Sensoren ermöglichen die passende Reaktion auf unsere Umwelt. Zum Beispiel die Tastsensibilität unserer Fingerspitzen oder die Wahrnehmung von Vibrationen, Muskelspannung, Druck oder veränderte Körperpositionen.
8. Schmerzwahrnehmung
Freie Nervenendungen im faszialen Gewebe dienen als Schmerzrezeptoren. Sie nehmen thermische, chemische und mechanische Reize wahr und reagieren darauf mit Schmerz.
9. Kommunikationsnetz
Faszien stehen mit dem vegetativen Nervensystem in Beziehung. Dadurch werden aufgenommene Reize körperweit weitergeleitet. Über dieses Nervensystem haben wir keine bewusste Kontrolle, sondern es regelt unsere Körperfunktionen meist selbstständig.
10. Anpassungsfähigkeit
Die faszialen Strukturen in unserem Körper unterliegen wie alle anderen Gewebe einem ständigen Umbau. Durch Bewegung und Training passen sich die Faszien an und bleiben gleitfähig. Bei Fehlhaltungen oder Bewegungslosigkeit werden Umbauprozesse reduziert, Fasern verkleben und Schmerzen entstehen.
Wie wirkt Cupping?
› Verformung des Gewebes:
Wenn sich der Schröpfkopf auf der Haut festsaugt wird die Haut dreidimensional verformt:
• Eine Hautfalte wird eingesogen und es entsteht durch den Sog ein Zug in der Haut im Schröpfkopf.
• Dieser Zug wirkt auf die Sensoren in diesem Bereich der Haut:
– Freie Nervenenden reagieren auf chemische oder thermische Reize und lösen bei Verletzungen die Schmerzwahrnehmung im Gehirn aus.
– Ruffini-Körperchen nehmen die Stärke der Hautdehnung wahr.
– Vater-Pacini-Körperchen nehmen Vibrationen auf.
– Meissner-Körperchen registrieren, wie schnell die Haut eingedrückt wird.
– Merkel-Zellen nehmen die anhaltende Berührung wahr.
→ Diese Sensoren melden alle Empfindungen dem zentralen Nervensystem, also unserem Gehirn.
• Der Rand des Schröpfkopfes drückt sich dabei tief in die Haut und übt einen Druck aus.
• Dieser Druck wirkt sich auf die Gefäße in diesem Areal aus.
– Dort wird die Durchblutung beeinträchtigt oder sogar unterbunden.
• Um den Schröpfkopf herum ist die Haut einem Zug ausgesetzt.
Abb. 1.19: Mechanorezeptoren besitzen unterschiedliche Formen und Funktionen. Merkel-Zellen, Meissner- und Ruffini-Körperchen sowie Tastscheiben sitzen in der Lederhaut (Dermis). Sie nehmen vor allem Druck-/Dehnungsreize wahr und ermöglichen somit unseren ausgeprägten Tastsinn. In der Unterhaut (Subkutis) liegen die Vater- Pacini-Körperchen, die insbesondere Vibrationen wahrnehmen.
› Ausschüttung von Gewebshormonen:
Durch die oben beschriebenen Reaktionen reagieren auch die Mastzellen in der Haut. Sie gehören zur körpereigenen Abwehr und enthalten Botenstoffe, darunter auch Histamin und Heparin.
• Die Mastzellen schütten jetzt das Histamin aus.
• Dadurch erweitern sich die Blutgefäße.
• Die Hautnerven werden gereizt und es kommt zu einem Juckreiz ähnlichen Gefühl.
› Gewebeunterdruck:
• Im Schröpfkopf besteht ein Vakuum, der einen Sog in der Haut auslöst.
• Das setzt sich auch in tiefere Schichten der Haut fort.
• Venöses Blut und Lymphe werden dadurch zum Schröpfkopf gesaugt.
• Lymph- und Blutgefäße direkt im Schröpfkopf werden entfaltet.
• Es kommt dort zu einer passiven Mehrdurchblutung (Passive Hyperämie).
Abb. 1.20: Head’sche Zonen auf dem Rücken.
› Aktive Mehrdurchblutung (Reaktive Hyperämie):
• Nach Entfernen der Saugglocke erweitern sich die Arterien unter dem Einfluss von Histamin.
• Es kommt zu einer aktiven Mehrdurchblutung in dem Areal.
• Diese reaktive Hyperämie bleibt einige Zeit erhalten.
• Sie ist verantwortlich für die Wirkung des Schröpfens.
› Wirkung auf Organe:
Head’sche Zonen (s. Abb. 1.20) sind Bereiche der Haut, die über ein Rückenmarksegment mit bestimmten Organen verbunden sind.
Bei Erkrankung eines Organs kommt es zu Schmerzen auf dem entsprechenden Hautbezirk, zum Beispiel Schmerzen im linken Arm bei einem Angina pectoris Anfall (übertragener Schmerz). Wird in solch einem Areal ein Cup aufgesetzt, erreichen wir dadurch auch das dazugehörende Organ.
Abb. 1.21: Dermatome und ihre Zugehörigkeit zu den Segmenten der Wirbelsäule.
| ORGAN | DERMATOM | SCHMERZREAKTION |
|---|---|---|
| Herz | C3–4, Th1–5 | links am Thorax, linker Arm |
| Zwerchfell | C4 | Schulter |
| Lungen | C3–4 | jeweilige Körperseite |
| Magen | Th6–9 | Epigastrisch links |
| Leber/Gallenblase | Th6–9 | rechter Oberbauch |
| Dünndarm | Th10 | um den Nabel |
| Dickdarm | Th11–L1 | Unterbauch |
| Niere | Th10–L1 | Leiste |
| Eierstöcke | Th12–L4 | Unterbauch beidseits |
Tabelle: Beispiele für Head’sche Zonen und Dermatome.
› Austritt von Lymphe und Blut in das Gewebe:
Wenn der Sog der Saugglocke über mehrere Minuten anhält, treten Lymphe, Eiweißmoleküle und auch Blutplättchen und -körperchen in das umgebende Gewebe aus. Wieviel Flüssigkeit austritt und wann das passiert, ist von verschiedenen Faktoren abhängig:
• Beschaffenheit der Haut
• Alter
• Saugstärke
• Behandlungszeit
• evtl. eingenommene Medikamente
Durch den Austritt von Blut und Lymphe werden Fress- und Abwehrzellen freigesetzt, um vor Ort „aufzuräumen“.
› Steigerung der Stoffwechselaktivität:
Durch den Druck auf die Haut am Rand der Saugglocke entsteht eine Minderdurchblutung (s. o.). Wenn die Saugglocke dann entfernt wird, kommt es zu einer plötzlichen Durchblutungssteigerung mit Erhöhung der Stoffwechselaktivität.
› Das kann man mit Cupping erreichen:
• Präventive Behandlung als Verletzungs prophylaxe
• verbessertes Hautbild
• Hautstraffung
• Verbesserung der Dehnfähigkeit
• örtlich verbesserte Durchblutung
• allgemein verbesserte Durchblutung
• damit Steigerung und Regulierung der Stoffwechselaktivität
• Aktivierung des Immunsystems
• Mobilisierung und Regeneration der Faszien
• damit mehr Bewegungsfreiheit
• Mobilisierung von alten/verheilten Narben
• Fernwirkung ausgehend von den Head’schen Zonen und den Dermato- men auf die dazugehörenden Organe
1.5 Worauf muss man vor und nach der Anwendung achten?
Das moderne Cupping kann sehr vielfältig eingesetzt werden. Durch die Materialeigenschaft des Silikons ist der Unterdruck im Cup nicht so groß wie in einem Glas. Trotzdem gibt es vor, während und nach der Anwendung einiges zu Beachten. Cupping wirkt durchblutungsfördernd und stoffwechselanregend, unter bestimmten Voraussetzungen sollte es deshalb nicht angewendet werden.
Hier sollte Cupping generell nicht eingesetzt werden (Kontraindikationen):
• spontane Blutungsneigung
• bei gerinnungshemmenden Medikamenten
• Bluterkrankungen