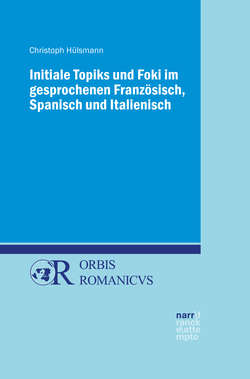Читать книгу Initiale Topiks und Foki im gesprochenen Französisch, Spanisch und Italienisch - Christoph Hülsmann - Страница 15
3.1 Informationsstruktur und Syntax
ОглавлениеDie – in generativen Ansätzen auch heute noch gültige – Annahme, dass jede Sprache eine syntaktisch festgelegte Basiswortfolge aufweist, blieb in der Sprachwissenschaft lange Zeit unwidersprochen. Dieser syntaxzentrierte Ansatz wurde jedoch nur bedingt der Feststellung gerecht, dass es offensichtlich Sprachen gibt, in denen auch die Grundwortfolge1 in erster Linie pragmatische Aspekte wie die „relative newsworthiness within the discourse“ (Mithun 1987, 325) reflektiert.2 Li und Thompson (1976, 460) schlugen in diesem Zusammenhang eine Klassifikation von Sprachen in vier Basistypen vor.
1 subjektprominente Sprachen (indoeuropäische Sprachen)
2 topikprominente Sprachen (Chinesisch)
3 sowohl subjekt- als auch topikprominente Sprachen (Japanisch)
4 weder subjekt- noch topikprominente Sprachen (Tagalog)
Während das Topik in topikprominenten Sprachen als eineindeutige ausdrucksseitige Entsprechung für die pragmatische topikale Relation angesehen wird und nicht von der Valenz des Verbs oder von semantischen Rollen abhängt, ist das Subjekt in subjektprominenten Sprachen „viel deutlicher in die Syntax eingebunden […] als das Topik“. (Sasse 1982, 268) Das initial auftretende Topik wurde in vielen Sprachen grammatikalisiert, das postprädikative Topik hingegen nur in wenigen. (cf. Primus 1993, 881) Syntaktisch basierte Sprachen weisen folglich eine relativ fixierte Wortstellung auf, wohingegen die Wortfolge pragmatisch basierter Sprachen eher flexibel ist.3 Dieser Umstand impliziert, dass nur in ersteren pragmatisch motivierte Verfahren der Umstellung stark markiert sind. (cf. Mithun 1987, 325)
Aus der Beobachtung, dass es auch in vielen als syntaxorientiert geltenden Sprachen möglich ist, Konstituenten mit einem gewissen informationsstrukturellen Status in einer bestimmten syntaktischen Position zu realisieren, in der sie ansonsten in der Regel nicht vorkommen, wurde in der Folge geschlossen, dass die Strukturierung von Information einen Sprecher dazu bringen kann (oder ihn gar dazu zwingt), von der kanonischen Wortfolge abzuweichen.4 Wie weit verbreitet heute die Annahme eines Einflusses der Informationsstruktur auf die Syntax ist, zeigt die hohe Zahl an Beiträgen zu Phänomenen wie Topikalisierungen, Fokusbewegungen und scrambling.5 (cf. Fanselow 2008, 398)
Die Tatsache, dass man anhand von funktionalen Kategorien formale Eigenschaften vieler Sprachen erklären konnte, stellte die in formaleren Ansätzen immer wieder postulierte Autonomie der Syntax weiter in Frage. (cf. Bolkestein 1993, 342) Eine Extremposition wird von Sasse (1982, 267) vertreten, der die Existenz einer autonomen syntaktischen Ebene verneint:
Die Sprache kennt keine autonome Ebene der Syntax gegenüber einer „Semantik“ und einer „Pragmatik“ […] Syntaktische Kategorien haben die Funktion, Inhalte und Darstellungsperspektiven zu bezeichnen. Hat eine syntaktische Erscheinung die Funktion, einen Inhalt zu bezeichnen, so sprechen wir von einer semantischen Funktion; hat sie die Funktion, die „Verpackung“ des Inhalts anzuzeigen, so sprechen wir von einer pragmatischen Funktion.
Die zunehmende Bedeutung der Pragmatik manifestiert sich darüber hinaus darin, dass nunmehr vermehrt auch für die Grundwortfolge von Sprachen in erster Linie funktionale Kriterien als ausschlaggebend angesehen werden.
Für Firbas (1971, 138) weisen Sätze in ihrer Basisabfolge in der Regel einen ansteigenden Grad an kommunikativer Dynamik auf, beginnend mit dem am wenigsten dynamischen Element am Satzbeginn, hin zum dynamischsten am Satzende.6 Givón (1988, 252) erklärt Wortstellungsvariationen von Sprachen anhand pragmatischer Kriterien mit folgendem Prinzip zum Schema in Abbildung 9: „Attend first to the more urgent task.“
Abb. 9: Ranking of topic-marking devices according to degree of topic predictability (Givón 1984a, zit. n. Givón 1988, 252)
Das Schema kann folgendermaßen erläutert werden: Ist das Topik einer Äußerung für den Hörer salient, fällt für den Sprecher die Notwendigkeit es zu nennen weg, sodass es gar nicht realisiert werden muss und dementsprechend ein Nulltopik (bzw. ein topic drop) angenommen werden kann. Ist das Topik salient, jedoch von geringerer Salienz als der Kommentar, ist es weniger dringend auszudrücken, sodass es dem Kommentar folgt. Ist die Notwendigkeit das Topik auszudrücken größer als jene zur Realisierung des Kommentars, wird es vor dem Kommentar genannt. Ist das Topik schließlich völlig unvorhersehbar, ist die Notwendigkeit, es auszudrücken am größten, sodass es alleine realisiert werden kann. (cf. Givón 1988, 252–253) Neben der relativen Vorhersagbarkeit (i) ist für Givón die relative Wichtigkeit (ii) der zweite entscheidende pragmatische Faktor für die Wortfolge. Wichtige Information wird vorangestellt.
1 relative predictability: ‚Given the preceding discourse context, less predictable information is fronted‘.
2 relative importance: ‚Given the thematic organization of the discourse, more important information is fronted‘. (Givón 1988, 275)
Abgesehen von der durchaus zu bemängelnden Operabilität des Begriffes Wichtigkeit ist der Zusammenhang zwischen Informationsstruktur und Syntax komplexer, als vielfach angenommen wurde. (cf. Gundel/Fretheim 2006, 185) Herring (1990) resümiert in ihrem Beitrag jene Prinzipien, denen ein Einfluss auf die Wortfolge in Äußerungen zugeschrieben wird. Die Prinzipien (i) und (ii) konkurrieren miteinander. Das Prinzip (ii) entspricht grosso modo Givóns Prinzipien der relativen Wichtigkeit und der relativen Vorhersagbarkeit. Das Prinzip (iii) berücksichtigt die Einbettung von Äußerungen in größere Diskurseinheiten. Das Prinzip (iv) schließlich deutet an, dass auch die Informationsstruktur bis zu einem gewissen Grad von den jeweiligen syntaktischen Eigenschaften einer Sprache abhängig ist. Es impliziert ebenfalls, dass die lange Zeit von Seiten der Funktionalisten als universal gültig postulierte Gliederung von Sprachen mit der Abfolge Topik vor Fokus nicht haltbar ist. (cf. Herring 1990, 163)
1 Gegebene Information vor neuer Information: Dieses Prinzip betrifft die Annahme, dass Äußerungen auf bereits Gegebenem aufgebaut und in der Folge neue Informationen hinzugefügt werden, die die Kommunikation vorantreiben.7
2 First things first: Nach diesem Prinzip geht jene Information, die am dringendsten ausgedrückt werden soll und die – ausgehend vom vorhergehenden Diskurs – als unerwartet eingeschätzt wird, weniger wichtiger Information voraus.8
3 Diskursikonizität: Dieses Prinzip besagt, dass Sätze mit dem beginnen, was im Diskurs bereits erwähnt wurde, und mit jenen Elementen enden, über die in der Folge gesprochen wird.
4 Wortstellung: Diesem Prinzip zufolge wird die Informationsstruktur durch die Basiswortfolge der jeweiligen Sprache bestimmt. VS-Sprachen tendieren eher zur Abfolge Fokus vor Topik im Gegensatz zu SVO- oder SOV-Sprachen. (cf. Herring 1990, 164)
Für Downing (1995) ist es eindeutig, dass es keinen Algorithmus gibt, der bei konkurrierenden Prinzipien die eine oder andere Wortfolge bestimmt. Gäbe es einen, wäre keine derart große typologische Variation zu beobachten:
The fact that different languages do exhibit different word order patterns suggests that different factors […] dominate the syntactic organization of different languages. On the other hand, the fact that many of these languages can be grouped into a limited number of frequently occurring types suggests that there may be some favored strategies for resolving the competition. (Downing 1995, 22)
Mereu (2009) zieht das Fazit, dass die Prinzipien (i) und (ii) universale Prinzipien der Informationsstruktur sind. Konfigurationale Sprachen sind eher syntaktisch orientiert und folgen in syntaktisch und pragmatisch unmarkierten Kontexten dem ersten Prinzip, in markierten Kontexten auch dem zweiten. Nicht konfigurationale Sprachen sind eher pragmatisch orientiert und folgen dem zweiten Prinzip.9 Dies impliziert, dass nicht konfigurationale Sprachen nicht unbedingt über eine Basiswortfolge verfügen.10 (cf. Mereu 2009, 94–95)
Primus (1993, 886) wiederum sieht, in Anlehnung an Hawkins (1990), nicht pragmatische Faktoren, sondern das syntaktische „Gewicht“ als primäres Kriterium für die Wortfolge an. Den Mehrwert ihres Zuganges rechtfertigt die Autorin folgendermaßen: „Whereas pragmatic accounts need several conflicting principles to capture the facts of topic-predication and focus-background placement11, the performance principles suffice to explain all the facts.“12 (Primus 1993, 887) Für Primus werden Topiks ganz einfach deshalb initial realisiert, da sie in der Regel weniger komplex, d.h. kürzer als der Kommentar sind. (cf. Primus 1993, 886) Ähnliches gilt für den Fokus. Während ein enger und damit kurzer Fokus eher vor einem langen Hintergrundausdruck realisiert wird, nimmt ein kurzer Hintergrundausdruck für gewöhnlich die Position vor einem weiten Fokus ein.13 (cf. Primus 1993, 889) Ein Fronting von prädikativen Elementen wie in (1)–(2) ist in der Konsequenz immer markierter als ein Fronting von leichterem Material, wie etwa von nominalen oder adverbialen Elementen wie in (3). (cf. Primus 1993, 890)
| (1) | dt. | (Was hast du gestern gemacht?) – ?[Mit Freunden ESSEN gegangen]F bin ich. |
| (2) | dt. | (Was hast du gestern gemacht?) – ??[Mit Freunden in ein teueres [sic] Restaurant ESSEN gegangen]F bin ich. |
| (3) | en. | He’ll NEVER do it [WILLINGLY]F. – [WILLINGLY]F he’ll NEVER do it.14 (Primus 1993, 890) |
Die Tatsache, dass Fokuspositionen existieren, die nicht ihrer Regel entsprechen, erklärt Primus nicht pragmatisch, sondern prosodisch oder syntaktisch. (cf. Primus 1993, 889) Die Autorin nimmt an, dass Sprachen mit einer rechtsperipheren Fokusposition, die gleichzeitig „the position of the rhythmically most conspicuous stress of the sentence“ (Primus 1993, 892) darstellt, dieses stress pattern generalisieren wollen und sich deswegen gegen eine Bewegung der fokalen Konstituente nach links wehren. So entspricht Satz (4) als Antwort auf die Frage Wem hast du das Geld gegeben? der Basiswortfolge des Deutschen, in der das Dativobjekt vor dem Akkusativ realisiert wird. Satz (5) ist akzeptabel, da hier zwar die Basiswortfolge verletzt wird, der Dativ aber nach rechts und damit in die Position, auf die im Deutschen der Satzakzent fällt, rückt. Als Antwort auf die Frage Was hast du dem Kassierer gegeben? ist Satz (6) sowohl auf syntaktischer als auch auf informationsstruktureller bzw. prosodischer Ebene als unproblematisch einzustufen, während hingegen Satz (7) für Primus insofern weniger akzeptabel ist, als hier sowohl gegen die Basiswortfolge als auch gegen die Fokuspositionsregel verstoßen wird. (cf. Primus 1993, 892)
| (4) | dt. | Ich habe [dem KASSIERER] das Geld gegeben. |
| (5) | dt. | Ich habe das Geld [dem KASSIERER] gegeben. |
| (6) | dt. | Ich habe dem Kassierer [das GELD] gegeben. |
| (7) | dt. | ?Ich habe [das GELD] dem Kassierer gegeben. (Primus 1993, 892) |
Neben pragmatischen, syntaktischen sowie prosodischen Kriterien werden noch weitere Faktoren zur Erklärung der Wortfolge von Sprachen herangezogen. Nach Gutiérrez-Bravo (2006) etwa sind die semantischen Rollen der Konstituenten für die (unmarkierte) Wortfolge verantwortlich.15 Ihm zufolge wird im Spanischen die präverbale Position von jener Konstituente besetzt, die in der von ihm vorgeschlagenen thematischen Hierarchie – hier in Abbildung 10 angeführt – am höchsten steht. Ein Agens besetzt demzufolge eher diese Position als ein Experiencer, ein Thema oder ein lokaler Ausdruck.
Abb. 10: Thematic hierarchy (Gutiérrez-Bravo 2006, 139)
Das Modell bietet den Vorteil, dass damit im Spanischen – und analog dazu im Italienischen – auch die (durchaus frequenten) Sätze von Typ (8), die sich aus einem Dativobjekt, einem psychologischem Verb und einem postverbalem Subjekt (OVS) zusammensetzen, als unmarkiert analysiert werden können.16 (cf. Gutiérrez-Bravo 2006, 139)
| (8) | sp. | A ella le gustaron los caballos. (Gutiérrez-Bravo 2006, 139) |
Wie dieser kurze Überblick verdeutlicht hat, entscheiden offensichtlich mehrere – je nach Sprache wohl unterschiedlich gewichtete – Faktoren über die bevorzugte lineare Abfolge von Konstituenten im Satz. Einzelsprachliche Analysen, die zwischen sprachenspezifischen und universalen Eigenschaften differenzieren, sind folglich unverzichtbar.17
Eine keinesfalls zu vernachlässigende Rolle spielt in diesem Zusammenhang auch die Prosodie, deren Interaktion mit der Informationsstruktur im folgenden Kapitel näher beschrieben werden soll. Im Zuge dessen werden einige grundlegende prosodische Kategorien und Termini eingeführt. Kapitel 3.3 wird sich dem Zusammenspiel zwischen der Prosodie und der Syntax widmen.