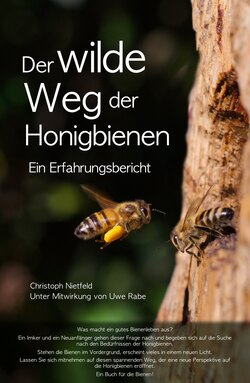Читать книгу Der wilde Weg der Honigbienen - Christoph Nietfeld - Страница 6
ОглавлениеZwei Neuanfänge(r)
Seit einigen Jahren hatte ich keine Bienen mehr, bis eines Morgens eine Kollegin in mein Büro kam und mir von ihrem Freund Uwe erzählte, der in seinem Garten gerne Bienen halten wollte. Da sie von meiner Zeit als begeisterter Imker wusste, fragte sie mich ohne Umschweife, ob ich mir vorstellen könne, Uwe ein wenig in Sachen Bienen zu helfen. Ich stimmte freudig zu. Bereits wenige Tage später fuhr ich gleich nach der Arbeit bei Uwe vorbei, denn er wohnte in der Nähe der Firma. Dabei ahnte ich noch nicht, dass diese Bekanntschaft dazu führen würde, selbst bald wieder Bienen zu haben.
Mein erster Kontakt zu den Bienen und zur Imkerei war in meiner Kindheit entstanden, als ich hin und wieder zu unserem Nachbarn gehen durfte, um dort Honig zu holen. Er hielt ein paar Bienenvölker. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie meine Mutter mir dafür immer eine von diesen Kunststoff-Taschen mitgab, die mich an Strandsandalen erinnerten. Die Tasche war blau und es passten genau zwei Honiggläser hinein. Bevor ich den Honig nach Hause tragen konnte, wurden die Gläser sorgfältig verpackt. Unser Nachbar wickelte sie liebevoll in Zeitungspapier ein. Es glich einem heiligen Ritual. Sorgfältig wurden die Honiggläser anschließend in meiner blauen Tasche verstaut. Danach durfte ich mir manchmal noch die Bienen anschauen oder sogar bei der Arbeit an den Bienenkästen etwas mithelfen. Meine Freundschaft mit den Bienen verlief nicht immer ganz schmerzfrei.
Als ich elf Jahre alt war und wieder einmal zusammen mit unserem Nachbarn die Bienen am Bienenstand beobachtete, klopfte er mir auf die Schulter und sagte: „Du kannst dir eins aussuchen.“ So kam ich zu meinem ersten eigenen Bienenvolk und unser Nachbar wurde mein Lehrmeister. Über die Jahre brachte er mir den Umgang mit den Bienen bei und zeigte mir, wie man Honig erntet. Später hatte ich meinen eigenen Bienenstand und pflegte durchschnittlich drei Bienenvölker. Etwa fünfzehn Jahre lang hielt ich so meine Bienen, klassisch, in Magazinbeuten. Hätte mir damals jemand gesagt, dass bei der Haltung der Honigbienen dringend ein Wandel notwendig ist, hätte ich das nicht verstanden. Ich sah mein Hobby als einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Bienen. Also warum sollte ich etwas an der Art und Weise der Haltung verändern? Ich hatte zwar abschreckende Bilder von Imkerei in industriellem Maßstab gesehen, doch beruhigte ich mich damit, dass mein Tun davon weit entfernt wäre. Zudem spielte sich der relevante Anteil dieser Honigproduktion auch noch auf einem anderen Kontinent ab, sodass die Problematik allein aufgrund ihrer örtlichen Entfernung nicht wirklich in mein Blickfeld rückte. Was ging es mich an?
Wir wissen, dass es die Bienen, Honig- wie auch Wildbienen, heute nicht leicht haben. Die Medien berichten regelmäßig über Bienen gefährdende Pestizide und über Parasiten, allen voran die Varroamilbe, die speziell den Honigbienen zu schaffen macht. Glücklicherweise gibt es den Imker, der seine schützende Hand über die Bienen hält und sein Bestes tut, um größeren Schaden abzuwenden, so wie ich es viele Jahre versucht hatte. Ob die Bienen das ebenso empfanden, fragte ich mich dabei nie. Vor einigen Jahren hatte ich nach mehreren berufsbedingten Umzügen meine Bienen an meinen Vater abgegeben, der sie zum Einstieg in seine Rente übernahm. Erst dieser Abstand ermöglichte es mir, die Bienenhaltung mehr und mehr aus einer neuen Perspektive zu betrachten.
Was wusste ich tatsächlich über das Leben der Bienen? Mit ein paar einstudierten Handgriffen war es mir möglich gewesen, mir ihre Verhaltensweisen für mein Ziel, die Honigernte, zunutze zu machen, ohne dass ich dabei viel über ihre Bedürfnisse wissen musste. Nach dem Motto: „Wenn ich dies tue, dann passiert das und das …“ Es handelte sich dabei im Wesentlichen um Reaktionen des Bienenvolkes auf meine Eingriffe, die ich durchführte, um eine schöne Honigernte zu bekommen. Den Willen der Bienen berücksichtigte ich dabei nicht. Wie auch? Ich wusste kaum etwas über ihn. Das war sie, die „gute imkerliche Praxis“. Mit tatsächlichem Wissen über die Bienen hatte das – zumindest muss ich das heute für mich so sagen – wenig zu tun. Nach und nach erhärtete sich mein Verdacht, dass es nicht nur – wie ich bisher geglaubt hatte – die intensive Landwirtschaft und die Varroamilbe waren, die den Bienen schadeten, sondern auch ich selbst, als Mensch, der seine Bienen ausschließlich zur Honiggewinnung hielt. Das war für mich eine schwierige Erkenntnis, und es fiel mir alles andere als leicht, mir dies einzugestehen. Schlussendlich hat meine (Ego-)Krise mit der konventionellen Imkerei einen Bewusstseinswandel angestoßen: Welche Bedürfnisse haben die Bienen eigentlich, wenn man das vordergründige Ziel des Imkers, den Honig, einmal außen vor lässt?
Uns als Autoren ist es in diesem Buch wichtig, von den Begegnungen, Gesprächen und Ereignissen zu erzählen, die unsere Einsicht prägten, dass es mit der Imkerei nicht weitergehen kann wie bisher. Um zu verstehen, warum ein Wandel in der Art und Weise der Bienenhaltung unausweichlich ist, möchten wir auch für die, die keine Imker sind, einen Einblick in die konventionelle Imkerei geben. Also in jene Sichtweise der Dinge und daraus resultierende Handlung, mit der ich, Christoph, mit dem Thema groß geworden bin.
Obwohl Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen und Erfahrungsberichte Gleichgesinnter, die mir auf diesem Weg begegnet sind, meine persönliche Darstellung abrunden, erhebe ich keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit oder auf wissenschaftliche Evidenz. Zwar bleiben Informationen aus aktuellen wissenschaftlichen Quellen bei der Betrachtung nicht außen vor, jedoch stützt sich das Geschriebene stets auch auf meine eigenen Beobachtungen, Schlussfolgerungen und Ideen, die natürlich von individuellen Überzeugungen oder auch Wünschen geprägt sind. In einer durch die Brille der Wissenschaft entzauberten Welt scheinen solche persönlichen Erkenntnisse wertlos zu sein. Ist es deshalb aber sinnlos, sie aufzuschreiben?
Ich möchte meine Erfahrungen mit Interessierten teilen. Nicht, weil ich sie für die letzte Wahrheit halte, sondern weil ich sie – hier und jetzt – in einer Zeit des Wandels für wertvoll erachte. Denn sie haben einen Wandel in mir angestoßen. Es sind mitunter nicht Forschungsergebnisse, die unser persönliches Verhalten verändern, sondern es sind die eigenen Erfahrungen und Erkenntnisse, die eine Veränderung hervorrufen können. Deswegen halte ich es für außerordentlich wichtig, dass jeder Mensch seine eigene Wahrnehmung entsprechend wertschätzt. Leider gelang mir das oft selber nicht. Ich hörte nicht auf meine innere Stimme, nicht auf mein Bauchgefühl, denn mir war etwas anderes beigebracht worden: Nur objektive Beweise haben eine Daseinsberechtigung. Somit wartete ich bei meinen „Verdachtsmomenten“ oft vergeblich auf „Beweise“, die aus der Wissenschaft kommen sollten. In der Zwischenzeit durfte ich allerdings bereits Menschen kennenlernen, die ähnlich dachten und fühlten wie ich. Dies ermutigte mich, aufzuschreiben, wie sich für mich ein neuer Weg MIT den Bienen öffnete.
Zu den Menschen, die in Sachen Bienen ähnlich unterwegs waren wie ich, gehört Uwe. Das stellte sich schon bei unserem ersten Treffen heraus. Uns einte und eint die Überzeugung, dass Veränderungen in der Bienenhaltung unumgänglich sind. So tasteten wir uns an die – wie auch immer gearteten – möglichen Lösungsansätze für die rund um die Bienenhaltung bestehenden Probleme heran. Uwe näherte sich dem Ganzen – kurz gesagt – über die Sichtweise der wesensgemäßen Bienenhaltung. „Wesensgemäß“ bedeutet, dass man die Bedürfnisse der Bienen in den Vordergrund stellt. Die Biene wird nicht wie in der konventionellen Imkerei dem Ziel der Honiggewinnung untergeordnet. Als alter „Bienen“-Hase bekam ich die Gelegenheit, die imkerliche Tätigkeit in einem zweiten Anlauf aus diesem neuen Blickwinkel zu betrachten. Als wir uns Ende April zum ersten Mal sahen, tobte das Leben am Flugloch von Uwes Bienenkiste. Wenige Tage vor unserem Treffen hatte er einen Bienenschwarm bekommen und ihn dort einlogiert. Uwe strahlte vor Freude darüber, ein Bienenvolk in seinem Garten beherbergen zu dürfen. Wir machten es uns direkt neben der Bienenkiste gemütlich und beobachteten die Aktivitäten am Flugloch. Das junge Bienenvolk befand sich gerade im Aufbau. Für uns sichtbar waren die am Flugloch ein- und ausfliegenden Bienen, die Nektar als „Treibstoff“ und Pollen als „Kraftfutter“ für das heranwachsende junge Bienenvolk in der Umgebung sammelten. Für uns verborgen, im Inneren der Bienenkiste, bildete sich gerade der „Bien“ heraus: Es wurden Abertausende von Wachsplättchen geschwitzt, aus denen die Bienen das neue Wabenwerk aufbauten, das Innere der Bienenbehausung wurde mit Propolis, einem Baum- und Blattharz, ausgekleidet und damit sozusagen „desinfiziert“, es wurden Vorräte angelegt und sicherlich begann die Königin bald mit der Eiablage, so hofften wir zumindest. Eine für uns, und vermutlich auch für die Bienen, aufregende Zeit. Wir sprachen noch lange über die Bedürfnisse der Bienen und darüber, was Uwes Motivation war, seinen Garten mit ihnen zu teilen.
Die Bienenkiste für „seine“ Bienen hatte Uwe selbst gebaut. Er war in den Monaten zuvor auf die wesensgemäße Bienenhaltung aufmerksam geworden und hatte sich in einem Anfängerkurs mit dem nötigen Grundwissen vertraut gemacht. Er hatte sich von diesem Konzept, das unter anderem mit dem Schwarmtrieb arbeitet, sofort angesprochen gefühlt und sich mit gutem Gefühl auf diese Art der Bienenhaltung eingelassen. „Mehr Bienenbetreuer als Imker“ – das passte gut zu seinen Vorstellungen. Dabei hatte er eine mögliche Honigernte – das Gesprächsthema Nummer eins unter Mitmenschen, mit dem man sich unvermeidlich konfrontiert sieht – zum ungläubigen Erstaunen des Einen oder Anderen erst einmal hintenangestellt. „Wofür machst du das dann mit den Bienen, wenn du keinen Honig ernten willst?“, war eine der beliebtesten Fragen von interessierten Freunden und Bekannten gewesen, auf die er zunächst nicht so richtig eine Antwort finden konnte. Erst gemeinsam ist uns später eine gute Gegenfrage in den Sinn gekommen: „Wir hängen Nistkästen für Vögel auf, aber essen wir deshalb auch Meiseneier zum Frühstück?“
Während wir weiter die Sonne genossen und den Bienen bei ihrer Arbeit zuschauten, berichtete Uwe von einem Treffen mit den örtlichen Imkern, dem er beigewohnt hatte. Es war bestes Bienenflugwetter gewesen an diesem Tag. Die Bienenstöcke standen gleich neben einem blühenden Rapsfeld in regelmäßigem Abstand. Die Imker hatten es sich an einem mitgebrachten Biertisch gemütlich gemacht. Es war Kaffeezeit und mit einem verschmitzten Lächeln wurde frisch gebackener „Bienenstich“ serviert. Für Uwe, der heute zu Gast sein durfte, gab es dazu jede Menge Informationen und Tipps zur Bienenhaltung. Ein rundum sehr freundlicher Empfang für den potenziellen Neueinsteiger. Der ganze Stolz der Imkertruppe war eine selbst entwickelte Trachtwaage mit automatischer Datenfernübertragung. Sie wurde gerade im Feldversuch getestet. Als Tracht bezeichnet man das Angebot an Nektar, Honigtau und Pollen, den die Bienen in den Bienenstock eintragen. Von zu Hause aus ließe sich mit der Waage online verfolgen, wie sich das Gewicht der Bienenbeute durch den Eintrag von Nektar verändere, am liebsten natürlich nach oben in Richtung einer guten Honigernte. Was für eine verlockende Vorstellung! Uwe zeigte auch hierfür sein Interesse, wie es sich für einen Neuling unter Experten nun einmal gehört. Innerlich kamen – wie er mir erzählte – allerdings zum ersten Mal Zweifel auf, ob das wohl der richtige Weg sei.
„Mit welcher Beute willst du denn imkern?“, erkundigten sich die Imker beim Neuling. „Ich möchte meine Bienen in einer Bienenkiste halten!“, hatte Uwe geantwortet. Ein kurzes, aber deutlich erkennbares Schweigen folgte. Vielleicht eine Schrecksekunde auf imkerlicher Seite? Oder kannte man das Konzept der Bienenkiste nicht oder nur vom Hörensagen? Wie auch immer: „Die Bienenkiste ist nicht für die Haltung von Bienen geeignet“, einigten sich die Imker schnell. Verschiedenste Gründe wurden aufgeführt: Eine ordnungsgemäße Behandlung gegen die Varroamilbe sei nicht möglich, die Überwinterung sei schwierig, die Wabenhöhe sei zu kurz, das Volumen zu klein und nicht veränderbar, das Format nicht üblich, überhaupt ließe sich die Kontrolle des Bienenvolkes nicht wie erforderlich durchführen. Der Imker wäre in gewissem Maße seiner Kontrollfunktion über das Bienenvolk beraubt. Das könne nicht funktionieren! Und Uwe sollte die Wahl seiner Bienenbehausung noch einmal gründlich überdenken!
Erst als wir bei unserem Treffen neben besagter Bienenkiste in Uwes Garten saßen und die Situation noch einmal mit Abstand rekapitulierten, wurde uns beiden klar, dass in dieser Situation seinerzeit schlichtweg zwei Welten aufeinander getroffen waren: die des Honigernte-Profis mit der des angehenden Bienenbetreuers mit der Bienenkiste, des Bienenschwarm-Verursachers, des vermeintlichen Varroamilben-Verbreiters, von einem dieser komischen Spinner, die die Imkerei in Gefahr bringen könnten und von denen man in letzter Zeit zunehmend gehört hatte. Zu diesem Zeitpunkt lagen die traditionelle Imkerei und die sich gerade erst in der Breite entwickelnde wesensgemäße Bienenhaltung tatsächlich in entscheidenden Fragen zur „richtigen“ Bienenhaltung noch recht weit auseinander. Das war am Rapsfeld bei „Bienenstich“ und Kaffee für beide Seiten, für Uwe und die Imker, zu spüren gewesen. Am Ende des Nachmittags hatte man sich freundlich verabschiedet, sich gegenseitig eine gute Honigernte gewünscht und sich stillschweigend darauf geeinigt, getrennte Wege zu gehen. Für Uwe war das zunächst eine Enttäuschung. In den Tagen danach hatte sich Unsicherheit in seine Gedanken gemischt. Hatte er, der Anfänger, nun tatsächlich den „richtigen“ Weg eingeschlagen?
Wir beide kamen im Laufe unseres Gespräches darauf zu sprechen, dass es den allgemeingültig zu jeder Zeit und für alle „richtigen“ Weg ohnehin nicht gibt. Von den konventionellen Imkern war, zumindest was Uwes neuen, wesensgemäßen Zugang zu den Bienen betraf, derzeit wenig Unterstützung zu erwarten. Und so war er froh, sich mit einem gleich gesinnten, aber dennoch in der konventionellen Imkerei erfahrenen Menschen auszutauschen. So bestärkten wir uns gegenseitig darin, unserem Bauchgefühl zu folgen.
Mit der Bienenkiste hatte Uwe seinen Bienen nicht einfach nur irgendeine beliebige (Bienen-) Kiste gezimmert, sondern es handelt sich – wie Sie sicher vermuten werden – um einen feststehenden Begriff für eine alternative Bienenbehausung. Entwickelt wurde die Idee der Bienenkiste von Imkermeister Thomas Radetzki vom gemeinnützigen Verein Mellifera e. V. und vom Projektleiter des Bienenkistenprojektes Erhard Maria Klein. Das damit verbundene Konzept ist, Bienen mit einem verhältnismäßig geringen Aufwand halten zu können. Bei der traditionellen Hobby-Imkerei zur Honiggewinnung bedarf es einer recht umfangreichen Mindestausstattung und einem Mindesteinsatz an jährlicher Arbeitszeit. Das Konzept „Bienenkiste“ ist ein Kompromiss. Es wird weniger Material und Zeit gebraucht. Der Fokus verschiebt sich dahingehend, dass die Bedürfnisse des Biens mehr Berücksichtigung finden und im Gegenzug die Interessen des Imkers mehr in den Hintergrund rücken. Die Ernte von Honig steht nicht im alles überschattenden Vordergrund – wenngleich es auch möglich ist, der Bienenkiste Honig zu entnehmen, sobald sich das Bienenvolk entsprechend entwickelt hat. Laut beiden Initiatoren des Projektes eignet sich diese Form der Bienenhaltung für Menschen, die aus Freude an der Natur und für den Eigenbedarf etwas Honig ernten wollen.1 Die Bienenkiste ist keine vollständige Neuerfindung der beiden Bienenfreunde, sondern baut auf der langjährigen Tradition des Krainer Bauernstocks auf. Sie wurde an die Bedürfnisse der zeitgemäßen Bienenhaltung angepasst, bei der heutzutage eine funktionierende Behandlung gegen die Varroamilbe unumgänglich ist. Der Verein Mellifera e. V. war und ist ein entscheidender Wegbereiter für die wesensgemäße Bienenhaltung.
Bienenkiste hin – Bienenkiste her. Über Bienenhaltung und die damit verbundenen unterschiedlichen Betriebsweisen wird unter Imkern schon so lange gestritten, wie es die Imkerei gibt. Entscheidend bei dem Konzept der wesensgemäßen Bienenhaltung – und dazu zählt, wie beschrieben, die Bienenkiste – ist, dass hier dem Wohl der Bienen ein höherer Stellenwert eingeräumt wird und damit einhergehend das Honig-Interesse des Imkers freiwillig zurückgefahren wird. Eine kleinere Honigernte zum Wohl der Bienen? Nun gut, das mag für die „Wesensgemäßen“ unter den Bienenhaltern ein durchaus gangbarer Weg sein, für Hobbyimker, die nicht vom Honigertrag ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen. Der Ansatz „Imkern ohne Honig“ ist für viele „alte Hasen“ sicherlich erst einmal schwer nachvollziehbar, zumal der Begriff „Imkern“ neben der eigentlichen Bienenhaltung in unserem gewohnten Denken auch stets mit einer Honigernte in Verbindung gebracht wird. Es ist nach meinem Empfinden jedoch dieser kleine, aber entscheidende Schritt zu einer heilsamen Veränderung. Er dient dazu, sich aus den Zwängen zu befreien, die sich aus dem alten, alleinigen Ziel einer Honigernte nun einmal zwangsläufig ergeben. Er ermöglicht die Erkundung neuer Wege. Die innere Loslösung von der Notwendigkeit eines Ertrags schafft Raum für einen Wandel. Unser Blick öffnete sich für die eigentlichen Bedürfnisse der Honigbienen. Und dieser Blick war und ist für uns längst überfällig angesichts der in den letzten Jahren immer wiederkehrenden Schlagzeilen, dass es den Honigbienen so schlecht ginge.
Die Bienenkiste ist also ein alternatives Bienenhaus, das sich von denen konventioneller Imker in vielen Bereichen unterscheidet. Aber was genau ist denn nun eigentlich der Unterschied zwischen Uwes selbst gebauter Bienenkiste und einer konventionellen Bienenbehausung? Meine Bienen wohnten einst in Segeberger Kunststoffbeuten. Die Magazinbeute besteht aus mehreren Etagen, die man Zargen nennt. Je nach Platzbedarf lässt sich mit ihnen der Wohnraum für die Bienen beliebig vergrößern oder verkleinern. Die Zargen, der Boden und auch der Deckel der Beuten bestehen jeweils aus festem Styropor. In die Zargen werden senkrecht kleine Rahmen gehängt – auch Rähmchen genannt –, mit Wachsplatten, die man in der Imkersprache als „Mittelwände“ bezeichnet. Nachdem die Bienen darauf ihre Zellwände errichtet haben, bilden Wachsplatte beziehungsweise Mittelwand und Rähmchen zusammen eine Wabe. Die Rähmchen ermöglichen es, die Waben zu jeder Zeit herauszunehmen. Diese Bauart wird Mobilbau genannt und bietet dem Imker eine größtmögliche Flexibilität bei der Handhabung der Bienenvölker. Die Rähmchen können zur Kontrolle entnommen und angeschaut werden. Ebenso lassen sie sich für die Ernte bequem entnehmen und nach dem Schleudern des Honigs wieder zurückhängen.
Die Bienenkiste hingegen ist eine aus Holz gebaute Ein-Raum-Beute. Das heißt, das Bienenhaus hat eine feste Größe, ohne dass es sich in vertikaler Richtung durch das Aufsetzen einer Zarge erweitern lässt. Lediglich in horizontaler Richtung lässt sich etwa ein Drittel des Gesamtvolumens mithilfe eines Brettes vom Rest des Wohnraumes abtrennen beziehungsweise öffnen. Weiterhin gibt es in einer Bienenkiste keine Rähmchen, sodass im Normalfall nicht vorgesehen ist, einzelne Waben zu entnehmen, was dem sogenannten Stabilbau entspricht. Somit können die Bienen weitestgehend ungestört in ihrem Haus wohnen. Aus den baubedingt geringen Eingriffsmöglichkeiten ergibt sich bei der Bienenkiste bzw. allgemein beim Stabilbau im Vergleich zur Magazinbeute eine wesensgerechtere Bienenhaltung. Aus Sicht der klassischen Imkerei wird diese Art der Bienenhaltung jedoch mehrheitlich kritisch gesehen, weil ohne die Kontrolle der Bienen, d. h. z. B. die Entnahme der Rähmchen, eine Gesunderhaltung des Volkes unmöglich erscheint. Die aus meiner Sicht unbegründete Angst, dass durch eine Verbreitung der Bienenkisten zunehmend Krankheiten unter den Bienenvölkern um sich greifen, lässt viele konventionelle Imker dieser Idee skeptisch gegenüberstehen. Oder müsste man eher von Unsicherheit gegenüber etwas Neuem sprechen, das sich da insgesamt in der Bienenhaltung abzeichnet?
Über Bienenkrankheiten sprach ich mit Uwe bereits bei unserem ersten Treffen, das vor allem der gegenseitigen Bestärkung diente. Auch und vor allem über die Varroamilbe, die den Bienen zu schaffen machen konnte. Die Gespräche, die er bisher dazu mit Imkern geführt hatte, waren für ihn wenig erbaulich gewesen. Die meisten waren wie gesagt der Meinung, dass es unmöglich sei, ein Bienenvolk in einer Bienenkiste vernünftig gegen die Varroamilbe zu behandeln. Sie hielten es außerdem für fraglich, ob Bienen in einer solchen Kiste überhaupt durch den Winter gebracht werden konnten. Dabei zeigte die Erfahrung der Bienenkisten-Initiatoren, dass beides, Varroabehandlung und Überwinterung, mit der Bienenkiste sehr wohl möglich war. Schlimmer noch als die voreilige Ablehnung war für Uwe aber der Vorwurf, dass mit der Bienenkiste und dem vermeintlich unsachgemäßen Umgang mit der Varroamilbe die Bienenvölker benachbarter Imker gefährdet würden. Es half Uwe, dass ich der Bienenkiste und seinen Ideen gegenüber offen war, obwohl ich früher konventionell geimkert hatte. Aus meiner Perspektive bot die Bienenkiste sogar entscheidende Vorteile gegenüber der konventionellen Imkerei – aber dazu später mehr.
Während des gesamten Gesprächs waren die Bienen um uns weiter ein- und ausgeflogen. Da die Sonne nun schon langsam unterging, machte ich mich auf den Weg nach Hause. Die ganze Bahnfahrt über freute ich mich über das beseelende Gespräch mit Uwe. Mich hatte vor allem Uwes Einstellung beeindruckt, Bienen in seinem Garten beherbergen zu wollen, ohne dafür eine Gegenleistung in Form von Honig zu erwarten.
Einige Wochen später trafen wir beide uns wieder an seiner Bienenkiste. Uwe hatte mittlerweile eine kleine Bank neben dem Flugloch aufgestellt. Somit saßen wir auf der Bank in der Frühlingssonne und konnten uns mit direktem Blick auf die Bienen über Selbige unterhalten. Es wirkte auf mich wie ein gemeinsames Gespräch in einer großen Runde mit den Bienen. Ein schöner Platz, an dem wir noch viele weitere, anregende Gespräche über die Bienen führen sollten. In der kurzen Zeitspanne, die zwischen unserem letzten und dem jetzigen Treffen vergangen war, war ich mit meiner Frau und unserem Sohn umgezogen. Wir wohnten nun in unmittelbarer Nähe zu meinem Arbeitsplatz. Dabei hatten wir das Glück, von einer Wohnung ohne Garten nun in eine Wohnung mit Gemeinschaftsgarten gezogen zu sein. Damit rückte für mich nun die Möglichkeit, selbst (wieder) Bienen zu beherbergen, in greifbare Nähe. Uwe sah das sofort: „Dann ist doch jetzt auch für dich eine Bienenkiste interessant!“ Darüber musste ich nachdenken. Sollte sich für mich jetzt tatsächlich wieder ein Weg ergeben haben, Bienen zu halten?
Christoph ohne Bienen, das war lange Zeit ungewöhnlich gewesen. Mittlerweile hatte ich mich jedoch damit abgefunden, keine Bienen mehr zu haben. Würde ich jetzt noch einmal damit anfangen? Ein heimlicher Wunsch von mir war es sicherlich gewesen, irgendwann wieder einmal Bienen zu haben. Aber wirklich gewagt, nur daran zu denken, hatte ich bisher noch nicht. Doch jetzt gab es tatsächlich diese neue Möglichkeit für mich. Aber war eine Bienenkiste die Behausung, die ich mir für meine Bienen dann vorstellte? Klar war mir nur Eines: Es sollte keinesfalls wieder eine klassische Magazinbeute sein. Zunächst einmal scheute ich den materiellen und zeitlichen Aufwand, der mit dieser Art der Bienenhaltung einherging. Ich wollte mir diese ganzen Sachen nicht anschaffen und hatte auch gar keinen Platz für die Lagerung von Zargen, Rähmchen und Co. Aber das war es nicht allein. Ich hatte mir hin und wieder die Frage gestellt, ob es vielleicht sinnvoll wäre, statt zeitaufwendiger Eingriffe in das Bienenleben, den Bienen mehr Freiraum zu geben. Das würde mir nicht nur die zahlreichen Imkergriffe über das Jahr hin ersparen, sondern den Bienen vielleicht sogar guttun? Ich war mir darüber zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Klaren. Mir wurde jedoch zum ersten Mal bewusst, wie weit ich mich gedanklich schon von meinen Wurzeln, der konventionellen Imkerei, entfernt hatte. Wann genau das anfing, kann ich nicht genau sagen. Aber jetzt gab es kein Zurück mehr, das war mir klar.
Als ich an diesem Abend im Bett lag und über das Gespräch mit Uwe nachdachte, schoss mir wie ein Geistesblitz eine Idee durch den Kopf: Eine Klotzbeute! Was für ein großartiger Moment, voller Energie und Licht! Ich denke, solche Momente, in denen einem eine Idee einfach so zufällt und sich als die einzig richtige Möglichkeit anfühlt, kennt jeder. Dabei hatte ich über die Idee in der Zeit, als ich noch Bienen hatte, schon einmal nachgedacht. Damals spielte ich mit dem Gedanken, mir neben den Magazinbeuten eine Art Klotzbeute zu bauen. Unter einer Klotzbeute versteht man in der Imkersprache einen ausgehöhlten Baumstamm, in dem ein Bienenvolk leben kann. Eine Klotzbeute entspricht also eigentlich fast der natürlichen Bienenbehausung, denn auch in freier Wildbahn leben Bienen in hohlen Baumstämmen. Der (fast) einzige Unterschied ist, dass der hohle Teil des Baumstammes herausgesägt und zum Imker nach Hause geholt wird. Damals war meine Motivation noch nicht gewesen, den Bienen eine natürliche Behausung zu bauen, sondern ich dachte, dass es einfach schön aussehen würde, wenn Bienen in einen Baumstamm ein- und ausfliegen. Intuitiv war es zwar schon einmal ein guter Ansatz gewesen, doch hatte ich den Baumstamm so gestalten wollen, dass ich Rähmchen in ihn hineinhängen konnte, um ihn konventionell zu nutzen. Das Projekt scheiterte seinerzeit, weil ich keinen Baumstamm in der passenden Größe gefunden hatte. Jetzt stand nicht mehr die Absicht, Honig mit der Klotzbeute zu ernten, im Vordergrund und die alte Idee schwirrte wieder in meinem Kopf herum. Ich konnte gar nicht verstehen, warum diese Idee bei mir in Vergessenheit geraten konnte und ich nicht schon während des Gesprächs mit Uwe darauf gekommen war. Nein, sie fiel mir genau in diesem Moment ein! Ich fühlte mich von der Idee wie getragen. An Einschlafen war nicht zu denken. Meine Gedanken kreisten darum, wie ich das Projekt „Klotzbeute“ realisieren konnte. Dass sich die Ereignisse bereits in den nächsten Tagen überschlagen sollten, ahnte ich dabei noch nicht.
Als ich einige Tage später eine Radtour unternahm, um meine neue Umgebung zu erkunden, entdeckte ich in einem nahe gelegenen Waldstück einen Holzstapel, auf dem ein hohler Baumstamm lag. Ich hielt natürlich sofort an und begutachtete den Fund. Er übte eine unheimliche Anziehungskraft auf mich aus, vielleicht hatte ich ihn genau deshalb gefunden. Ich glaubte es kaum, aber der Baumstamm war perfekt für meine Klotzbeute geeignet. Das konnte kein Zufall gewesen sein. Am liebsten hätte ich ihn sofort mitgenommen, aber er wog bestimmt seine hundert Kilo, sodass ich ihn mir nicht einfach über die Schulter werfen konnte. Außerdem war mir bei aller Euphorie klar, dass ich erst einmal klären musste, wem der Wald und das Holz überhaupt gehörten, bevor ich mir etwas davon „in die Tasche steckte“. Mit diesen Gedanken im Kopf und klopfendem Herzen musste ich den Baumstamm also vorerst zurücklassen.
Am darauffolgenden Abend wollte ich eigentlich nur Kirschen pflücken gehen. Nicht weit von unserer Wohnung entfernt, hatte ich einen Baum entdeckt, der fürchterlich köstliche Kirschen trug. Der Baum befand sich an einem Weg, mitten auf einem Hügel mit einem herrlichen Blick hinunter ins Tal. Unter ihm stand eine Bank. Ich kletterte mit ein paar schwungvollen Griffen den Baum hinauf, denn das hatte ich als Kind ausgiebig geübt. Als ich im Baum saß und gerade die ersten Kirschen naschte, fragte plötzlich jemand: „Stört es dich, wenn ich dein Fahrrad beiseitestelle und mich auf die Bank setze?“ Ich schaute nach unten und antwortete: „Stört es dich, wenn ich weiter Kirschen pflücke?“ Als ich den Baum heruntergeklettert war, kamen die freundliche Bankbesetzerin und ich ins Gespräch und ich fand heraus, dass sie in der Nähe mehrere Bienenvölker hatte und diese wesensgemäß hielt. Was für ein wunderbarer Zufall! Der neu eingeschlagene Weg schien sich zu verdichten und damit seine Anziehungskraft. Ich war gespannt, was als Nächstes passieren würde.
Nun musste ich schnellstmöglich herausfinden, wem der Wald und das Holz gehörten. Da die Welt ja bekanntlich sehr klein ist und ich mit meiner Familie hier offensichtlich auf dem Dorf gelandet war, stellte sich nach kurzer Zeit heraus, dass der Besitzer des Waldes der Nachbar der Kollegin war, die auch den Kontakt zu Uwe hergestellt hatte. Das Holz gehörte wiederum seinem Pächter, dessen Putzfrau mit dem Schwager meiner Kollegin verbandelt war … O. k., Scherz beiseite! Ich traf mich also nach einem kurzen Telefonat am Holzstapel mit dessen Besitzer. Er stellte sich mir als Oliver vor und war bereit dazu, mir etwas von seinem Holz zu verkaufen. Aber mehr noch: Da ich nicht über die nötigen Transportkapazitäten verfügte – wir selber fuhren einen Kleinwagen ohne Anhängerkupplung –, war er sogar bereit, den Baumstamm zu mir nach Hause zu fahren.
Begrenzt wurde die Länge „meines“ Stammes nur durch die Größe des Kofferraums von Olivers Auto, denn dieses konnte nur etwa 1,40 Meter fassen. Doch das Fassungsvermögen von Olivers Kofferraum und meine Vorstellung davon, wie hoch die Klotzbeute sein sollte, passten auch irgendwie gut zusammen. Oliver sägte mir mit seiner Kettensäge also den unteren Teil des Baumstammes ab und transportierte ihn mit meiner Hilfe in seinem Auto auf unseren Hinterhof. Mit vereinten Kräften bugsierten wir den Baumstamm aus dem Auto, den wir nicht einmal zu zweit im Ganzen anheben konnten. Immer wieder mussten wir den Stamm daher gemeinsam an einer Seite anheben, hinstellen und wieder hinlegen. Nur so konnten wir ihn bewegen.
Als der Baumstamm endlich an der Stelle unseres Hinterhofes lag, die ich für ihn vorgesehen hatte, unterhielt ich mich noch einige Zeit mit Oliver. Er war neugierig, was ich mit dem Baumstamm anstellen wollte: „Kunst?“, fragte er. „Nein, Bienen!“, antwortete ich. Es stellte sich heraus, dass auch er in vergangenen Tagen Bienen gehalten hatte. Oliver konnte sich nur schwer vorstellen, dass es möglich sein könnte, Bienen in einem Baumstamm zu halten. Auf jeden Fall müsse der Stamm unten offenbleiben, sonst würde er aufgrund des entstehenden Kondenswassers im Inneren schimmeln, ganz zu schweigen von der Behandlung gegen die Varroamilbe, die er berechtigterweise für unmöglich hielt. Oliver wünschte mir trotzdem viel Glück und Spaß mit dem Baumstamm und fuhr davon. Da lag er nun, der Baum für meine Klotzbeute. Da war allerdings noch ein kleines Problem zu klären: Was sagen unsere Garten-Mitbenutzer und mein Vermieter zu dem Baumstamm auf ihrem Hof und zu meiner Idee, in diesem Bienen wohnen zu lassen? Ich hätte sie gerne gefragt, bevor ich den Baumstamm auf den Hof legte. Aber während ich den großen Fang machte, waren sie im Urlaub und ich wollte das gute Stück schnellstmöglich in Sicherheit bringen, bevor das Holz einem Kaminbesitzer zum Opfer fiel. Somit hatte ich nun bereits Tatsachen geschaffen, zwar waren noch keine Bienen eingezogen, aber es lag immerhin schon einmal ein großer schwerer Baumstamm auf dem Hinterhof, den man nicht mal eben an die Seite schaffte und der den Eindruck vermittelte, dass ich es ernst meinte oder dass ich gar nicht erst vorgehabt hätte, unsere Nachbarn um ihr Einverständnis zu fragen. Das konnte sauer aufstoßen, und das wollte ich keinesfalls. Wenn, dann sollten dem „Projekt“ alle offen gegenüberstehen, sonst würde es am Ende nur Probleme geben.
Zum Glück waren alle einverstanden. Auch die an unseren Garten angrenzenden Nachbarn waren der Idee gegenüber aufgeschlossen und hatten erstaunlich wenig Bedenken oder Vorbehalte. Im Gegenteil, ich hatte eher den Eindruck, dass alle eine gewisse Neugierde ausstrahlten. Bienen sind prinzipiell ja äußerst friedfertige Tiere. Dennoch hat sich bei uns Menschen eine latente Angst vor ihnen entwickelt, was vermutlich auch daran liegt, dass sie häufig mit den ähnlich aussehenden Wespen verwechselt werden oder einfach, weil die meisten wissen, wie verdammt schmerzhaft es ist, wenn man von ihnen, barfuß über die Kleewiese laufend, gestochen wird. Deshalb war es mir wichtig, Ängste und Bedenken ernst zu nehmen. Denn oft geht es im Leben doch einfach nur darum, gehört zu werden. Ist dafür Raum, stellt sich eine gewisse Zufriedenheit ein. Mit meinem Bienen-Projekt hatte also niemand ein Problem. Das zeigte mir, dass es manchmal einfacher ist, etwas umzusetzen, als man vorher glaubt. Ideen scheitern ja oft bereits im Kopf, bevor man überhaupt einen Versuch unternommen hat, sie Realität werden zu lassen. Einfach nur deshalb, weil die Vorstellungskraft dafür fehlt, dass sie jemals Gestalt annehmen könnten. Vielleicht lag die gelassene Reaktion auf mein Projekt aber auch nur daran, dass ich sie im Juli fragte und den Einzug eines potenziellen Bienenschwarms erst für den Mai des darauffolgenden Jahres ankündigte. Für den Einzug eines Bienenschwarmes war es in diesem Jahr einfach schon zu spät. Schließlich mussten die Bienen es noch vor dem Ende des Sommers schaffen, ihre Waben zu bauen und mit Vorräten zu füllen, um den Winter überleben zu können.
Naturgemäß ist um den Monat Mai herum Schwarmzeit der Bienen. Es ist die Zeit, in der die Bienenvölker ihrem natürlichen Fortpflanzungstrieb folgen und ihre Völker teilen, um auszuschwärmen und sich als Volk zu vermehren. Das ist die ideale Zeit, um einen Bienenschwarm in eine Klotzbeute einziehen zu lassen, zumal für mich nur ein natürlicher Bienenschwarm für die Klotzbeute infrage kam. Es gibt zwar auch andere, „künstliche“ Methoden, um Bienenvölker zu vermehren. Doch nur ein „echter“ Schwarm erschien mir für die Klotzbeute als sinnvoll und auch für Bienenkisten werden echte Schwärme empfohlen.2 Das leuchtet ein, denn nur in einem Naturschwarm herrscht die richtige „Stimmung“ und es kann die Energie aufgebracht werden, die notwendig ist, um in einer Bienenbehausung wie der Klotzbeute ein neues Volk aufzubauen. Auf einen echten Bienenschwarm musste ich von nun an also noch knapp zehn Monate warten.