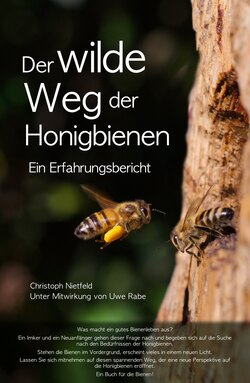Читать книгу Der wilde Weg der Honigbienen - Christoph Nietfeld - Страница 7
ОглавлениеDie wahrscheinlich berühmteste
Milbe der Welt
Es war Juli und ich hatte nun diesen prachtvollen hohlen Baumstamm auf dem Hinterhof liegen. Und bis zur Schwarmzeit im nächsten Frühjahr blieb mir viel Zeit zum Grübeln. War es überhaupt möglich, dass ein Bienenvolk in einer solchen Behausung weitgehend ohne fremde Hilfe überlebte? Ich fühlte mich mit der Frage alleingelassen. Die Informationen zur Bienenhaltung, die zu mir durchdrangen, klangen immer so, als ob ohne die schützende Hand des Imkers den Bienen der sichere Tod drohe. Verantwortlich dafür: die Varroamilbe, die ohne eine Bekämpfung für das Bienenvolk tödlich sei. Mir blieb nun ein ganzer Herbst und Winter, um diesen und anderen Fragen nachzugehen und genauer hinzuschauen. Dabei wurde ich getragen von dem Glauben, dass die Bienen nach so vielen Millionen von Jahren, die sie bereits existierten, durchaus in der Lage sein mussten, sich auch selbst zu helfen – wenn man sie nur ließe.
Die Varroamilbe ist wahrscheinlich die berühmteste Milbe der Welt. Unter den Imkern ist der Parasit seit Jahrzehnten Gesprächsthema Nummer eins und selbst in den Medien wird immer wieder auch über die Varroamilbe berichtet. Es kann hier und da durchaus der Eindruck entstehen, dass die Imkerei ohne die Varroamilbe problemfrei sei. Was so leider nicht der Fall ist. Es gibt auch noch andere Herausforderungen, wie beispielsweise der Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft, der den Bienen zu schaffen macht. Aber auch die schlechte Ernährungslage der Bienen rückt in letzter Zeit mehr in den Fokus der Öffentlichkeit, glücklicherweise. So wird den Menschen zunehmend bewusst, dass es Monate im Jahr gibt, in denen die Bienen in unserer blütenarmen Landschaft nicht ausreichende Nektarquellen finden, um zu überleben.
Spätestens seit dem Film „More than honey“ wurde dem Interessierten ein weiteres Glied der Problemkette vor Augen geführt: Der Eingriff des Imkers in die natürlichen Abläufe im Bienenvolk. Während im Film die massiven Eingriffe durch eine industriell geführte Imkerei gezeigt wurden – man hätte das Problem nicht plakativer darstellen können –, werden die „normalen“ täglichen Eingriffe der „guten imkerlichen Praxis“, wie auch ich sie jahrelang praktizierte, in ihren Auswirkungen weiterhin unterschätzt. Wir haben es mit einem Sammelsurium an Faktoren zu tun, die auf das Bienenwohl Einfluss nehmen. Es sind komplexe Zusammenhänge, die trotz der Forschungsanstrengungen der vergangenen Jahre noch lange nicht entschlüsselt sind.
Die Varroamilbe wurde Ende der siebziger Jahre aus Asien nach Europa eingeschleppt. Sie ist eine kleine, aber für das bloße Auge sichtbare Milbe, die einen dunkelbraunen, glänzenden, ovalen Panzer hat. Sie vermehrt sich, indem sie ihre Eier in die Zellen ablegt, in der sich Bienenbrut befindet. Die Varroamilbe und ihre Nachkommen ernähren sich von „Bienenblut“, das bei Insekten als Hämolymphe bezeichnet wird. Das schwächt die Bienenbrut, sodass die Bienen nach ihrem Schlupf aus der Zelle etwas kleiner sind als gewöhnlich und eine geringere Lebenserwartung haben. Das scheint aber nicht das größte Problem zu sein. Viel gefährlicher sind die Viren, die von der Milbe auf die Bienenbrut übertragen werden.3 So kommt es zum Beispiel vor, dass Bienen „geboren“ werden, die nicht fliegen können, weil sie verkrüppelte Flügel haben. Hierfür wird der sogenannte Flügeldeformationsvirus oder „Deformed Wing Virus“ (DWV) verantwortlich gemacht. Bisher geht man davon aus, dass vornehmlich fünf verschiedene Viren von der Varroamilbe übertragen werden.4 Da es gegen diese Viren keine Medikamente gibt, hat die Bekämpfung der Milbe als Krankheitsüberträger oberste Priorität, damit möglichst wenige Bienen an den Viren erkranken.
Wie sieht so eine Bekämpfung der Varroamilbe nun in der Praxis aus? In meiner kleinen Hobby-Imkerei habe ich meine Bienen zuletzt einer zweistufigen Behandlung unterzogen, die auch der aktuellen, mehrheitlich anerkannten Vorgehensweise gegen die Varroamilbe entspricht. Dazu habe ich nach der letzten Honigernte, die je nach dem Nahrungsangebot für die Bienen oft Anfang August stattfindet, meine Bienenvölker für rund 10 bis 14 Tage Ameisensäuredämpfen ausgesetzt. Hierfür habe ich zum Beispiel einfach ein mit Ameisensäure getränktes Schwammtuch in das jeweilige Bienenvolk gelegt, sodass die Ameisensäure allmählich verdampfte. Der Säuredampf verteilte sich im Bienenvolk und sollte die Milben auf diese Weise abtöten. Für die Bienen schien der Säuredampf dagegen rein äußerlich unschädlich zu sein.
Zu einem späteren Zeitpunkt, meist im Dezember, habe ich oft noch eine zweite Behandlung durchgeführt, sofern das erforderlich war. Das hing von dem Milbenbefall ab, der sich nach der ersten Behandlung einstellte. Hierfür habe ich jedoch keine Ameisensäure, sondern anfänglich ein synthetisches Mittel namens Perizin eingesetzt und später auf die organische Oxalsäure umgestellt. Beides habe ich in flüssiger Form verabreicht, indem ich es zwischen die Wabengassen direkt auf die Bienen geträufelt habe. Hierzu musste ich den Bienenkasten im Dezember öffnen.
Auch mit Oliver, meinem Baumstammlieferanten, hatte ich mich über die Varroamilbe unterhalten. Er bestätigte mir, dass eine Behandlung gegen die Varroamilbe in der Klotzbeute technisch nicht möglich sei. Doch mit etwas Aufwand könne ich den Baumstamm so gestalten, dass die gängigen Behandlungsmethoden anwendbar würden, ohne dass ich dazu zu weit von der ursprünglichen Idee einer weitestgehend natürlichen Behausung für die Bienen abrücken müsse. Aber wollte ich das überhaupt? Nachdem ich meine Bienen jahrelang nahezu bedenkenlos mit den konventionellen Mitteln gegen die Varroamilbe behandelt hatte, stellte ich mir nun zum ersten Mal die Frage, was die Behandlung für die Bienen überhaupt bedeutete. Konnte nicht auch eine Schwächung der Bienen mit der Behandlung einhergehen?
In der Klotzbeute wollte ich die Bienen möglichst wenig stören, da ich mittlerweile zu der Überzeugung gekommen war, dass jeder Eingriff enormen Stress für die sensiblen Insekten bedeutet. Wenn ich vom Menschen ausgehe, dann führt bekanntlich zu viel Stress zu einer Schwächung des Immunsystems. Vielleicht ließ sich dieses Phänomen auch auf die Bienen übertragen? Könnte ein Bienenvolk, das wenig Stress ausgesetzt ist, ein stärkeres Immunsystem haben? Sollte ich mich also besser ganz gegen eine Milbenbehandlung entscheiden? Es gibt allerdings eine Verordnung, die den Umgang mit Bienenkrankheiten regelt, die Bienenseuchenverordnung (BienSeuchV). Nach dieser besteht eine Behandlungspflicht, wenn ein Volk mit Varroamilben befallen ist oder durch die zuständige Behörde eine Behandlung in einem bestimmten Gebiet festgesetzt wurde.5 Ich konnte also nur auf eine Behandlung verzichten, wenn die Bienen sowieso milbenfrei waren und die zuständige Behörde daher keine Behandlung anordnete.
Von den bienenkundlichen Instituten wird empfohlen, vor einer Behandlung zu prüfen, ob ein Befall vorliegt. Hierfür gibt es verschiedene Methoden. Ich habe zum Beispiel ein Blatt Papier unter die Beute gelegt und nach einigen Tagen die Milben gezählt, die aufgrund des sogenannten natürlichen Totenfalls hinuntergefallen waren. Auf der Grundlage konnte ich mittels Tabellenwerten Rückschlüsse auf den Milbenbefall im Volk ziehen. Das erschien mir gegenüber den Bienen gut vertretbar zu sein. Aber es gibt auch andere Methoden. In dem Leitfaden „Varroa unter Kontrolle“ der Arbeitsgemeinschaft der Institute für Bienenforschung e. V. wird unter anderem die Feststellung des Milbenbefalls mittels Bienenproben beschrieben. Dazu werden etwa 30 Gramm Bienen, das entspricht etwa 300 Bienen, aus dem Volk entnommen. In Schritt 3 der Arbeitsanweisung heißt es wörtlich: „… nach der Abtötung (einfrieren) Gewicht der Bienenprobe ermitteln …“.6 Diese Vorgehensweise erscheint mir grausam und absurd zugleich. Sollte den Bienen nicht ursprünglich geholfen werden, indem ihr Milbenbefall kontrolliert wird?
Wie fühlt sich eine Biene, die gemeinsam mit 299 ihrer Schwestern langsam erfriert? War es etwa gerechtfertigt für den Schutz des Volkes, das Leben von 300 Bienen zu opfern, nur weil diese wenig ins Gewicht fallen, wenn man bedenkt, dass ein Bienenvolk im Schnitt etwa dreißig- bis vierzigtausend Bienen umfasst? Glücklicherweise gibt es ja schonendere Möglichkeiten der Varroakontrolle, wie zum Beispiel die zuvor beschriebene Methode mit dem Blatt Papier oder die Puderzuckermethode, welche ich hier noch erwähnen möchte. Diese ist beispielsweise bei der Bienenhaltung in der Bienenkiste gut geeignet. Bleibt der festgestellte Milbenbefall unterhalb einer für das Bienenvolk tolerierbaren Grenze, kann auf eine Behandlung verzichtet werden und den Bienen bleibt die Prozedur erspart. Aber leider werden Völker oft gar nicht erst kontrolliert, sondern auf Verdacht gegen die Milbe behandelt. Das geschieht scheinbar in vorauseilendem Gehorsam, ganz ohne Anordnung der zuständigen Behörden, aus Angst vor der Milbe. Sogar ganz junge Völker, sogenannte Ableger oder auch Schwärme, werden unmittelbar, nachdem sie gebildet beziehungsweise eingefangen wurden, schon „vorsorglich“ einer Varroabehandlung unterzogen.
Neben den von mir beschriebenen Vorgehensweisen zur Behandlung der Varroamilbe gibt es noch viele weitere Mittel und Methoden, die in der imkerlichen Praxis angewendet werden. Dazu gehört auch, dass teilweise empfohlen wird, die Ameisensäure nach der Ernte im August zweimal einzusetzen, einmal direkt nach der Ernte und ein weiteres Mal nach der Auffütterung kurz vor der „Winterpause“. Darüber hinaus wird zusätzlich zu der Behandlung mit Ameisen- und Oxalsäure zu sogenannten biotechnischen Verfahren geraten.7 Hierzu gehören die Drohnenbrutentnahme, das Einhängen von Fangwaben mit Drohnenbrut, die Bildung von Brutablegern und die Bildung eines Kunstschwarmes. Hintergrund der beiden erstgenannten Maßnahmen ist, dass sich die Varroamilbe bevorzugt in der Drohnenbrut vermehrt, was bedeutet, dass sich ein eventuell vorliegender Milbenbefall dort konzentrieren und durch eine Beseitigung der Drohnenbrut eindämmen lässt. Die Drohnen sind die männlichen Bienen, die im Frühling und Frühsommer aufgezogen werden.
Die Drohnenbrut wächst in eigens für sie gebauten Zellen auf, die größer sind als die Zellen für die Arbeiterinnenbrut. Ich habe hierzu in meinen Imkerzeiten ein leeres Rähmchen in meine Bienenvölker gehängt, das unverzüglich mit Drohnenzellen ausgebaut wurde. Warum das so war, kann ich mir nur damit erklären, dass die Drohnenbrut – wie ich eben schon angedeutet habe – ein spezielles, das heißt größeres Zellmaß erfordert, als es den Bienen auf den vorgeprägten Mittelwänden im Allgemeinen angeboten wird. In derart bewirtschafteten Völkern herrscht somit ein Mangel an Drohnenbrutplätzen, sodass jede Gelegenheit zum Anlegen von Drohnenbrut genutzt wird, denn die Vermehrung und somit der Fortbestand aller Lebewesen hat oberste Priorität. Ein Ausbau der vorgeprägten Zellen zu Drohnenbrutwaben ist den Bienen scheinbar nicht möglich. Lediglich an vereinzelten Stellen, an den Rändern einiger Waben, bauen sich die Bienen solcher Völker die vorgeprägten Zellen vereinzelt zu Drohnenbrutzellen um. Vorherrschend bleibt jedoch ein Mangel an Drohnenbrutplätzen, weshalb ein Rähmchen ohne vorgeprägte Mittelwand von den Bienen unmittelbar zu einer Drohnenbrutwabe ausgebaut wird. Wenn die Maden der Drohnenbrut sich so weit entwickelt hatten, dass die Zellen von den Bienen weitestgehend alle verdeckelt – das heißt in Imkersprache „verschlossen“ – worden waren, habe ich die Wabe mit der Drohnenbrut entnommen, die Brut herausgeschnitten und mit etwas Entfernung zum Bienenstand abgelegt und sich selbst überlassen. Dabei hatte ich in Kauf genommen, dass die Drohnen starben. Das habe ich etwa dreimal pro Saison und Volk gemacht und damit vielen Tausend Drohnen das Leben genommen.
Manchmal wurden die Drohnenlarven von Meisen aus den Waben gepickt, die sie an ihre Jungen verfütterten. Wenn das nicht der Fall war, verwesten die Maden und es verbreitete sich ein unangenehm süßlicher Geruch nach Aas am Bienenstand, sodass ich die Waben dann schließlich vergrub. Aber dieses Verfahren fördert neben der grausamen Tatsache, dass ich dabei Tausende von Drohnen achtlos töte, eine zweifelhafte Entwicklung. Denn es liegt nahe, dass durch das Ausschneiden diejenigen Milben, welche die Drohnenbrut bevorzugen, ausselektiert werden. Im Umkehrschluss überleben und vermehren sich vorwiegend die Milben in der Arbeiterinnenbrut, also diejenigen, die durch die Maßnahme eigentlich bekämpft werden sollten. Das könnte dazu führen, dass sich das Verhältnis des Milbenbefalls zwischen der Drohnenbrut und der Arbeiterinnenbrut zu Ungunsten der Arbeiterinnenbrut verschiebt, sodass derjenige Teil des Volkes zu leiden beginnt, der durch die Maßnahme eigentlich geschützt werden sollte. Sollte dies so sein, entpuppt sich diese biotechnische Maßnahme als eine nicht nachhaltige. Zudem drängt sich die Frage auf, welchen Einfluss es auf die Fortpflanzung hat, wenn zu wenige Drohnen zur Verfügung stehen, weil sie systematisch vernichtet werden.
Nach meiner Wahrnehmung stellt die Varroamilbe mittlerweile ein extremes Feindbild dar, sodass jedes Mittel recht erscheint, um sie zu bekämpfen. Getreu nach dem Motto: „Der Zweck heiligt die Mittel.“ Die Varroamilbe als der Staatsfeind Nummer eins, den es um jeden Preis zu bekämpfen gilt, selbst wenn die Bienen dabei draufgehen? Hauptsache, die Milbe wird beseitigt? Was, wenn es neben der Varroamilbe auch noch andere schädliche Quellen für die Bienen gibt, die von dem Feindbild „Varroa“ profitieren, da es für Ablenkung sorgt? Wie ist es zum Beispiel mit dem Einsatz von Pestiziden?
Wessen Wissen und welche Interessen stehen bei der Bekämpfung der Milbe oder bei der „Rettung der Bienen“ im Vordergrund? In einem konkreten Fall berichtete die New York Times über die Einflussnahme des Agrarkonzerns Syngenta auf die Forschungsarbeit von Dr. James Cresswell an der Universität Exeter in Großbritannien. Anfänglich äußerte sich dieser zu verschiedenen Forschungsergebnissen skeptisch, dass Insektizide der Gruppe der Neonikotinoide für das Bienensterben verantwortlich sein könnten. So kam es, dass Syngenta sich anbot, seine Forschungen zu weiteren Ursachen des Bienensterbens zu finanzieren. Jedoch zeigten erste Untersuchungen bereits, dass die Varroamilbe für das Bienensterben nicht infrage kam, wodurch die Neonikotinoide wieder in den Vordergrund rückten. Daraufhin forderte Syngenta Cresswell auf, seine Forschungen wieder auf die Varroamilbe zu konzentrieren.8 Das mag nur eines von vielen Beispielen sein. Mit der Milbe ist ein Allein-Schuldiger gefunden, dessen schlechtes Image zudem nicht geschäftsschädigend wirkt.
Wo es ein Problem zu bekämpfen gibt, winkt auch immer ein Geschäft – vor allem, wenn man nach Wegen sucht, Symptome zu bekämpfen – wie die Milbe –, ohne nach den Ursachen zu schauen. So wundert es kaum, dass zum Beispiel der Agrarkonzern Monsanto verspricht, ein biotechnologisches Wundermittel gegen die Varroamilbe zu entwickeln. Hierbei plant Monsanto, die Varroamilbe mittels Gentechnik zu bekämpfen, berichtet der Informationsdienst Gentechnik in seinem Artikel: „Nächste Phase der Monopolstellung: Monsanto will Bienen retten“9. Es soll demnach eine neue Gentechnik-Methode zum Einsatz kommen, die als RNA-Interferenz bezeichnet wird. Dabei wird über die RNA (Ribonukleinsäure) gezielt Einfluss auf die Aktivität von Zellen genommen. In diesem Fall soll eine spezielle RNA-Lösung mit Zuckerwasser vermischt und den Bienenlarven verabreicht werden. Theoretisch sollen diese dabei nicht geschädigt werden, wohl aber die Parasiten, indem in ihren Zellen überlebenswichtige Gene abgeschaltet werden.
Der Kreativität fragwürdiger Erfindungen sind keine Grenzen gesetzt. So berichtet die Firma Bayer in ihrem Forschungsmagazin „research“ über ihr Varroa-Gate. Hierbei besteht das Flugloch der Bienen aus mehreren Löchern und: „Beim Einflug in den Stock streift die Biene den Anti-Milben-Wirkstoff vom Rand ab und nimmt ihn mit nach innen. Aus dem Kunststoffstreifen strömt sofort neue Substanz an die Oberfläche nach und bietet so einen Langzeitschutz“10, so verspricht der Hersteller. Bei all diesen Methoden der Milben-Bekämpfung ist eines sicher: Die eigentliche Ursache für den Milbenbefall wird außer Acht gelassen.
Es gibt auch noch andere Bemühungen, die aber ebenfalls nicht auf eine Bekämpfung der Ursachen abzielen. So etwa an der Universität Hohenheim. Diese entwickelte ein Verfahren, bei dem das Paarungsverhalten der männlichen Milben durch das Einbringen eines Pheromonextraktes in den Bienenstock gestört werden soll.11 Des Weiteren ist zu lesen, dass der Insektenforscher Prof. Philip Howse von der Universität Southampton versucht, mittels eines Puders, bestehend aus negativ geladenen, feinen Wachspartikeln, und Pflanzenöl die positiv geladene Hülle der Varroamilbe zu verkleben.12 Die Odyssee der Verfahrens(ver-)suche gegen die Varroamilbe geht weiter über die Bienensauna13, führt zu rotierenden Waben14 und so weiter und so fort. Es liegt mir nicht daran, diese Bemühungen nach ihrem Sinn oder Unsinn zu hinterfragen. Derartige Eingriffe, insbesondere das Einbringen von Fremdstoffen in das Bienenvolk, fühlen sich für mich jedoch nicht richtig an.
Wie eingangs erwähnt, ist die Behandlung mit Ameisensäure für die Milben tödlich, wohingegen die Bienen die Prozedur überleben. Dabei hat die Ameisensäure insgesamt ein gutes Image, weil sie als organische Säure auch in der Natur vorkommt und sich angeblich kaum im Honig und den anderen Bienenprodukten anreichert. Aber wie immer macht die Konzentration das Gift. Nur weil die Ameisensäure auch in der Natur vorkommt, ist sie im Bienenvolk in der verabreichten Konzentration noch lange nicht natürlich. Ich habe ein paarmal aus Unachtsamkeit etwas Ameisensäuredampf eingeatmet, und das war höchst unangenehm und auch nicht ganz ungefährlich. Es war ein Stechen in der Nase, sodass ich mich sofort weggedreht habe und einen Schritt zurückgegangen bin. Ich versuchte mir also vorzustellen, wie es den Bienen erging, während die Ameisensäure im Bienenkasten verdampfte: Ich bin also eine Biene. Ich lebe mit meinen Schwestern zusammen in einem Kasten. Wir verständigen uns im Bienenstock vorwiegend mit Duftstoffen, denn unsere Augen sind in der Dunkelheit wenig hilfreich. Deshalb habe ich sehr empfindliche Geruchsorgane, um die Informationen aus meiner Umgebung aufzunehmen. Plötzlich übertönt ein stechender, ätzender Geruch alle meine Sinne. Ich bekomme Panik, ich bin blind, kann meine Umgebung nicht mehr wahrnehmen – und das über mehrere Tage. Alles gerät durcheinander, Arbeitsabläufe sind gestört. Ich kann nicht beurteilen, was als Nächstes zu tun ist im Bienenstock. Ist die Brut hungrig? Soll ich Wachs ausschwitzen? Soll ich ausfliegen und Nektar oder Pollen sammeln? Wo bin ich?
Es fällt mir nicht schwer, mir vorzustellen, welchen Stress ein solcher Eingriff bei den Bienen auslöst. Allein bei dem Versuch stockt mir der Atem. Vielleicht könnte man es mit einem Tränengasangriff vergleichen oder dem einer Blendgranate. Vielleicht aber auch mit Pfefferspray. Jedoch sind es Belastungen, denen ein Mensch wahrscheinlich nur wenige Minuten ausgesetzt wäre, aber nicht mehrere Tage, wie es bei den Bienen der Fall ist, wenn sie mit Ameisensäure behandelt werden. Wären wir ehrlich, so müssten wir zugeben, dass es sich um einen heftigen Säureangriff handelt und nichts anderes. Und danach? Die Bienen leben noch, vielleicht mit Verätzungen ihrer Sinnesorgane, und mit mehr oder weniger großen Verlusten. Jetzt beginnt das große Aufräumen all dessen, was durcheinandergeraten ist. Durchatmen! Einmal die Bienenbehausung kräftig durchlüften! Wenn’s doch nur damit getan wäre!
Auch ich versteckte mich regelmäßig hinter der Hoffnung, die Bienen könnten nach einem solchen „Angriff“ ihre Orientierung vollständig wiedergewinnen und ihre Wunden heilen. Aber vielleicht hinterlässt eine derartige Prozedur eine Art Tinnitus ihrer Sinne, ein ständiges Grundrauschen und -fiepen in ihrer Wahrnehmung, eine Behinderung, vielleicht mit Spätfolgen? Irgendeine Art von Trauma wird es wohl sein, das die einzelne Biene aber vielleicht auch das Volk im Ganzen davonträgt, bei mir wäre das jedenfalls so. Wenn sich die Bienen nicht durch kontinuierliches Brutgeschäft ständig erneuern würden, würden sie eine solche Tortur als Volk überhaupt überleben?
Ähnlich verhält es sich mit der Behandlung der Bienen mit Perizin oder Oxalsäure. Mit dem Unterschied, dass die Behandlung mit diesen Mitteln mitten im Dezember, wo sich die Bienen bereits in einer geschlossenen Wintertraube zusammengefunden haben und gegenseitig wärmen, stattfindet. Zu der Zeit, in der sich die Bienen bereits so eingerichtet haben, dass sie mehrere Monate in ihrem Stock überdauern können, wird plötzlich der Bienenkasten geöffnet und ihre Winterruhe gestört. Ein eiskalter Wind fegt durch die Wabengassen des Bienenstocks und zu allem Übel regnet auch noch eine Flüssigkeit auf die Bienen herab, sodass ihr wärmender Pelz langsam durchnässt. Das muss sich anfühlen, als würde man ohne Vorwarnung aus dem Schlaf gerissen und aus seinem kuscheligen Bett zum Eisschwimmen ins Wasser geworfen.
Ich erinnere mich daran, dass das Perizin wie Mottenkugeln roch, die wir als Kinder in Maulwurfshaufen vergraben „durften“, um ihre Bauherren zu vertreiben. Ein so riechendes Mittel tropfte ich nun mit der Absicht, die Milben zu vertreiben, die Bienen aber zu erhalten, auf meine Bienen. Oxalsäure war dagegen relativ geruchsneutral, aber unangenehm wird es für die Bienen allemal gewesen sein. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass es sich auch bei Perizin und Oxalsäure eben um Säuren handelt. Bemerkenswert ist auch ein Hinweis im Beipackzettel von Perizin, dass das Mittel indirekt auf die Milbe wirkt, indem sie den Wirkstoff aus dem Bienenblut aufnehmen soll. Ich nahm es also in Kauf, dass es die Biene zuerst ins Blut aufnehmen musste, um dann damit den Winter im Bienenstock zu verbringen. Zudem reichert sich der Wirkstoff im Wachs an, sodass die Bienen den Geruch noch länger ertragen müssen.15 Das tat ich allerdings unwissend, denn ich hatte den Beipackzettel vorher nie gelesen. Das Mittel wurde kostenlos vom Imkerverein zur Verfügung gestellt und ich wendete es eben einfach an. Heute fühle ich mich schlecht, weil ich jahrelang all diese Maßnahmen durchgeführt habe, ohne sie zu hinterfragen, und vor allem, ohne mich zu fragen, wie es den Bienen dabei geht.
Dazu fällt mir ein Vortrag ein, den der Vorsitzende des Schweizer Vereins free the bees, André Wermelinger, im Juni 2015 in Düsseldorf gehalten hat. Er berichtete, dass in den Gebrauchsinformationen für Ameisensäure in der Schweiz unter dem Punkt Nebenwirkungen stand: „Beim Beachten der Anwendungsempfehlungen sind keine Nebenwirkungen bekannt.“ Dies hatte der Verein angeprangert, denn es wurden bereits Nebenwirkungen nachgewiesen. Mit viel Mühe und Geduld ist es dem Verein gelungen, dass die Ameisensäure zur Behandlung von Bienenvölkern in der Schweiz nur noch mit folgendem Hinweis in Verkehr gebracht werden darf: „Die offene Brut kann geschädigt werden. Bei Überdosierung sind Brutverluste und Königinnenverluste möglich.“16 Ob es diesen Hinweis auch auf der Gebrauchsinformation von Ameisensäure in Deutschland gab? Dazu ist zu sagen, dass sich Wermelinger in seinem Vortrag auf Ameisensäure mit einer fünfundachtzigprozentigen Konzentration bezog, die in Deutschland zwar nicht als Tierarzneimittel zugelassen ist, aber ebenfalls zur Varroabehandlung verwendet wird.
Um meiner Frage weiter nachzugehen, schaue ich in den Gebrauchsinformationen für eine in Deutschland zugelassene und im Internet angebotene Ameisensäure mit einer Konzentration von sechzig Prozent nach. Dort finde ich unter dem Punkt Nebenwirkungen den gleichen Satz: „Beim Beachten der Anwendungsempfehlungen sind keine Nebenwirkungen bekannt.“17 Von dem Hinweis, wie er neuerdings auf der Schweizer Gebrauchsinformation zu finden ist, keine Spur. Vielleicht treten die Nebenwirkungen der Brut- und Königinnenverluste ja nur bei einer fünfundachtzigprozentigen Ameisensäure auf, oder der Hinweis müsste auch hier noch ergänzt werden. Doch selbst wenn der Hinweis aufgenommen würde, frage ich mich, wie Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Anwendung von Ameisensäure im Bienenvolk definiert werden. Sind nur Nebenwirkungen vorhanden, wenn die Königin stirbt oder offene Brut geschädigt wird? Ist es nicht auch eine Nebenwirkung, wenn die Bienen Stress erleiden oder ihre Kommunikation beeinträchtigt wird?
Ich denke darüber hinaus an verschiedene Nebenwirkungen, die mir in Beipackzetteln von Arzneimitteln für Menschen begegnet sind, wie zum Beispiel Schwindel oder Reizungen der Haut. Eine andere bekannte Nebenwirkung einiger Medikamente ist, dass nach der Einnahme kein Kraftfahrzeug mehr geführt werden darf. Aber der Biene kann das scheinbar alles nichts anhaben, und sie darf mit getrübten Sinnen sogar fliegen. Eigentlich hätte ich, während ich die Bienen mit Ameisensäure behandelte, nur in den Spiegel sehen müssen, als Antwort auf die Frage, ob es Nebenwirkungen geben könnte, denn ich musste mich gemäß Sicherheitshinweis mit Schutzbrille und Handschuhen schützen und den Säuredampf durfte ich nicht einatmen. Die Bienen hingegen waren dem Säuredampf schutzlos ausgeliefert. Zudem hatte mir Uwe noch von einer Nebenwirkung berichtet, über die er etwas gelesen hatte, wobei der Chitinpanzer der Bienen durch die Behandlung mit Ameisensäure angegriffen wird, was ihre Anfälligkeit gegenüber Viren begünstigten soll.
Eine weitere Nebenwirkung kann die Bildung von Resistenzen der Varroamilbe gegenüber den eingesetzten Stoffen sein. Die Bildung von Resistenzen ist dabei ein altbekanntes Problem, das bei dem Einsatz von Wirkstoffen auftritt. All das war auf dem Beipackzettel der Ameisensäure nicht zu finden. Wahrscheinlich haben wir einfach keine Vorstellung davon, was bei einer Behandlung genau passiert und kein Gefühl dafür, was für eine Biene eine ernste Nebenwirkung sein könnte, außer ihr Tod.
Mich überforderte dieses Thema. Ich konnte es schlussendlich nicht beurteilen, wie es den Bienen bei all diesen Dingen wirklich ging. Und die Milben? Bei all diesen Überlegungen hatte ich die Milben ganz vergessen. Wer gab mir eigentlich das Recht, die Milben zu töten? Es ist und bleibt eben alles auch immer eine Frage der Perspektive. Hier sind wir nun an einem philosophischen Punkt angekommen. Und die Frage, ob ich Milben töten darf oder nicht, ist bestens dafür geeignet, bei dem einen oder anderen spätestens jetzt absolutes Unverständnis auszulösen. Wollen wir den Bienen nun helfen oder nicht? Nach dem Verzicht auf den Honig nun auch noch das Verbot, etwas gegen die Milben zu tun? Nein, das geht zu weit!
Ich hatte mich über den Winter in diesem gedanklichen Dilemma scheinbar festgefahren. Da überraschte mich Uwe ein paar Monate später bei einem unserer Treffen mit dem Satz: „Mach dir die Varroa zum Freund!“ Ich war zunächst sprachlos. Was sollte das nun wieder? „Mach dir die Varroa zum Freund?“ Das toppte sogar alle meine Überlegungen über das Recht, Milben töten zu dürfen. Was hatte es damit auf sich?
Uwe hatte diesen merkenswerten Satz aus seiner Seminarwoche an der Lehr- und Versuchsimkerei Fischermühle, nahe Rosenfeld, mitgebracht. Dort hatte er zu Beginn des Jahres das einwöchige Faschingsseminar zur wesensgemäßen Bienenhaltung besucht. Er berichtete begeistert über das, was er dort über die Bienen gehört und gelernt hatte. Und er hob mehrfach hervor, aus welchen verschiedenen Blickwinkeln doch die Bienen und ihr Wesen an der Fischermühle betrachtet wurden. Es schien für ihn eine prägende Woche gewesen zu sein.
Marco Bindelli, Philosoph, Anthroposoph, Menschenkundler und dazu noch ein ausgezeichneter Musiker, näherte sich dem Thema der wesensgemäßen Bienenhaltung von einer gänzlich anderen Seite – was sicherlich zu anfänglicher Skepsis des ein oder anderen wissensdurstigen Seminarteilnehmers führte. Da ging es dann um wirklich „Merkwürdiges“: Es wurden spielerisch Begriffe genutzt, wie z. B. „stockdunkel“. Die gewohnte Anschauung der Menschen wurde einfach mal umgekehrt: „Was erwarten die Bienen von uns?“ Er stellte den Unterschied zwischen „Wissen“ und „Weisheit“ dar. Dabei ging es auch um Fehler, die zunächst gemacht werden müssen, und eigene Erfahrungen, die unser Denken und Handeln mindestens genauso prägen wie wissenschaftliche Erkenntnisse.
Marco Bindelli referierte über einen Paradigmenwechsel: über die derzeit wachsende Erkenntnis, dass sich die Welt nicht allein aus wissenschaftlicher Sicht erklären lässt, und über die Notwendigkeit der Ablösung einer rein materialistischen Perspektive, hin zu einer, die die geistigen, feinstofflicheren Bestandteile der Welt stärker miteinbezieht. Er ermutigte die Kursteilnehmer dazu, ihre Sinne für die Wahrnehmung der Welt und insbesondere der Bienen wieder zu schärfen – weg vom künstlichen, hin zu einem künstlerischen Umgang mit den Bienen und einfach einmal etwas Überflüssiges wegzulassen, etwas, das sich nicht mehr stimmig anfühle – selbst wenn es der „guten (alten) imkerlichen Praxis“ entspräche. Warum nicht eine Richtungsänderung vornehmen, wenn sie überlebensnotwendig sein könne? … Sprich: „Mach dir die Varroa zum Freund!“, denn du wirst sie mit keiner Restentmilbung der Welt ausrotten können. Du und die Bienen, du Mensch im Wesentlichen, du wirst dich mit der Varroamilbe arrangieren müssen. Deutlicher kann das Erfordernis eines grundsätzlichen Wandels in dieser Angelegenheit nicht formuliert werden. Und ich war dankbar, dass Uwe diese Eindrücke mit mir teilen konnte.
Möglicherweise dürfen wir uns heute von dem Zwang lösen, den vermeintlichen Feind weiterhin mit den härtesten Mitteln bekämpfen zu wollen. Nehmen wir die Varroamilbe stattdessen vielmehr als einen Weckruf wahr und schauen, was wir auf der Seite der Bienen dafür tun können, um diese darin zu unterstützen, eine überlebensfähige Koexistenz mit den Milben zu erreichen. Und ich denke, die Bienen würden dies schaffen, wenn wir sie nur ließen …
Schlussendlich bestätigte dieser „Spaziergang“ durch die aktuellen Umgangsformen mit der Varroamilbe mein Bauchgefühl, dass ich die Bienen in meiner Klotzbeute nicht diesen Behandlungen aussetzten wollte. Es gab die leise Hoffnung, dass die Bienen auch und gerade ohne die Behandlung der Milbe trotzen könnten, wenn ich sie in Ruhe ließe. Dafür sprachen auch die Tatsachen, dass bei den verschiedenen Möglichkeiten zur Kontrolle des Milbenbefalls erst ab einer bestimmten Anzahl an gefundenen Milben gegen diese behandelt werden muss und dass selbst mit mehreren Behandlungen nicht alle Milben aus einem Bienenvolk entfernt werden können. Somit scheint für die Bienen eine gewisse Anzahl an Milben verkraftbar zu sein, ohne dass sie daran sterben. Fällt dies einem starken Volk leichter als einem schwachen? Nicht umsonst heißt es, dass ein starkes Bienenvolk ein gesundes ist. Das klingt beim ersten Hinhören logisch. Aber was ist ein starkes Volk eigentlich? Was macht es aus? Als ich meine Bienen in den Magazinbeuten hielt, war für mich ein starkes Volk in erster Linie ein großes Volk. Aber ist das auch natürlich? Oder ist mit einem starken Volk eher ein vitales Volk gemeint und spielt neben der Quantität auch die (Lebens-)Qualität eine Rolle?
Schauen wir uns dazu einige weitere Forschungen an. Nach einer Untersuchung des amerikanischen Bienenforschers Prof. Dr. Thomas D. Seeley bevorzugen Schwärme, die ihre Behausung selbst wählen dürfen, eine Baumhöhle mit einem Volumen von etwa 45 Litern.18 Meine Völker in den Segeberger Kunststoffbeuten hatten im Sommer für gewöhnlich vier Zargen in Anspruch genommen. Das entspricht einem Volumen von rund hundertdreißig Litern. Das ist in etwa das Dreifache. Was ist der Unterschied zum aufgeblasenen Kuheuter einer Hochleistungsmilchkuh? Ich fragte mich, ob ein Volk auch zu groß sein kann und wenn ja, welche Probleme damit verbunden sein könnten. Vielleicht gab es eine Größe, die zu Schwierigkeiten bei der Kommunikation im Volk führte, weil der eine nicht weiß, was der andere tut. Oder es gab Probleme bei der Regulierung des Raumklimas, wenn der Bienenstock zu groß war. Das alles ist schwer zu sagen. Aber ich habe einen interessanten Hinweis in einem Text von dem am Forschungsinstitut des Goetheanum tätigen Molekularbiologen Johannes Wirz gefunden. Er vermutet einen Zusammenhang zwischen der Volksgröße und dem Befall von Varroamilben. Wirz verweist auf Untersuchungen, in denen die Wildvölker, die gegen die Milben tolerant erschienen, stets kleiner waren als die behandelten Kontrollvölker und weniger Brut aufzogen. Da sich die Milben in der Brut vermehren, führe ein hohes Brutaufkommen auch zu einer stärkeren Vermehrung der Milben. Deshalb sei eine Brutpause, die durch das Schwärmen eintrete, auch so wichtig, damit die Entwicklung der Milbenpopulation unterbrochen werden könne.19
Die Volksgröße spielte auch in einem Versuch von Thomas D. Seeley eine Rolle. Bei einem Vortrag in der Imkerei Fischermühle berichtete er im Juli 2016 über einen Versuch, bei dem zwölf Bienenvölker in kleinen Beuten sich selbst überlassen wurden und bei zwölf weiteren Völkern die Magazinbeute kontinuierlich vergrößert und der Honig entnommen wurde, wie es in der Imkerei üblich ist. Beide Gruppen wurden nicht gegen die Varroamilbe behandelt und es wurden keine Maßnahmen zur Schwarmverhinderung getroffen. Nach zwei Jahren lebten von den Völkern in den kleinen Beuten noch acht und von den Völkern in den großen Beuten noch zwei. Bei der Kontrolle des Milbenbefalls konnte Seeley nachweisen, dass die Bienenvölker in den großen Beuten im Verhältnis zu der Volksgröße mehr Milben hatten als die Bienenvölker in den kleinen Beuten.20
Der Versuch zeigt, dass es den Bienen unter bestimmten Voraussetzungen möglich ist, ohne Behandlung gegen die Varroamilbe zu überleben. Ein in diesem Zusammenhang häufiger erwähnter Versuch wurde auf der schwedischen Insel Gotland durchgeführt. Im Jahre 1999 wurden auf der Insel insgesamt hundertfünfzig Bienenvölker ohne imkerliche Eingriffe sich selbst überlassen. Im Mai 2004 lebten davon noch sieben Völker, Ende 2006 waren es wieder dreizehn. Dabei war die Sterberate von über fünfundsiebzig Prozent im Jahre 2002 in den Jahren 2004 bis 2006 auf zehn bis zwanzig Prozent gesunken.21 Der Versuch hat gezeigt, dass die Bienen sehr wohl dazu in der Lage sind, sich an die Varroamilbe anzupassen. Sicher ist die Sterberate am Anfang sehr hoch, aber die wenigen Völker, die es schafften, sich gegen den Parasiten zur Wehr zu setzen, hatten sich schlussendlich sogar wieder vermehrt. Innerhalb von zwei Jahren verdoppelte sich ihre Anzahl beinahe.
Eine weitere Forschungsarbeit zum Thema kommt von Martin Dettli. In einem Vorversuch wurden sechs Bienenvölker ohne Varroabehandlung gelassen, von denen ein Volk sechs Jahre lang überlebte. Danach folgte ein weiterer Versuch, bei dem zehn Völker unbehandelt blieben. Hierbei überlebten sieben Völker den ersten Winter und drei Völker den zweiten Winter. Ein Volk überlebte schließlich auch den dritten Winter. Martin Dettli beobachtete dabei, dass sich der Milbenbefall in den Völkern in außergewöhnlichen Lebenssituationen reduzierte. Er nennt diese außergewöhnlichen Situationen „Überlebenssituationen“ und fasst zusammen, dass jede einen Einzelfall darstelle und gleichzeitig Gemeinsamkeiten dahingehend bestünden, die den Zeitpunkt der volkseigenen Sanierung und große Bienenverluste betreffen, die zu einer Kleinvolk-Phase mit Brutpause führen.22 Das ist ein interessantes Ergebnis. Es heißt, ein Bienenvolk gerät in eine Notlage und reduziert z. B. das Brutgeschäft, um Kräfte zu sparen. Dadurch kommt es auch zu einer Stagnation der Milbenvermehrung, weil keine oder nur noch sehr wenig Brut vorhanden ist. Somit konnten die Völker, deren Größe sich drastisch verkleinerte, ihren Milbenbefall reduzieren. Genau diese Völker sind es wahrscheinlich auch, die im Weiteren lernen, mit der Milbe umzugehen. Dr. Werner Mühlen von der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen beschreibt es so: „Man kann sich Folgendes vorstellen: Je mehr Milben sich entwickeln, umso höher ist der Parasitierungsgrad der Brut. Jungbienen werden zunehmend geschwächt, ihre Lebenserwartung wird herabgesetzt. Das Volk wird kleiner und kleiner. Irgendwann stellt die Königin das Brutgeschäft ein. Jetzt spätestens löst der Imker dieses Volk auf. Er schwefelt es ab und sagt, seine Bienen seien gestorben. Dabei hat er gar nicht abgewartet, ob sie wirklich sterben. Denn in diesem zusammenbrechenden Volk hat auch die Varroa keine Fortpflanzungschance mehr, sie hat ihren eigenen Lebensraum zerstört. Theoretisch ist es denkbar, dass sich dieses Volk bei ausreichender Nahrungsversorgung und guten klimatischen Bedingungen (u. a. Flugwetter, Jahreszeit) bis zum Winter wieder erholen kann. Die Königin beginnt dann neu zu brüten, wenn Nektar und Pollen eingetragen werden können. Es gibt nur noch wenige Milben im Volk, die sich entwickelnde Brut ist gesund, die Jungbienen sind vital und leistungsfähig. Bevor die Varroamilben wieder überhandnehmen, ist das Volk erstarkt und möglicherweise überwinterungsfähig.“23
Leider habe ich es früher auch so gemacht und solche Völker vor dem Winter „aufgelöst“, weil ich ihre Überlebenschancen als gering einschätzte. Wenn ich im Frühjahr ein solches Volk vorfand, habe ich es ebenfalls aufgelöst, weil es zu schwach war, um für mich Honig zu sammeln. Dabei habe ich wahrscheinlich systematisch die Völker eliminiert, die vielleicht das Zeug dazu gehabt hätten, mit der Milbe fertig zu werden. Denn auch wenn ein Volk im Frühjahr schwach ist, kann es sich wieder zu einer normalen Volksgröße entwickeln. Für mich war das aber unattraktiv, weil die Frühlingstracht bis dahin schon vorbei gewesen wäre. Wahrscheinlich sind den Bienen durch mein Vorgehen, welches sich wieder allein an dem Ziel der Honigernte orientierte, wertvolle Eigenschaften verloren gegangen.
Ich habe bei meinen Recherchen auch Berichte von frei lebenden Bienenvölkern gefunden, die in selbst bezogenen Hohlräumen auf sich allein gestellt leben. So zum Beispiel in dem Bienenbaum von Angenstein, von dem auch Martin Dettli berichtet. Demnach wohnt in diesem Baum seit zehn Jahren ein Bienenvolk. Dabei handelt es sich nicht durchgängig um ein und dasselbe Volk, aber immerhin wurde dreimal ein Winter von den Völkern überlebt und nachdem ein Volk gestorben war, zog im Frühling sofort ein neuer Schwarm ein.24 André Wermelinger berichtet ebenfalls von wild lebenden Bienenvölkern in der Schweiz, in Zürich, Winterthur und Dübendorf.25 Es gibt also Völker, die ohne fremde Hilfe auskommen. Zu dem Phänomen schrieb Dr. Werner Mühlen anlässlich eines Bienenvolkes, das angeblich seit fünf Jahren in einer Kirchenmauer lebte, Folgendes: „Wenn wir annehmen, dass ein einziges Volk so lange der Varroa trotzt, stellt sich die Frage, wie das geschehen kann. Vielleicht sind wir hier einem Phänomen auf die Spur gekommen, das uns zum Umdenken anregen sollte. Ist es wirklich das unausweichliche Schicksal eines Volkes, zugrunde zu gehen, wenn die Varroa eingedrungen ist? Geert Lijftogt, ein holländischer Imker der Stichting Fortmund Imkerij, versuchte, Bienenvölker ohne Varroabehandlung über Jahre zu führen – und es ist ihm gelungen. Lijftogt betreibt eine Schwarmimkerei und legt großen Wert darauf, dass die Bienenvölker in einer blütenreichen Umwelt leben, also immer ausreichend Nahrung finden. Hier liegt wohl der Schlüssel.“26 Demnach gibt es neben den Versuchen und einzelnen, wild lebenden Bienenvölkern sogar eine Imkerei, die ihre Bienen nicht gegen die Varroamilbe behandelt. Und das ist nicht die einzige.
Ein weiteres Beispiel ist die Berufsimkerei von Ed und Dee Lusby in den USA, im Bundesstaat Arizona. Die Bienenvölker überleben ohne eine Varroabehandlung.27 Dafür schaffen ihre Halter viele Voraussetzungen für ein wesensgemäßes Leben der Bienen, die uns in den weiteren Kapiteln noch des Öfteren begegnen werden. Damit fördern sie das hygienische Verhalten der Bienen, auch „VSH“ (Varroa Sensitive Hygiene) genannt, wodurch diese die Varroamilben und mit Milben befallene Brut selbst aus dem Bienenstock räumen.28 Es handelt sich dabei also um eine Art Hilfe zur Selbsthilfe. Ich habe nun auch schon mehrmals von einer Gruppe von Imkern aus Wales gehört und gelesen, die gemeinsam die Behandlung gegen die Varroamilbe eingestellt haben. Verblüffend ist, dass ihre Verluste im Vergleich zu Imkern, die ihre Bienen behandeln, nicht höher sind.29
Bei einem Vortrag in Düsseldorf im Juni 2017 berichtete Jacco van de Ree von seiner Imkerei auf der Holländischen Insel Texel. Er hat rund 70 Bienenvölker, die er ebenfalls nicht gegen die Varroamilbe behandelt. Jacco van de Ree berichtete über seinen rücksichtsvollen und wesensgemäßen Umgang mit den Bienen. Zum Beispiel entnimmt er ihnen im Durchschnitt „nur“ zehn Kilogramm Honig pro Jahr, sodass sie mit eigenem Honig überwintern können. Zudem vermehrt er seine Völker ebenfalls über Schwärme. Eine Besonderheit ist sicherlich, dass es auf der Insel Texel nur die sogenannte Dunkle Biene gibt, der in Bezug auf den Umgang mit der Varroamilbe scheinbar besondere Fähigkeiten nachgesagt werden. Aber wenn es so einfach wäre, hätten sicherlich schon alle Imker die Dunkle Biene. Es gehört also mehr dazu.
Als ein wichtiger Baustein im größeren Kontext einer ganzheitlichen Sicht auf die Bienengesundheit ist anscheinend auch der Schwarm zu sehen. Thomas D. Seeley stellte bei seinen Untersuchungen fest, dass sich nach dem Schwärmen die Anzahl der Milben im Muttervolk deutlich reduziert. Ein Grund dafür sei, dass mit dem Schwarm rund 60 Prozent der Bienen den Stock verlassen und damit die auf ihnen sitzenden Varroamilben. Aber auch der Schwarm reduziert seinen Varroabefall deutlich. Seeley nimmt an, dass sich die wärmesensiblen Varroamilben während der Aufwärmphase im Bienenstock unmittelbar vor dem Schwärmen, bei der sich die Bienen auf 35 Grad Celsius aufwärmen, von den Bienen fallen lassen. Zudem weist er darauf hin, dass nach dem Schwärmen im Muttervolk eine Brutpause eintritt, weil die junge Königin eine gewisse Zeit braucht, bis sie ihren Hochzeitsflug absolviert hat und mit der Eiablage beginnt. Somit gibt es eine Zeit lang keine verdeckelte Brut, in der sich die Varroamilbe vermehren kann.30 Die Brutunterbrechung ist offensichtlich, aber die Aufwärmphase unmittelbar vor dem Schwärmen vollzieht sich im Verborgenen. Das war mir neu und erinnerte mich ein wenig an Fieber bei uns Menschen.
Johannes Wirz schreibt zum Schwarm: „Schwärmen ist ein Akt der Gesundung“, und verweist auf Untersuchungen, die belegen, dass durch den Schwarmakt die Belastung mit der Varroamilbe vermindert wird und sogar bakterielle Erkrankungen des Volks nachweislich reduziert werden.31 Das klingt für mich nachvollziehbar. Somit ist der Schwarm nicht nur eine Form der Vermehrung, sondern auch ein effektiver Mechanismus der Bienen, um sich vor Krankheiten zu schützen. Spätestens jetzt drängt sich die Frage auf, warum der Imker die Bienen nicht einfach schwärmen lässt, wenn es so gesund für sie ist. Darauf gehe ich später noch genauer ein.
Während ich mich mit der Varroamilbe beschäftigte, wurde ich auf die Wiederentdeckung eines Nützlings der Bienen aufmerksam: des Bücherskorpions. Dieser lebte ursprünglich mit den Bienen zusammen in einer symbiotischen Beziehung und ernährte sich von unterschiedlichen Milben und anderen Tieren, die im und um das Bienenvolk leben. Versuche von Torben Schiffer haben gezeigt, dass die Bücherskorpione, zumindest unter Versuchsbedingungen, auch Varroamilben fressen.32 Dabei gibt es nur ein Problem: Wenn ein Bienenvolk zum Beispiel mit Ameisensäure behandelt wird, werden auch die Bücherskorpione getötet und vielleicht auch noch andere Begleiter der Biene, die regulierend auf Bienenschädlinge wirken. Durch die Ameisensäurebehandlung wird somit das gesamte Mikro-Ökosystem gestört, in das die Biene eingebettet ist. Viele der Wechselwirkungen zwischen den Kleinstlebewesen um die Bienen sind heute wahrscheinlich noch nicht einmal bekannt. Von uns selbst kennen wir einen ähnlichen Effekt, wobei übertriebene Sauberkeit Allergien begünstigen soll.
In „Four Simple Steps to Healthier Bees“ beschreibt Michael Bush bereits bekannte Wechselwirkungen zwischen dem Mikro-Ökosystem im Bienenstock und dem Bienenvolk. Dieses Umfeld trägt demnach maßgeblich zur Gesunderhaltung der Bienen bei. Er fordert deshalb, diese wertvolle Symbiose zu schützen, und warnt davor, sie zum Beispiel mit Stoffen wie Ameisensäure zu schädigen.33 Das schließt meiner Meinung nach auch eine Zurückhaltung bei der Reinigung der Bienenstöcke ein. Denn die kleinen Begleiter der Bienen brauchen Nahrung und die finden sie wahrscheinlich im „Gemüll“, also alledem, was bei den Bienen herunterfällt und für gewöhnlich unten in der Bienenbehausung zu finden ist. Wenn man an eine Baumhöhle denkt, in der die Bienen früher einmal lebten, ist es offensichtlich, dass dort niemand den Höhlenboden gereinigt hat.
Ein wesentlicher Unterschied zwischen wilden, Varroaresistenten Völkern und bewirtschafteten Bienenvölkern ist sicherlich auch die räumliche Distanz zueinander. Nach Untersuchungen von Thomas D. Seeley hat die Nähe der Völker zueinander unmittelbare Auswirkungen auf die Milbenentwicklung. Demnach landen bei dicht nebeneinander aufgestellten Bienenvölkern, wie es in der Imkerei üblich ist, nach jedem Flug zwanzig Prozent der Sammlerinnen im falschen Bienenstock. Da eine Sammlerin mehrmals am Tag unterwegs ist, sitzen am Abend mehr als achtzig Prozent der Bienen im falschen Bienenstock. Ein entsprechender Versuch mit unmittelbar nebeneinander aufgestellten und im Vergleich dazu mit Abstand aufgestellten Bienenvölkern hatte gezeigt, dass die dicht aufgestellten Völker ohne Behandlung gegen die Varroamilbe starben und die mit Abstand aufgestellte Gruppe mit Varroapopulationen unter der kritischen Grenze überlebte.30 Der Abstand zwischen den Völkern der mit Abstand zueinander aufgestellten Gruppe betrug 21 Meter bis 75 Meter.34 Der Effekt des Verfluges war mir bekannt, denn wenn ich mehrere Bienenvölker in eine Reihe stellte, entwickelten sich die äußeren zu den größten Völkern – auch wenn dies nicht nur für den Verflug der Bienen, sondern auch dafür sprechen könnte, dass Bienen die äußeren Beuten in einer Reihe bevorzugen. Aber dass es so viele Bienen sind, die tagtäglich in den falschen Bienenstock fliegen, hatte mich überrascht. Natürlich findet auf diese Weise eine Übertragung der Milbe in andere Völker statt.
Je mehr ich herausfand, desto weiter wandelte sich meine zeitweise Resignation in die fühlbare Lebendigkeit (m)eines oder unseres „Herzensweges“ MIT den Bienen. Es gab scheinbar Gründe genug, um mich nicht entmutigen zu lassen und an meiner Idee festzuhalten, den Bienen ein natürliches Heim zu bauen, in dem sie ungestört leben durften. Ich frage mich, warum immer noch gegen die Varroamilbe behandelt wird, obwohl es so viele Beispiele gibt, die zeigen, dass es auch ohne geht. Wahrscheinlich ist grundsätzlich die Umstellung von einer intensiven Imkerei zu einer weniger intensiven Imkerei, bei denen den Bienen mehr Raum gelassen wird, die Herausforderung. Wenn der Mensch Bienen so „bewirtschaftet“, dass die Bienenkraft allein in den Honig geht, den man ihnen mehrfach wegnimmt, ohne etwas Gleichwertiges hinzuzugeben, dann fehlt ihnen diese Kraft. Das wirkt sich auf die Vermehrung und Gesamtgesundheit der Bienen aus. Den genannten Untersuchungen, die zeigen, dass die Bienen sich gegen die Varroamilbe behaupten können, steht eine Mehrzahl an Versuchen gegenüber, die eine andere Sprache sprechen. Hierbei müssen wir jedoch berücksichtigen, dass es auch vorkommt, dass aus Sicht der Biene positive Ergebnisse nicht immer auch positiv für die Honig-Imkerei sind, weil z. B. die Honigerträge sinken. So gesehen müssen wir vor jedem Versuch die Frage der Perspektive stellen: Wird der Versuch aus Sicht der Biene oder aus Sicht der Honigproduktion betrachtet? Aus meiner Sicht wird der Großteil der Versuche aus Sicht der Imkerei mit dem Ziel der Honiggewinnung durchgeführt und bewertet. Der reduzierte Blickwinkel und die daraus resultierenden, zu kurz greifenden Handlungen führen häufig zu dem Ergebnis, dass die Bienen nicht ohne eine Behandlung gegen die Varroamilbe auskommen. Aus diesem Grund hat sich in unseren Köpfen vermutlich auch die Meinung manifestiert, dass Bienen ohne die Hilfe eines Imkers zwangsläufig sterben. Versuche, die die Bekämpfung der Varroamilbe zum erklärten Ziel haben und dabei darauf abzielen, den Schaden für die Honig-Imker möglichst gering zu halten, schaffen für die Bienen – und das fällt beim genauen Hinsehen auf – Bedingungen, die sich negativ auf ihre Kräfte auswirken. Kräfte, die der Biene helfen, sich selbst gegen die Varroamilbe zur Wehr zu setzen. Wie oben beschrieben, wird während der Varroabehandlung das Mikroklima – nicht nur im Brutnest – massiv gestört; die Kästen werden zur Kontrolle aufgemacht und teilweise sogar Brutwaben herausgenommen. Häufig werden auch Brutzellen geöffnet und unzählige ungeborene Bienen entnommen, um zu sehen, ob auf ihnen Milben leben. Diese Bienen sterben. Eine Überwinterung auf Honigersatz, wie zum Beispiel Zuckerwasser, sowie imkerliche Maßnahmen wie die Unterdrückung des Schwarmtriebes bedeuten zusätzlich enormen Stress und fehlende Regenerationsmöglichkeit für die Bienen. Wie sollen sie die nötige Ruhe und Kraft finden, um sich gegen die Milbe zur Wehr zu setzen, wenn sie ständig viel größeren Problemen ausgesetzt werden?
Die Zusammenhänge sind komplex. Man stelle sich nur einen Aspekt vor: Wenn die Bienen zum Beispiel damit beschäftigt sind, das richtige Mikroklima im Brutnest wiederherzustellen, damit die Brut am Leben bleibt, hat das sicher Vorrang vor anderen Arbeiten, wie zum Beispiel dem Putzen und damit dem Ausräumen der mit Milben befallenen Brut. Nachdem man die Biene auf unterschiedliche Weise all ihrer Kraft beraubt hat, die sie für ihr eigenes Vorgehen gegen die Varroamilbe gebrauchen könnte, steht das Ergebnis des jeweiligen Ansatzes fest: Ohne eine Behandlung gegen die Milbe sterben die Bienen. Das ist in etwa so abstrus, als würde ich meinem Sohn beim Versuch, Laufen zu lernen, die Beine zusammenbinden und am Ende sagen: „Seht ihr, er kann es nicht!“ Für mich wird die Frage vernachlässigt, welche eigenen Möglichkeiten die Biene hat, um gegen die Milbe vorzugehen, und ob sie durch die Anwendungen und Eingriffe eventuell beeinträchtigt werden könnte. Aus dem aktuell üblichen Blickwinkel durchgeführte Versuche zeigen oder untermauern ein Bild davon, dass die Bienen sich nicht selbst durchsetzen könnten. Und so lautet die Empfehlung weiterhin, gegen die Varroamilbe zu behandeln. Was wir brauchen, um einen Wandel anzuregen, ist das grundsätzliche Vertrauen in die Kraft des natürlichen Prozesses und eine entsprechende Demut ihr gegenüber. Und wie bereits zu Beginn dieses Kapitels dargestellt, ist es nicht ganz so einfach, weil die Bienen nicht primär an der Milbe sterben, sondern an den Viren, die die Milben überträgt. Dementsprechend lautet die gängige Formel: weniger Milben = weniger Viren. Deshalb wird Jagd auf Milben gemacht. Die Viren, die durch die Milbe übertragen werden, sind aber nicht neu, lediglich der Übertragungsweg durch die Milbe führt häufiger dazu, dass Symptome der Viren auftreten, zum Beispiel deformierte Flügel.35 Aber was ist, wenn die Eingriffe zur Bekämpfung der Varroamilben das Immunsystem der Biene so massiv schwächen, dass plötzlich auch eine Ansteckung zwischen den Bienen untereinander stattfindet, sodass ein Volk innerhalb kurzer Zeit zusammenbricht? Die Frage dürfte vielleicht doch stattdessen lauten: Was können wir tun, um die Bienen zu stärken und sie nicht in ihren natürlichen Abläufen zu „stören“?
Schlussendlich führen alle Manipulationen, sei es zum Zwecke der Honiggewinnung oder zur Bekämpfung der Varroamilbe zu einer Störung des natürlichen Selektionsdruckes. Bliebe dieser ungestört, könnte er über kurz oder lang zu einem verträglichen Verhältnis zwischen Wirt und Parasit führen. Bei der Tagung zur Varroatoleranz im Jahr 2016 bei der Fischermühle merkte der Bienenwissenschaftler Wolfgang Ritter, Leiter der Abteilung Bienenkunde am Tierhygienischen Institut in Freiburg, dementsprechend kritisch an, dass 1978 ein falscher Entscheid gefällt worden sei, an dem auch er mitgewirkt habe. In jenem Jahr wurde beschlossen, die Varroamilbe zu bekämpfen.36 Letztlich kann unsere Motivation oder Vision sein, die wissenschaftlichen Erkenntnisse zwar zu berücksichtigen, aber nicht auf das Hinzuziehen des eigenen Gespürs zu verzichten und MIT den Bienen zusammenzuarbeiten – und „dranzubleiben“, auch wenn erst mal anderes „passiert“.
Die Bienen wissen es besser. Der Mensch greift in ein (Öko-)-System ein, das er, wenn wir ehrlich sind, nicht einmal ansatzweise versteht. Doch damit die Bienen in der Lage sind, sich selbst zu helfen, dürfen wir ihnen wieder die nötigen äußeren, natürlichen Rahmenbedingungen schaffen, die ihnen zustehen. Martin Dettli schrieb in den Schlussgedanken zu seinen Untersuchungen zur Bienenhaltung ohne Varroabehandlung: „Die Acarpismilbe war bis 1970 ein gefürchteter Parasit, welcher ebenso massiv behandelt wurde wie die Varroamilbe heute. Dann hat sie ihren Schrecken verloren und heute ist sie kein Thema mehr. Niemand hat je geklärt, was da geschehen ist.“37 Ist es nicht ziemlich überheblich von uns Menschen, zu behaupten, dass die Biene auf unsere Hilfe angewiesen sei? Was sie braucht, ist Raum, um ihren natürlichen Prozessen nachzugehen. Wir sollten uns die Frage stellen, ob die konventionelle Imkerei, mit dem Ziel des Honigertrages, nicht generell überholt ist und der Honig wieder zu dem Gold werden sollte, das er ursprünglich einmal war, weit bevor es Honig im Supermarktregal gab.
Die Bienen haben sich während der vielen Millionen Jahre ihres Daseins auf unserer Erde schon gegen so manchen Parasiten durchgesetzt. Wäre dem nicht so, wären sie schon vor unserer Zeit ausgestorben. Wir Menschen glauben, wir seien so fortschrittlich und innovativ, dabei besteht unser Handeln nur aus Versuch und Irrtum. Vielleicht wird es Zeit, dass wir Menschen uns endlich an den Gedanken gewöhnen, dass wir eben nicht so schlau sind, wie wir glauben, und uns an manchen Stellen Weisheit fehlt, die wir über den Verstand allein nicht erlangen können. Solange wir immer unsere eigenen Interessen in den Vordergrund stellen, sind wir selbst – unsere Haltung zum Leben – der schlimmste Parasit. Wäre es nicht sinnvoller, eine wirkliche Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, indem wir rein egoistische Ziele loslassen und den größeren Zusammenhängen der Lebendigkeit wieder mehr Raum geben? Das würde wohl nicht nur den Bienen guttun.
Wenn wir es wirklich ehrlich meinen, dürfen wir im ersten Schritt „selbst zur Biene werden“ und uns fragen, was die Biene eigentlich für Bedürfnisse hat, und unsere Bedürfnisse hintenanstellen. Dazu ist es notwendig, dass wir unsere Überheblichkeit ablegen und der Biene mit dem Respekt begegnen, der ihr gebührt. Sobald wir das auf einer tieferen Ebene erkennen, wird offensichtlich, dass die wichtigste Unterstützung ist, die Lebens energie der Biene sich entfesseln zu lassen. Befreien wir die Biene aus ihrer Knechtschaft, ist sie wieder in der Lage, frei zu schwärmen, Waben zu bauen, ohne im Dauerstress zu leben, zu sich selbst zu finden.
Die Voraussetzung, damit die Biene sich an neue Bedingungen anpassen kann, sind äußere Umstände, die im Kern noch ihrem natürlichen Wesen entsprechen: Der Patient braucht Ruhe! Dieser Ansatz findet in unserer Gesellschaft jedoch aktuell wenig Anklang. Wir gehen mit uns selbst ja nicht anders um. Wenn wir krank werden, verlangen wir nach einem „Mittel“, das das „Problem“ lösen soll. Doch die Tablette behebt meist nicht die eigentliche Ursache. Und jedes Mittel bringt wiederum unerwünschte Nebenwirkungen mit sich. Es schafft neue Probleme. Genauso suchen wir im Hinblick auf die Varroamilbe nach einem Mittel, ohne die Ursachen für das Bienensterben wirklich zu „greifen“ …