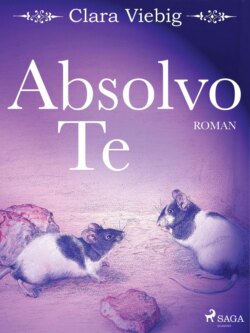Читать книгу Absolvo te! - Clara Viebig - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II.
ОглавлениеDer Hof des Besitzers Tiralla lag weit draussen vorm Dorf am Przykop, dem tiefen Grund, bei den grossen Kiefern. Starydwór war ein stattlicher Hof. Da waren viele in Starawieś, die Frau Tiralla beneideten. Die war doch ein blutarmes Mädel gewesen, die Tochter einer Lehrerswitwe, hatte nicht mal sechs Hemden und einen Wagen voll Hausrat gehabt, und nun hatte sie soviel Geld! Aber keiner, und wenn er ihr noch so übel gewollt, hätte ihr nachsagen können, dass sie ihrem Alten nicht treu gewesen wäre.
Der Besitzer Tiralla war schon bei guten Jahren gewesen, als er sie geheiratet hatte, und er war ein Witwer dazu mit einem grossen Jungen. Leicht mochte das für das junge Ding auch nicht gewesen sein, sagten die, die Frau Tiralla wohl wollten. Aber sie hatte sich gut geschickt, wenigstens wurde Herr Tiralla dick und fett und sagte es allen, die ihn gewarnt hatten, die Siebzehnjährige zu freien, seine Zosia sei das süsseste Weibchen unter der Sonne, und er fühle sich so mollig wie die Made im Speck. Und das sagte er noch, jetzt, nachdem sie schon bald fünfzehn Jahre miteinander verheiratet waren. Sie hatte es ihm angetan. Ihre grossen Augen, die wie dunkler Samt aus dem weissen Gesicht glänzten, führten ihn am Narrenseil; er konnte ihr nicht böse sein, wenn sie ihn oft auch noch so sehr kränkte. Und wenn er’s recht überlegte: war’s denn nicht am Ende gerade schön, dass sie so spröde und zurückhaltend war? Weiber, die sich ihm an den Hals warfen, hatte der Besitzer von Starydwór genug in seinem Leben kennen gelernt; selbst seiner ersten Frau, der verstorbenen Hanusia, konnte er nicht gleiche Keuschheit nachrühmen.
Und hübsch war seine Zosia! Es schmeichelte dem Alternden gewaltig, dass man niemals nur von ihr als von ‚Frau Tiralla‘ sprach, sondern immer nur von der ‚schönen Frau Tiralla‘. Wenn er mit ihr durch Gradewitz fuhr — er auf dem Vordersitz, sie hinten in der Britschka mit Schleier und Federboa — staunte alles, was auf der Gasse war. Aber selbst in Gnesen stürzten die Herren Offiziere, die im Hotel zu Mittag speisten, ans Fenster und drängelten sich und machten lange Hälse, nur um die schöne Frau Tiralla vorbeifahren zu sehen. Dann knallte Herr Tiralla mit der Peitsche und fühlte sich sehr stolz; die mochten ihn ’mal beneiden! Die wussten es ja nicht — kein Mensch wusste es — dass er manchen Abend, wenn er sich ihr nähern wollte, einen Stoss vor die Brust erhielt, so kräftig, dass man ihn der zarten Frau nimmermehr zugetraut hätte. Seine Zosia war nun einmal nicht für die Zärtlichkeit, damit tröstete er sich. Sie war aber doch eine liebe Frau, eine schöne Frau, ein herziges Weibchen, von dessen Hand ihm das Essen noch einmal so gut mundete und noch einmal so gut bekam. Und schön war sie noch wie am ersten Tag. Schöner vielleicht jetzt in den Dreissigen als damals, wo sie noch gar so dünn, gar so klein war, keine hundert Pfund schwer, so leicht, zum Auf-der-Handtragen!
Er hätte sie gern behängt, bunt und auffallend wie ein Schlittenpferd, aber sie hatte den Geschmack wie eine Dame. Das kam daher: sie hatte Bildung. Sie sprach deutsch, dass es nur so floss, und konnte es auch schreiben ohne einen einzigen Fehler. Sie kannte ganze lange Gedichte auswendig; sie wusste von Berlin zu reden, obgleich sie noch niemals dort gewesen war. Und das imponierte Herrn Tiralla gewaltig. Gnesen und Posen und Breslau waren zwar auch grosse Städte, aber Berlin, Berlin! Herr Tiralla staunte seine Frau an. Er selber kam sich ihr gegenüber sehr unwissend vor, obgleich er seinerzeit die Ackerbauschule zu Samter besucht und ganz gut verstanden hatte, aus seinen vom Vater ererbten fünfhundert Morgen etwas herauszuwirtschaften. Die Kinder, der Sohn aus erster Ehe, und dann die kleine Rosa brauchten einmal nicht ihr Brot bei fremden Leuten zu verdienen; vor allem aber würde seine geliebte Zosia, wenn er vor ihr sterben sollte, sichergestellt sein. Er hatte, wie er es vor der Hochzeit der Mutter, der Lehrerswitwe, zugeschworen hatte, bald nach der Hochzeit einen letzten Willen zu ihren Gunsten gerichtlich aufgesetzt.
Frau Lehrer Kluge hatte völlig befriedigt über ihr Werk die Augen schliessen können. Sie, die einstmals aus besseren Kreisen, aus Breslau stammend, sich die Jahre ihrer Ehe mit dem Posenschen Schulmeister in den erbärmlichsten polnischen Nestern hatte herumdrücken müssen, hatte ihrer hübschen Tochter durch ihre Klugheit und Umsicht dies glänzende Los bereitet. Frau Kluge hatte nie gelitten, dass die kleine Sophia mit den anderen Kindern auf der Gasse spielte. Zosia trug immer Strümpfe und Schuhe; dafür hungerte man insgeheim lieber. Und als Zosia grösser wurde und in den Religionsunterricht für die erste heilige Kommunion ging, wurde sie des Herrn Propsts erklärter Liebling. Frau Kluge war eine fromme Christin, vielleicht die allerfrömmste in Gradewitz; bei ihrer Schneiderei für die Besitzerfrauen, mit der sie sich und ihr Kind ernährte, pflegte sie immer leise betend die Lippen zu bewegen. Durch diese Schneiderei hatte sie auch des Besitzers Tiralla Frau kennen gelernt — vielleicht auch durch ihre Frömmigkeit. Denn war es nicht wie eine Gegengewährung von Jesus Christus selber, dass beim letzten Kleid, das sie der schwangeren Frau Hanusia machte, der Besitzer Tiralla mit in die Stube kam? Er hatte seine Frau vorgefahren, es war bitterkalt, darum stieg auch er ab und liess das Pferd allein draussen warten. Kaum konnte er durch die niedrige Tür, und die kleine Stube war ganz voll von ihm. Das junge Ding, das der Mutter beim Anprobieren die Stecknadeln zureichte, bekam eine Mark von ihm und einen Blick, vor dem es errötete und die schwarzen Augen niederschlug, ohne zu wissen warum.
Sophia Kluge war sittsam; kein junger Bursche aus der Nachbarschaft konnte sich ihrer Gunst rühmen. Sie wusste nicht einmal, warum sich die Burschen und Mädchen an den Feierabenden hinaus in die Felder stahlen, warum ihr weicher Gesang sehnsüchtig aufstieg zum besternten Himmel. Sophia mit den schwarzen Augen und dem weissen Gesicht, das keine Sonne, keine Landluft gebräunt hatte, denn sie sass immer bei der Mutter drinnen in der Stube, war fromm; so fromm, dass der Propst, ein noch junger Mann mit einem Gesicht wie Jesus Christus selber, sich eingehend mit ihr beschäftigte. Er hatte schon die Elfjährige zu sich kommen lassen in seine Studierstube, die selbst seine alte Haushälterin nur dreimal im Jahre betreten durfte. Dort sprach er dem Kinde von den Freuden der Engel und der bald Mannbaren von dem himmlischen Bräutigam. Er berauschte sich und sie an den Bildern des Himmels, an den Strömen der Liebe, die das Herz der Heiligen durchflutet hatten.
Frau Kluge war eitel auf diese Bevorzugung ihrer Tochter, aber über deren Seelenheil vergass sie doch das irdische Teil nicht. Sie hatte genug der Entbehrungen und Entsagungen in ihrem armen Leben auf sich nehmen müssen, um ihrer Tochter nicht auch schon ein Geniessen auf Erden zu wünschen. Es dünkte ihr wie ein Fingerzeig der Heiligen, dass Frau Tiralla, ehe sie noch das neugeschneiderte Kleid angezogen hatte, zu früh niederkam und starb. Nun war Herr Tiralla wieder ein Freier, und als er selber bei der Schneiderin erschien, um ihr den noch ausstehenden Schneiderlohn für das nicht mehr getragene Kleid der Seligen zu zahlen, merkte die gescheite Frau den wohlgefälligen Blick, den der Witwer auf die junge Schönheit warf. Frau Kluge kannte die Schönheit ihrer Tochter und wusste sie zu bewerten. Als Herr Tiralla sagte: „Ihre Tochter ist verdammt hübsch,“ sagte sie: „Ach, die ist ja noch so jung!“ Und als Herr Tiralla wiederum vorsprach: „Psia krew, ist das traurig auf so einem öden Hofe allein zu sitzen,“ sprach die Gescheite: „Herr Tiralla muss wieder heiraten. Es gibt Witwen und ältere Mädchen genug, die den Herrn Tiralla gern nehmen würden!“ Das reizte ihn. Er wollte nicht Witwen noch ältere Mädchen, der Jüngsten begehrte er.
Klagend und weinend war Sophia in die Propstei geeilt, als ihre Mutter zu ihr gesprochen hatte: ‚Herr Tiralla will dich heiraten, freue dich!‘ Nein, sie wollte ihn nicht, nein, sie wollte überhaupt nicht heiraten!
Jetzt noch, nach fünfzehn Jahren noch, wenn Frau Tiralla nachts nicht schlafen konnte, übermannte sie die Bitterkeit, wenn sie daran dachte, wie man an ihr gehandelt hatte. Beschworen hatte die Mutter sie, unter Tränen gebeten: ‚Wir sind dann aus aller Not‘ — und als sie noch immer verneinend den Kopf geschüttelt, hatte sie Ohrfeigen bekommen, rechts und links, wohin es traf, und den strengen Befehl: ‚Du wirst Herrn Tiralla heiraten.‘ Und ihr Freund, der Herr Propst? Ah! Frau Zosia sah sich wieder in der stillen Stube, in der sie so manches Mal mit heissen Wangen, mit verzückten Augen den Legenden der Heiligen gelauscht hatte, auf den Knieen liegen. Sie fühlte wieder den Saum der schwarzen Soutane in ihren Händen, den sie mit ihren Tränen benetzt hatte. Sie hatte geweint, sich gesträubt: ‚Nein, ich will nicht, Hochwürden, ich kann nicht!‘ Hatte ihr der Herr Propst denn nicht immer gesagt, sie förmlich beschworen, eine Jungfrau zu bleiben, ehelos zu bleiben, sich so einen Stuhl im Himmel zu sichern?! Seine Hände hatte sie geküsst: ‚Helfen Sie mir, raten Sie mir!‘ — da — sie wusste selber nicht, wie es über sie gekommen war — da war sie plötzlich aufgefahren von ihren Knieen, verwirrt und zitternd, war zur Tür gestürzt, ihr Antlitz verbergend in einem Aufruhr ungeahnter Gefühle, die im jähen Ansturm sie fast betäubten. Auf einmal war sie kein Kind mehr; sie war eine, die bebend, glühend, fiebernd vor Verlangen sich ihrer selbst nun bewusst geworden war. Wie selig war es doch, eine — seine Erwählte zu sein! Das Leben lang in dieser stillen Stube bei den Heiligen zu sitzen! In wirren Träumen sah die junge Sophia die Gestalt ihres himmlischen Freundes sich mit der des irdischen mischen — ei, wie fein war er, und so schön! Seine Hände waren wie Elfenbein, seine Wangen wie Samt! Und sein Kuss — — —! Statt seiner war Herr Tiralla gekommen. —
Frau Tiralla hatte in ihrer Bettkammer einen Betschemel stehen unter dem Bild des Herrn Jesus Christus, der sein flammendes Herz vor sich auf der Hand trägt. Der Propst ihrer Jugend war längst aus Starawieś fort — er hatte sich aus der Gegend versetzen lassen — aber sie betete noch immer viel. Als sie heute morgen, nachdem Herr Tiralla sich gestern in der Freude über ihre langentbehrte Zärtlichkeit einen Rausch angetrunken hatte, aus dem Bette stieg, galt ihr erster Blick dem Bilde da drüben. Sie bekreuzte sich, und dann glitt sie auf blossen Füssen zum Schemel hin, kniete nieder und betete lange.
Herr Tiralla hatte ihr’s fest zugesagt, als er gestern in ihrem Arme lag, dass er heute würde den Schein ausfüllen und anspannen lassen und nach Gnesen fahren und selber das Gift holen für die Ratten. Dass sie so ruhig sein konnte! Sie wunderte sich selber darüber. Wenn ihr Herz jetzt klopfte, so klopfte es nicht aus Furcht, nur aus Erwartung wie vor etwas Gutem, Freudigem, Langersehntem. Fünfzehn Jahre — Jesus Maria, fünfzehn lange Jahre! Ihre Lippen, die, während ihre Gedanken schon ihren Mann auf dem Wege nach Gnesen sahen, ihn in die Apotheke begleiteten, mit ihm wieder herauskamen, sich fortgesetzt leise bewegt und Gebetesworte gemurmelt hatten, pressten sich jetzt fest aufeinander. So war ihr Mund ein unerbittlicher. Sie vergass, dass sie betete. Wilde Verwünschungen wälzten sich in ihrem Innern empor, wilde Anklagen. Ihre Mutter, die sie verkauft hatte — ja, verkauft wie ein junges Kalb, warum es nicht beim richtigen Namen nennen? — war tot. Lange hatte Frau Kluge sich nicht daran erfreuen können, dass ihr das Häuschen, in dem sie sonst zur Miete gewohnt, selber gehört hatte, dass sie nun nicht mehr für die ewig nörgelnden Besitzerfrauen Kleider zu machen brauchte um jeden Preis. Lange hatte sie das nicht genossen, und das war ihr recht geschehen!
In den Augen der Tochter flammte es auf wie Befriedigung: alles, was die Mutter sich von Herrn Tiralla ausbedungen hatte als Entgelt für die Tochter, hatte sie hierlassen müssen. Nun moderte sie längst. Aber der andere Schuldige — der Käufer? Ei, Herr Tiralla war dick und fett, der sah noch lange nicht so aus, als ob er bald daliegen würde, wo die Würmer nagen!
„Jesus Christus! Heilige Mutter!“ Die Betende hob die Hände höher. Sie wusste nicht recht, wie sie in Worte kleiden sollte, um was sie einzig zu bitten hatte — es klang doch zu scheusslich, wenn sie nun beten würde: ‚Lass ihn sterben, er muss sterben!‘ Das wäre ja so, als würde sie sich vor die Mutter Gottes hinstellen, ganz bloss, und vor Jesus Christus dazu. Nein, das ging nicht an!
Ratlos liess sie die Hände sinken: wie denn nun?! Aber dann fiel ihr ein: was brauchte sie den Heiligen denn alles zu sagen?! Warum die Heiligen selber bemühen?! Wenn sie sich nur deren Beistand zusicherte, indem sie betete: ‚Heilige Maria, reine Jungfrau, o, bewirke es durch deine göttliche Kraft und durch die aller Heiligen, dass er auch wirklich fahre! Dass er es endlich hole, das Gift, das Rattengift!‘ Und dann wandte sie sich auch an Mariä Sohn: „Jesus Christus auf dem höchsten Thron neben deiner Hochheiligen Mutter Maria, lass ihn nicht umkehren auf seinem Wege! Dass er sich nur nicht eines anderen besinne auf der weiten Fahrt! Ich bitte euch, ich flehe euch an!“
Sie rang die Hände und weinte heisse Tränen; sie schlug an ihre Brust, so heftig, dass sie sich weh tat. All das, was sie gelitten hatte unter Herrn Tiralla, und was sie immer wieder leiden würde, er liess sie ja nicht und — nein, sie mochte ihn nun einmal nicht, ihr ekelte vor seinen begehrlichen Händen, ach, hätte sie doch in ein Kloster gehen können, wie wohl wäre ihr da! — all das stürmte jetzt mit Entsetzen wieder auf sie ein. So entsetzt war sie gewesen an ihrem Hochzeitsabend, als der freudenerregte, halbtrunkene Mann sie umfing, so entsetzt, als sie sich wider Willen Mutter fühlte, so entsetzt, als ihr die Madra das kleine lebendige Mädchen an die Brust legte. Sie hatte sich zusammengenommen, es gelitten, obgleich es sie wie ein Strom eiskalten Wassers durchrann, als sie das suchende Mündchen an ihrer Brust fühlte. Aber als dann Herr Tiralla erschien, sich vor das Bett hinstellte, in dem sie so schwach, so hinfällig, so preisgegeben lag, und vergnügt schmunzelte: ‚Psia krew, das haben wir gut gemacht!‘ — da hatte sie sich nicht mehr bezwingen können. Einen Schrei hatte sie ausgestossen, einen schwachen, klagenden und doch durchdringenden Schrei, und sich so aufgebäumt mit letzter Kraft, dass das kleine Mädchen an ihrer Brust zu wimmern anfing, zu winseln wie ein junges Kätzchen. Ganz erschrocken war die Madra herzugeeilt und hatte ein Kreuz geschlagen: ‚Alle guten Geister!‘ Sie mochte wohl denken, die Krasnoludki, die bösen Zwerge, wollten das Neugeborene rauben. Hastig hatte sie dem Kindchen ihren Rosenkranz um den Hals geschlungen und das Bett der Wöchnerin mit geweihtem Wasser besprengt. Die junge Mutter aber war in Tränen ausgebrochen, in nicht endenwollende, fassungslose Tränen — Danach war Frau Tiralla sehr krank gewesen, so krank, dass der besorgte Herr Tiralla nicht nur den Doktor aus Gradewitz kommen liess, sondern auch den Kreisphysikus aus Gnesen. Beide Ärzte versicherten aber, dass keine Gefahr vorhanden, dass die junge Frau nur sehr schwach und nervös sei. Das hatte Herr Tiralla nicht verstanden. —
Frau Tiralla stand jetzt auf von ihrem Gebet. Nun war es höchste Zeit, ihren Mann anzutreiben, dass er sich auf die Fahrt machte. Womöglich lag der noch im Bette! In einer gewissen zornigen Hast kleidete sie sich an. Heute frisierte sie ihr volles Haar nicht so sorgfältig wie sonst, ihre Hände zitterten, sie hatte Eile. Ihr lauschendes Ohr fing kein Räderrollen auf. Noch wurde der Wagen nicht aus dem Schuppen gezogen, bei Gott, er schlief wirklich noch!
Den Rock hastig überwerfend, die Bluse nicht zuknöpfend, lief sie auf den Ziegelflur, hinüber in das Zimmer, in das sie als zitternde Braut eingezogen war, in dem das kleine Mädchen geboren worden war. Bei Gott, da lag er noch in dem breiten Bett und schnarchte!
„Steh auf!“ Sie packte ihn bei den Schultern und rüttelte ihn.
Seine grauen Haare sträubten sich wie Borsten über der Stirn. Sie fand ihn abscheulich, wie sie ihn so betrachtete. Und wie roch es denn hier im Zimmer? Nach Trinken! All der hässliche Dunst ging von ihm aus!
Kein Mitleid machte ihren Blick weich. Kerzengerade stand sie an seinem Bett, funkelnden Auges mass sie ihn vom Scheitel bis zur Sohle — da würde er nun bald wieder liegen!
Ein jauchzender Schrei wollte sich ihrer Brust entringen. Sie biss sich auf die Lippen — still, still! Was sollte die Magd, die neugierige denken, wenn sie also frohlockte?! Aber sie packte ihn wieder mit erneuter Kraft und rüttelte ihn so stark, dass er auffuhr.
Mit noch gänzlich blöden Augen starrte Herr Tiralla drein: wer war da? Warum liess man ihm denn nicht seine Ruh? Er wollte noch schlafen.
„Steh auf,“ schrie sie ihn an, „du musst fahren! Es ist Zeit! Allerhöchste Zeit!“
„Wer muss fahren? Ich nicht!“ lallte er und fiel schlaftrunken zurück aufs Kissen.
Er war so schwer, dass sie ihn nicht heben konnte, ihr Rütteln half ihr nichts, vergebens war ihr Schreien ‚Steh auf‘. Da goss sie ihm zornig eiskaltes Wasser ins Gesicht. Das half.
Plötzlich ermuntert öffnete er die Augen. „Ah, Täubchen, kommst du? Zärtlich streckte er die Arme aus.
Sie schlug auf die nach ihr langenden Finger. „Lass die Torheiten,“ sagte sie kalt. Aber dann wurde ihr Ton wärmer: „Du hast mir versprochen, nach Gnesen zu fahren — denke daran, es ist Zeit!“
„Nach Gnesen — Gnesen?! werde ich nicht fahren — was soll ich da?!“ Er hatte nicht eine Ahnung mehr. Was er gestern im Rausche versprochen hatte, war heute vergessen.
Verzweifelt sah sie ein, dass sie heute von neuem beginnen müsse. Und sie setzte sich auf sein Bett. Und sie schlang, die Zähne zusammenbeissend, die Arme um ihn, und sie quälte ihn: „Du hast es mir versprochen, du wolltest doch nach der Apotheke fahren — die Ratten — wegen der Ratten — denke doch dran — die Ratten!“
„Was gehen mich Ratten an?!“ Er lachte dröhnend. „Solange nicht Ratten kommen in mein Bett, stören mich Ratten nicht!“ Er küsste sie schmatzend.
Mit geschlossenen Augen litt sie’s, sie war totenblass. Plötzlich entwand sie sich seinen Armen; die schwarzen Augen fest auf ihn gerichtet, sah sie ihn starr an. „Wenn du jetzt nicht nach Gnesen fährst,“ sprach sie langsam — ganz leise, aber man verstand jede Silbe doch deutlich — „werde ich in den Przykop laufen. Ich werde mich ertränken in dem tiefen Tümpel, der dort unter den Fichten steht. Ich kann nicht leben so länger mehr. Gehst du nicht, dann gehe ich!“
Er war verdutzt: was sagte sie denn das mit so seltsamer Betonung, was meinte sie damit? Unsinn! Aber dann entschloss er sich doch. Schimpfend und fluchend erhob er sich: psia krew, was für ein Unsinn war es doch, der paar Ratten wegen Gift ins Haus zu schaffen! Die schlug man doch leicht mit dem Knüttel tot! Er stellte ihr das vor: eine ganze Nacht wollte er gern unten im Keller auf die Rattenjagd gehen.
Aber sie beharrte bei ihrer Forderung. „Du hast es mir versprochen! Geschworen hast du es mir! Nie werde ich dir wieder glauben, wenn du so meineidig wirst. Nie werde ich dir wieder erlauben, nur meinen Finger zu berühren, wenn du so gering ein Versprechen achtest!“
„Nun wohl, ja, ja, ich gehe ja schon,“ sagte er endlich. Was waren denn da noch so viele Worte zu machen? Missmutig und übelgelaunt fuhr er in die Stiefel.
Sie half ihm; diensteifrig hielt sie ihm den Rock hin.
Aber als er schon seine Arme in die Ärmel gesteckt hatte, zog er sie noch einmal zurück: „Ich werde doch nicht fahren. Wozu? Wir werden Fallen stellen, ja ja! Rufe den Jendrek, der mag gehen, Fallen kaufen. Zwei, drei, so viele not tun. Gleich mag er sie holen aus Gradewitz. Rufe ihn!“
Sie rührte sich nicht: sie war so erschrocken, dass sie zitterte: sollte er ihr so noch in letzter Stunde entschlüpfen?
Er stampfte mit dem Fusse auf: ging sie denn noch nicht, musste er selber den Knecht rufen? Unwirsch trampelte er zur Tür.
Da stellte sie sich ihm in den Weg, da fiel sie ihm an die Brust, halb bewusstlos, gänzlich erschöpft. „Ich — ich werde — wenn du mir dieses zu Gefallen tust — werde ich — ich — dir auch zu Gefallen sein!“
Herr Tiralla fuhr nach Gnesen. Frau Tiralla hatte selber mitgeholfen, das Pferd anzuspannen. Sie hatte es dabei zärtlich geliebkost. Dem Knecht wurde heiss und kalt und begehrlich bei den Schmeichelworten, die das schöne Weibchen an den dummen Gaul verschwendete.
„Laufe, mein Pferdchen, laufe,“ sprach sie schmeichelnd dem Tiere ins Ohr. Und dann stützte sie sich schwach gegen die Stallwand; noch immer konnte sie kaum feststehen, noch immer bebten ihr die Kniee, noch immer flatterte ihr Herz wie ein getäuschter Vogel, dem man das Türchen zur Freiheit geöffnet und im Moment, da er ausfliegen will, doch wieder verschlossen hat. Ihr war erst erträglich zumut geworden, als Herr Tiralla, gestiefelt und gespornt, aus der Haustür getreten war. Und während der Knecht das Pferd noch beim Kopf hielt, dass es nicht anruckte, bis Herr Tiralla aufgestiegen war, trat sie dicht an den Wagen heran und reichte ihm die Hand hinauf: „Fahre wohl!“ Es war etwas von wirklicher Anteilnahme in ihrem Ton, und ihre Augen, die so gleichgültig blicken konnten, sahen ihn an wie mit einer Verheissung.
Schnalzend trieb er das Pferdchen an: „Huj, het!“ Dass er nur bald wieder daheim war! Ermunternd knallte er mit der langen Peitsche. Wenn ihr Herz nun mal daran hing, konnte er ihr ja auch gern zu Gefallen fahren, sie war doch ein süsses Weibchen, seine Zosia!
Frau Tiralla hatte ihrem Mann lange nachgeschaut; zum ersten Mal in fünfzehn Jahren fühlte sie etwas wie Zuneigung für ihn, wie Zuneigung und Dankbarkeit. Aufatmend ging sie dann ins Haus zurück.
Da war es ganz still, so leer, als hätte Herr Tiralla mit seiner lauten Stimme und seiner Breite nie hier gewohnt. Die Magd holte vom Feld aus der Miete Kartoffeln herein, die Knechte waren in der Scheune, Rózyczka in der Schule. Sie war ganz allein.
„Ah!“ Mit einem tiefen Seufzer hob die Frau die Arme und lief durch die Stube, als durchflattre sie den Raum. Wie wohl war ihr, ach, wie Wohl! So wohl war ihr seit Ewigkeiten nicht gewesen. Sie ging durch die grosse Stube und musterte sie. Hier, wo sein Bett stand, hier stellte sie ein Sofa hin — dies war ja der grösste und schönste Raum im Haus, sie würde eine Besuchsstube daraus machen. Oder wenn Mikolai seine drei Jahre herum hatte und vom Militär heimkam, mochte der sie haben; sie beanspruchte die Stube nicht, sie war mit ihrer Bettkammer ganz zufrieden!
Träumerisch setzte sie sich auf einen Stuhl am Fenster und blickte hinaus in die schneeverhangene Weite. Vom Dorf, das sie sonst durch die offenstehende Hoftür mit seinen tief eingesunkenen Hütten unter den moosbehangenen Strohdächern und den neuaufgeführten Backsteinmauern des stattlichen Kruges wie in einem Rahmen sehen konnte, war heute nichts zu erspähen; alles war zugeweht von treibenden Flocken. Ei, war das ein Gestöber, viel Schnee, dichter Schnee! Wenn das so anhielt, würde sich Herrn Tirallas Fahrt verzögern, so rasch konnte er dann nicht wieder nach Hause kehren. Horch, klang da nicht ein Glöckchen schon, das Glöckchen des Pferdchens, das sie selbst angeschirrt hatte?! Erschrocken fuhr sie auf: er würde doch des Gestöbers wegen nicht umdrehen, nicht etwa unverrichteter Sache wieder nach Hause zurückkehren?!
Sie hielt beide Hände auf das pochende Herz gepresst; den Kopf vorgestreckt, lauschte sie scharf, aber dann lächelte sie beruhigt: ach, das war ja gar kein Glöckchen draussen, das klang ihr hier, hier innen in beiden Ohren! Da fing es jetzt an, förmlich Sturm zu läuten. Eine jähe Glut schlug ihr plötzlich zu Kopf, sie musste sich mit beiden Händen an die Stirn fassen und sie stützen und halten. O weh, wie wurde ihr so ängstlich jetzt! Was hatte sie getan — was wollte sie noch tun?!
Mit verängstigten Augen sah sie sich um, die Stille, die Leere entsetzte sie auf einmal. Was sollte sie denn sagen, wenn nun der Sohn vom Militär kam?! Was sollte sie ihm vorerzählen von seinem Vater? Würde er ihr auch glauben? Würde er nicht gehen und mit Fingern auf sie zeigen: ‚Die da, die da hat’s getan!‘ O, was war das für eine grosse Angst! Woher nur auf einmal diese Gedanken kamen? Sie hatte sich doch vorher keine gemacht!
Aufspringend vom Fensterplatz stürzte die Einsame aus der Stube in die Küche; die Leere jagte sie, quälte, peinigte sie so, dass sie es drinnen in Herrn Tirallas Stube nicht mehr aushalten konnte. Aber auch in der Küche war es leer, die Magd noch immer nicht zurück. Fröstelnd kauerte sich Frau Tiralla beim Herd zusammen — wie weit war er nun wohl schon? War er nun wohl schon in Gnesen? Nein, nein, so rasch lief das Pferdchen nicht — doch, doch, es war wohl möglich, halte sie dem Pferdchen denn nicht Zucker gegeben und ihm mit liebkosender Hand den Hals geklopft? Das lief schon wacker. Und wenn er nun schon in Gnesen wäre, wenn er nun schon in der Apotheke gewesen wäre, wenn er es nun gar schon bei sich trüge, das Gift, das Rattengift?! Sie konnte sich nicht helfen, sie musste laut aufschreien vor Angst. Was hatte sie getan?!
„Ach, ach!“ Wimmernd stützte sie den Kopf. Aber sie hatte ja noch gar nichts getan, noch gar nichts verbrochen, was fürchtete sie sich denn so?!
Aber sie würde es tun!
Mit einer zuversichtlichen Gebärde richtete sie sich aus ihrer Versunkenheit auf und strich sich die Haare aus der Stirn: sie würde es tun, denn sie hatte ja darum gebetet. Es gab kein Zurück mehr; die Heiligen hatten es gehört. Hatte ihr denn der Herr Propst nicht damals, als sie noch klein war, immer gesagt: ‚Was du betest, wird erhört‘?! Nun war ihr Gebet schon vor dem höchsten Thron. Daran war nichts mehr zu ändern. Es sollte so sein. Hätten die Heiligen es nicht so gewollt, so wäre Herr Tiralla ja nicht nach Gnesen gefahren trotz all ihres Drängens, trotz all ihrer Liebkosungen!
Diese Gewissheit beruhigte sie. Sie fing an, in der Küche zu hantieren und in alle Ecken zu gucken, ob die Magd auch nicht wieder vom Essen beiseite geschafft hatte für irgend einen ihrer Liebhaber. Die war ja eine so leichtsinnige Person. Wahrlich, wenn man es nicht als Christenpflicht erachten würde, sie nicht in das Elend zurückzustossen, aus dem Herr Tiralla sie gezogen hatte, so müsste man sie aus dem Hause jagen, je eher, je lieber. Die hatte ja noch nicht genug mit den zwei Würmern, mit denen sie Gott weiss wer hatte sitzen lassen. Eigentlich war’s eine Schande, eine solche Dienstmagd im Hause zu haben!
Und doch war Frau Tiralla froh und atmete erleichtert auf, als Marianna jetzt mit einem Korb voll Kartoffeln in die Küche trat. Sie war glücklich, nicht mehr in der Leere so allein zu sein; sie vergass ganz zu schelten darüber, dass es nun schon Mittag läutete und die Kartoffeln noch nicht auf dem Herde kochten.
Die Magd hatte Herrn Tiralla abfahren sehen — nach Gnesen fuhr er, so hatte ihr der Jendrek gesagt — ei, was brauchte sie sich da zu sputen?! Mit der Pani würde sie schon fertig werden; wenn sie der nach dem Munde redete, dann war die schon still und zankte nicht. Was die bloss mit ihren Ratten hatte?! Gift sollte der Herr holen — durchaus — wie wäre sie denn sonst je so zärtlich gewesen?! Hatte sie, die Marianna, das nicht gestern an der Türe erlauscht? Ei, wie die ihm um den Bart gegangen war, gesponnen hatte sie wie ein Kätzchen, das sich auf dem Schösse zusammenringelt. Rattengift — o weh!
Es war der Magd gewesen, als müsse sie ihrem Herrn, da sie ihn heute davonfahren sah, nachrufen: ‚Halt, fahre nicht!‘ Aber sie hatte sich doch auf den Mund geschlagen: was ging sie’s denn an? Wenn er so ein Esel war — seine Schuld! Und dann hatte sie über dem Liebeln mit dem Jendrek hinter der Stallwand ganz den Herrn vergessen. Erst jetzt, als sie in der Küche die Herrin antraf, fiel ihr alles wieder ein.
„Der Herr ist ausgefahren,“ sprach Frau Tiralla. Und obgleich Marianna nicht fragte, setzte sie rasch hinzu: „Nach Gnesen!“ Und dann mit einem Erröten, das die Lüge ihr in die Wangen trieb: „Er will sich Winterstoffe ansehen, zum Anzug, bei Rosenthal!“
Die Magd sagte noch immer nichts, nickte nur und fing an, flink die Kartoffeln aus dem Korbe zu schälen.
„Er wird auch wohl in die Apotheke fahren um Rattengift!“ Frau Tiralla konnte nicht anders, das drängte sich ihr über die Lippen, ganz wider ihren Willen. Sie musste das sagen. Die Stummheit der Magd trieb ihr das heraus. Warum schwieg die so andauernd, was dachte die?! Ein Zittern befiel sie.
Die Magd hob den Kopf. „Da kann sich die Pani ja freuen!“ Sie seufzte und liess den Kopf wieder sinken: „Armes Herrchen!“
„Wieso — was meinst du? ‚Armes Herrchen‘ — warum sagtest du das?!“ Frau Tirallas Zittern wurde immer stärker.
„Ei, is sich denn nicht ‚armes Herrchen‘, bei solch abscheuliches Wetter fahren zu müssen? Wer weiss, wann wiederkommt armes Herrchen!“ Marianna lächelte.
War dieses Lächeln nun harmlos oder boshaft?! Frau Tiralla zerbrach sich den Kopf: nein, nein, die war doch ganz harmlos! Aber der Schrecken, der sie befallen hatte, wollte noch nicht weichen. Bei Gott, sie musste zusehen, sich mit der Magd zu verhalten! Und wenn die Liederliche ihr auch noch so zuwider war, sie musste gut Freund mit ihr sein! So ging sie denn, als die Magd, jetzt gänzlich verstummend, am Herd stand und immer in einem Topf rührte, in ihre Bettkammer und holte ein buntschottisches Tuch, das sie gern um ihre Schultern getragen hatte. „Da,“ sagte sie und legte es der noch immer am Herd Rührenden um, „es ist kalt, und ich sehe, du hast nichts, um dich zu wärmen!“
„Padam do nóg!“ Wie ein Blitz fuhr Marianna herum, bückte sich und küsste der Herrin Knie. „Ei, schönes Tuchchen, so schönes Tuchchen das! Alle Heiligen mögen es Pani vergelten! Möge sie gesegnet sein bis ans Ende ihrer Tage!“ Sie küsste auch das Tuch und tanzte mit ihm in der Küche herum. „Wie mir gut steht! Ei, ei! Und so weich ist, so warm! Ei, und so bunt!“ Strahlend wie ein beschenktes Kind, legte sie den Finger auf die bunten Farben und weidete sich daran.
Nein, von der hatte sie nichts zu befürchten! Frau Tiralla wurde plötzlich sehr guter Dinge. Nein, so alt war sie denn doch auch noch nicht und auch noch nicht so abgestumpft, um nicht begreifen zu können, wie ein armes junges Ding sich über ein buntes Tuch freut! Sie lachte mit der Glückseligen.
Unter Lachen und Spässen bereiteten sie das Mittagsmahl.
Als Rózyczka verspätet aus der Schule kam, sehr müde und überangestrengt vom Waten durch den Schnee, bereitete die Mutter, gut gelaunt, der Uberhungerten noch einen Extraschmaus: einen goldgelben Eierkuchen mit Himbeermus. Dann kochten sich beide Frauen einen starken Kaffee, stellten auch für Herrn Tiralla ein Töpfchen zurück und wärmten ihm das Bett aus mit heissen Steinen. Warm sollte er liegen nach kalter Fahrt.