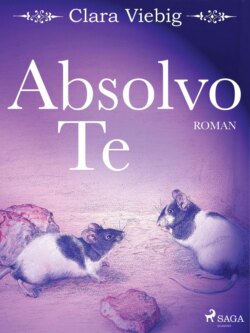Читать книгу Absolvo te! - Clara Viebig - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III.
ОглавлениеRózyczka — Rosa war sie getauft, aber er nannte sie immer Rózyczka, Röschen — war ihres Vaters Lieblingskind. ‚Sein Ebenbild‘, wie Frau Tiralla sagte in einem seltsamen Ton. Ja, die Tochter hatte des Vaters blaue Augen, wenn auch nicht ganz so fahl und wässrig, auch seine Haare, die einstmals, ehe sie missfarben und grau wurden, so blondrot gewesen sein mochten; darum auch hatte die Mutter sich hundertmal abgewandt, wenn das kleine Mädchen auf ihren Schoss verlangt und mit täppisch liebkosenden Fingerchen ihre Wange zu streicheln begehrt hatte.
Aber heute abend war Frau Tiralla liebevoller gestimmt. Verwundert blickte das Mädchen auf, als es eine weiche Hand auf seinem Scheitel fühlte, und schmiegte sich dann sanft mit einem dankbar-glücklichen Aufleuchten der matten Augen an die Mutter.
Herr Tiralla war aus Gnesen heimgekehrt, und nun war es der Frau, als stünde ein Stern über ihrem Haus und wiese ihr hell den Weg, den sie zu gehen hatte. In ihr war eine längst nicht gekannte, befreiende Heiterkeit.
Wie eine Schachtel voller Bonbons, deren er ihr zuweilen aus der Stadt welche mit heimbrachte, so hatte ihr Herr Tiralla das Apothekerpaketchen präsentiert. Hübsch war es eingeschlagen in gestreiftes Seidenpapier und mit rotem Bändchen gebunden. Aber als sie das Schnürchen löste, da grinste auf der Schachtel ein Totenkopf sie an mit darunter gekreuzten Knochen, und ‚Gift‘ hatte sie gelesen und mit einem Aufschrei das Schächtelchen vor sich auf den Tisch fallen lassen.
„Siehst du, nun hast du auch Angst davor,“ sagte Herr Tiralla.
Ah, wie schlecht er sie kannte — sie und Angst?! „Wie macht man’s denn, wie macht man’s denn?“ fragte sie hastig.
Nun belehrte er sie. Er kam sich recht wichtig vor, denn der Apotheker hatte ihn ermahnt, ja recht vorsichtig zu sein. Keinem anderen Menschen würde er so etwas in die Hand geben, hatte der gesagt, selbst auf einen Giftschein hin nicht; nur ihm, dem wohlbekannten Besitzer Tiralla. Hier von diesen weissen Pülverchen, die so harmlos wie feiner Zucker aussahen, streute man auf Stückchen von rohem Fleisch und legte diese in die Ecken: keine Ratte im Keller blieb lebendig. Oder man konnte auch hier aus dem Dütchen von diesem Weizen streuen, dem man’s gar nicht ansah, dass es nicht ganz gewöhnlicher Weizen war, der nur ein wenig rötlicher schimmerte.
„Aber Vorsicht, meine Taube! Zoschchen, ich beschwöre dich, du musst mir versprechen bei deiner Seligkeit, recht vorsichtig zu sein!“ Von einem plötzlichen Angstgefühl befallen, wischte sich Herr Tiralla den Schweiss von der Stirn. Ihm war so heiss auf einmal, trotzdem der Schnee kalt auf seinem Pelzkragen lag und auf seiner Mütze. Er legte ab, warf die Oberkleider von sich und dehnte sich wie beklommen, während sie regungslos am Tische stand und mit glühenden Auge auf das Mitbringsel starrte.
„Was ist denn wirksamer,“ sagte sie ganz verträumt, „die Pulver oder der Weizen?“
„Beides, beides,“ versicherte er ängstlich. „Der Weizen ist schlimm, aber — Heilige Mutter! — von dem weissen Zeuge darf man nur lecken — ah, noch nicht einmal lecken darf man, kaum die Zungenspitze daran bringen, und man ist schon hin. Gift, schreckliches Gift ist’s, furchtbares Strychnin!“ Er schauderte. „Ach, dass ich auch so was ins Haus bringen musste! Der Teufel hat mich geritten. Her damit!“ Er riss es ihr unter den Augen weg und lief hin zum Ofen, in dem die flackernden Holzscheite knackten.
„Bist du verrückt?“ Sie sah seine Absicht: er wollte es verbrennen. Mit einem Sprung war sie ihm im Wege, riss ihm das Päckchen aus der Hand und verbarg es in ihre Tasche.
„Gib’s her, gib’s her!“ schrie er.
Sie lachte ihn aus und hielt ihre Hand fest auf der Tasche.
Da fing er an zu jammern: ach, ach, was hatte er angerichtet! Was war das für eine Dummheit von ihm gewesen, sich so etwas ins Haus zu schaffen! Keine ruhige Stunde hatte man jetzt mehr, ewig musste man denken, es könnte ein Unglück geschehen!
„Aber warum denn,“ sagte sie ruhig und heftete ihre schwarzen Augen fest auf ihn, „warum denn ein Unglück?“
„Ach, ach,“ jammerte er und hielt sich den Kopf.
Sie musste ihn trösten. Ihr Zureden beruhigte ihn; er war wie ein Kind. Zuletzt verlangte er, gestreichelt zu werden; auch das tat sie. Und dann wünschte er, ins Bett gebracht zu werden; er hatte wohl auch getrunken, obgleich er’s leugnete. Die Magd musste auch herbei und helfen; sie zog ihm die hohen Schaftstiefel ab, während er der Frau seinen schweren Kopf an die Schulter lehnte und sie ihn mit ihren Armen umschlingen musste.
Als sie ihn im Bette hatten, waren sie alle beide heiss und rot, so hatte er sie beide schäkernd gekniffen und sich absichtlich unbehilflich gemacht.
Dann liess er sich Rózyczka kommen. Er hatte sie heute den ganzen Tag nicht gesehen; sie war schon nach der Schule gewandert, als er noch geschnarcht hatte, und als er fortgefahren, war sie noch nicht wieder dagewesen. Nun verlangte ihn nach Zärtlichkeit. Das kannte die Kleine schon, dann musste sie sich auf sein Bett setzen und ihre dünnen Ärmchen um seinen Hals legen und ihre kühle Wange fest an sein Gesicht drücken. Dann flüsterte er mit ihr wie mit einer Liebsten und gab ihr hundert Schmeichelnamen. Er nannte sie sein Füchschen, sein Sternchen, sein Vögelchen, sein Sönnchen, seinen Augentrost, sein Balsamkraut, seinen Schutzengel, seinen Himmelsschlüssel, der ihm den Himmel aufschloss.
Und die Kleine lächelte und streichelte ihn mit ihren sanften Händen. Sie war ihm so gut; all das, was ihr die Mutter nicht gewährte, gab ihr der Vater. Und doch hatte sie auch für jene eine heimliche Liebe — sagten denn nicht alle Leute: ‚die schöne Frau Tiralla‘?! und trug ihr der Herr Lehrer, der doch sonst so barsch war, nicht öfters einen Gruss an die Mutter auf und sah ihr wohl gar Fehler nach und zog sie vor, eben weil sie die Tochter der schönen Frau Tiralla war?! Rózia wusste, dass sie nicht hübsch war, wenigstens fand sie sich selber nicht hübsch, wenn sie vorm Spiegel ihre rotblonden, krausen Zöpfe flocht. Schwarz wie Ebenholz und glatt wie Seide war das Haar der Mutter, und doppelt schön erschien ihr deren gelbliches Weiss mit dem Hauch von Rot auf den Wangen gegen die eigenen Sommersprossen. Die Halbwüchsige sehnte sich, schön zu sein, warum, das wusste sie selber nicht; es gab ihr eine gewisse Niedergeschlagenheit und Gedrücktheit, dass sie eben nicht schöner wurde, so inbrünstig sie auch darum betete. Alle Abend kniete sie vor ihrem Bett in der Kammer, die sie mit Marianna teilte, und hob die Hände und flehte und wusste selber nicht recht, um was alles.
Marianna war auch eine gläubige Christin, und oft, wenn sie schon lange im Bett lagen, erzählte sie dem aufgeregt lauschenden Kinde noch von allerlei Zeichen und Wundern, von Besprechungen und Heilungen, von all den merkwürdigen Begebenheiten, die sich da und dort in der Gegend zugetragen hatten.
Hatte nicht ein Besitzer, der Herr Kiebel, als er letzten Jahrmarkt von Wronke nach Obersitzko fuhr, hinter sich im Walde tuten hören, nicht weit vom neuen Judenkirchhof? ‚Tut, tut, tut!‘ Aber er war abgestiegen und hatte vor die zitternden Pferde und neben und hinter den Wagen — rund herum — lauter Kreuze mit dem Peitschenstiel in den Schnee gezeichnet, da war der Nachtjäger an ihm vorübergesaust mit ‚Tut, tut‘ und Gebell und schrecklichem Gejage. So stark war das Flattern seines Mantels gewesen, dass es Pan Kiëbelski beinahe vom Wagen heruntergeweht hätte; aber die Kreuze schützten den Frommen, der Nachtjäger musste weiter.
Und bei Ossówiec war ein Berg, auf dem hatten die Hexen im vergangenen Juni sich versammelt und würden es nun bald wieder im Dezember tun und beratschlagen, wo sie überall hinfahren wollten in Staub und Wind. Aber malte man an Türen und Wände ‚K M B‘, die Anfangsbuchstaben der heiligen drei Könige, so konnten sie nicht hinein, und dann konnte einem keine Hexe ’was in den Teller spucken. Oder aber man brauchte auch nur, ehe man ass und trank, bei sich zu sprechen: ‚Gesegne es Gott‘, dann schadete kein Hexenwerk, Gott hielt seine Hand über den Teller gereckt.
Gott Vater — wer fleissig zu ihm betete oder zu Jesus Christus, seinem Heiligen Sohne, oder zur Hochheiligen Mutter Maria, der brauchte auch den Teufel nicht zu fürchten, der vor vier Wochen in Latalice, nördlich von Gradewitz, dein Müller Kiërski, der immer fluchte und so fleissig trank, hinter seiner Scheune auf dem Mist in der Mitternacht beinahe den Hals umgedreht hätte. Ganz steif hatte er schon dagelegen und ganz blau im Gesicht; wenn nicht Sankt Petrus Hahn auf das Mühldach geflogen wäre und da dreimal gekräht hätte, sodass der Teufel vermeinte, der Haushahn krähe schon den Morgen an, so hätte man Müller Kiërski mit herumgedrehtem Kopfe, das Gesicht im Rücken, mausetot gefunden; seine Seele aber wäre schon in der Hölle gewesen.
Marianna glaubte fest daran, dass die Nachtgespenster auch hier in den Fichten schrieen, dass die Hexen in den Winden tanzten, die draussen fauchten; vor allem aber, dass der Teufel, der unten im Przykop wie ein Irrlicht umherlief, gern ins Haus hinein wollte, um sich eine Seele zu holen für seine Hölle. Aber auch, wenn sie selber nicht so fest an all dies geglaubt hätte, so wäre es ein Vergnügen für sie gewesen, dem zitternden Kinde, das längst aus seinem Bett in das ihre gekrochen war, und sich dicht an sie schmiegte, allerlei Seltsames zuzuwispern. Immer abenteuerlicher wurden die Erzählungen, immer schauriger. Die Stunde der Nacht, das Stöhnen des Windes, das Klagen der Käuzchen, die in den alten Fichten am tiefen Grund hockten, vor allem aber die Dunkelheit der Kammer, die Schneestille, die Abgeschiedenheit, befruchteten die Phantasie der Magd. Alles gewann ein Gesicht und belebte sich; in jedem Baum seufzte ein Wesen, aus jedem Stein sprach eine Stimme, unter jedem Acker rang ’was nach Luft, in jedem Tümpel lauerte etwas Zweige, die an die Scheiben klopften, waren die Finger Abgeschiedener, Sterne, die über’s Haus zogen, waren wandernde Seelen, und Wolken und Winde waren der Prophezeiungen voll. Als sie noch ein Kind gewesen war, so versicherte Marianna, und ins Korn gelaufen war, um Ähren zu raufen und sich von den roten Mohnblumen einen Kranz zu binden, da hatte der Zagak sie beinahe gegriffen, ein grosser Mann mit einem Knotenstock, mit einem zerlöcherten Hut auf seinem Kopf und mit Schuhen, aus denen die Zehen heraussahen. Wäre da nicht zufällig ein Bauer, ein frommes Lied singend, in der Nähe vorbeigefahren mit knarrenden Rädern, so hätte der Zagak nicht von ihr abgelassen. So war sie davongekommen mit dem blossen Schrecken und mit einem zerrissenen Rock. Ihr schauderte noch, wenn sie an den Zagak dachte — hu, hu! Gut, dass der Mann nicht hier herein ins warme Bett zu ihr konnte! In wollüstigem Schauer rüttelte sich die üppige Magd, und sie und das Kind schlossen sich enger aneinander.
Dann krampften sich Rózyczkas Fingerchen fest um Mariannas derbe Finger, und sie singen alle beide an zu beten aus Leibeskräften. Was blieb ihnen weiter übrig in Nacht und Einsamkeit, umgeben von bösen Geistern, die sich in der Finsternis überall hervorstahlen?! Sogar aus des Menschen Brust. Nur Beten rettete. Und sie beteten und beteten.
Dann liefen über Rózyczkas zartes Gesicht Schweisstropfen und Tränen, und ihre Glieder zuckten. Ach, wenn doch die Gottesmutter käme und sie unter ihren blauen Mantel nähme! Ihr war so bang, so weh. Der Kopf schmerzte sie, der Rücken und die Brust auch, der Hals wurde ihr eng, ordentlich schwer fiel ihr das Schlucken; wie Fieber brannte es ihr in den Augen.
„Heilige Maria, Gottesmutter!“ Die angstvollen Augen des Kindes, die kaum über das Deckbett wegsahen, so hoch hatten sie sich’s heraufgezogen, bohrten sich ins Dunkel. „Alle guten Geister loben Gott! Liebe Heilige Mutter, gegrüsst seist du, Maria“ — — — ah, da war sie ja, da stand sie ja im Dunkel und nickte!
Das Dunkel war auf einmal kein Dunkel mehr, und das Klopfen der Finger am Fenster und das Ächzen des Windes ums Haus verloren auf einmal das Schreckliche. Ei, wie lieb war die Gottesmutter, wie sanft, und so schön! Sie nahm das verängstigte Kind in ihren Schutz und lächelte ihm zu, bis seine brennenden Augen zufielen, bis ein herrlicher Traum, der noch kein fester Schlaf war, aber doch ein wohliges Hindämmern, seine Seele mit einem süssen Schreck erfüllte. —
Kein Wunder war es, dass Rózia Tiralla, als ihr Vater heute abend mitten im Schäkern mit ihr wieder zu jammern anhub: „O, was habe getan, o, o, die Angst! Keine ruhige Stunde habe ich mehr! Der Teufel hat bei so ’was die Hand im Spiele —“ sehr ernsthaft sagte: „Warum hast du Angst? Rufe die Gottesmutter an, die trägt einen blauen Mantel, darein wickelt sie dich. Ich habe auch oft Angst, aber dann habe ich keine Angst mehr. Soll ich sie rufen?“
„Ja ja!“ Herr Tiralla, der zu anderen Zeiten laut gelacht haben würde, nickte heute heftig. Und dann flüsterte er dem Kinde ins Ohr, so leise, dass seine Zosia, die am Tisch wie auf dem Sprunge stand und lauschte, nichts verstehen konnte: „Ich habe Angst, ich weiss nicht warum. Bete, bete!“
Rózia rutschte vom Bett herab, kniete nieder auf dem Rehfell davor und hob die zusammengelegten Hände zu ihrem blassen Mund. Sie betete inbrünstig. Es waren die alten, tausendmal gebeteten, mechanisch hergesagten Gebete, aber von ihren Lippen bekamen sie Feierlichkeit. Des Mädchens dünne Stimme wurde tiefer und klangvoller. Das rötliche Haar bauschte sich locker um die Schläfen, der Lampenschein fiel darauf; es war wie ein Strahlenkranz.
Frau Tiralla hob den Kopf und sah die Tochter an; sah sie an und stutzte, herausgerissen aus Gedanken, die sie durchstürmten mit einer solchen Unwiderstehlichkeit, dass sie schwach wurde, unfähig zu jedem Widerstand. Ei ja, da war Rózia und da Rózias Vater, aber ganz war Rózia doch nicht ihres Vaters Ebenbild — ah, die hatte auch ’was von ihr! Und Frau Tiralla fühlte sich wie mit Zauberkraft um zwanzig Jahre verjüngt, sah sich in ihres Propstes stiller Studierstube und vernahm wiederum die wunderbaren Dinge, mit denen er sie so unwiderstehlich an sich gefesselt hatte. Still hatte sie dabei gesessen, aber heiss war sie geworden und rot; noch jetzt fühlte sie, wie das Blut ihr damals zu Kopf geschossen war wie im Rausch.
Ach ja, die da, das Mädchen da, bei Gott, die musste Nonne werden! Das krause Haar, das im Lampenschein flimmerte, würden sie ihr abschneiden und unter den Brautschleier der Kirche tun; die Linnenbinde würde die Stirn bedecken und das Kinn. Nur das feine Näschen guckte hervor und die blauen Augen — ah, wie lieblich würde Rózia aussehen in der heiligen Tracht! Als Rose würde sie blühen in des Heilands Garten. Eine plötzliche Liebe für ihre Tochter erfasste Frau Tiralla, sie ging hin und legte ihre Hand auf des Mädchens Scheitel. —
Heute abend war Rózia glücklich. Ihre Mutter hatte zur guten Nacht sie gar geküsst, und ihr war dabei, als durchzucke sie eine Flamme. Heute mochte sie nicht Mariannas Geschichten hören, nach denen sie sonst immer verlangte. ‚Ich will nur beten,‘ sagte sie. Und sie betete, dass ihre Mutter ihr doch immer lächeln möge. Sie bewunderte sie ja so sehr, ihren schlanken Wuchs, ihr schönes Haar und ihre samtigen Augen. Niemand war so schön wie die Mutter, nur die Gottesmutter noch!
Während Rózia noch betete, fielen ihr schon die Augen zu, und im Eindämmern sah sie plötzlich die Gottesmutter am Bette stehen. Die hatte ganz genau dasselbe Gesicht wie die Mutter und trug auch dasselbe Kleid, einen dunkelblauen Rock und eine hellrot gestreifte Bluse. Und die Gottesmutter beugte sich über sie, so dicht, dass sie deren warmen Atem an ihrer Wange fühlte — die horchte wohl, ob sie schon schliefe. Dann richtete sich die Gottesmutter wieder auf und horchte hinüber nach dem Bette, in dem Marianna längst schnarchte, und dann ging sie leise zur Tür hinaus. O, wie schön, wie schön war doch die Gottesmutter! Mit lallenden Gebetsworten auf den Lippen schlief die Kleine fest ein.
Aber Marianna schlief nicht, wenn sie sich auch so gestellt hatte. Was hatte denn nur Frau Tiralla, dass sie bei nächtlicher Zeit durchs Haus wanderte?! Das Ohr des Landmädchens, das scharf war wie das des Waldtieres, hörte das leise Tappen treppauf, treppab — der Ruhelosen Umhergehen durch die Räume. Warum schlief die Herrin nicht? Und was hatte sie vorhin hier oben gewollt, hier oben bei ihnen in der Kammer?! Die trieb ’was um!
Als das Kind gleichmässig und tief atmete, setzte sich die Magd aufrecht im Bett und legte die Hand hinters Ohr: nun war die Frau in der Küche — psia krew! — was rappelte die denn so mit der Kaffeemühle? Oder war es die blecherne Dose, in der sie den Zucker verwahrten, mit der sie so klapperte?!
„Alle guten Geister!“ Marianna schlug ein Kreuz — sollte die da unten wohl dem Teufel zu Gefallen sein?! Gift hatte der Herr mitgebracht aus Gnesen — Rattengift! Die hurtigen Augen der Magd hatten die Schachtel wohl auf dem Tisch stehen sehen, die weisse Schachtel aus der Apotheke mit dem schwarzen Totenkopf darauf. Wenn die da unten nun dem Herrn ’was davon in den Kaffee mahlte oder unter den Streuzucker mischte, den er, ein ganzes Schälchen voll, in seine Tasse zu schütten liebte?! Heilige Mutter!
Ganz klein machte sich die Magd im Bett und zog sich das Deckbett bis über die Ohren. Sie wollte nichts sehen, sie wollte nichts hören. Was ging sie’s an?! Der Herr war gut, die Herrin war aber eigentlich auch gut, es war immerhin eine schwere Sache für einen armen Dienstboten, der noch dazu zwei Kinderchen auf dem Halse hatte, sich ganz auf die eine Seite zu schlagen. Es war besser, man verhielt sich nach beiden Seiten!
Aber obgleich Marianna zuletzt beide Zeigefinger in die Ohren steckte — das dicke Federbett genügte ihr noch nicht — so hörte sie das ruhelose Hin und Her doch. So ging’s bis gegens Morgengrauen, sie konnte darüber nicht schlafen. Das war ihr sonst kaum je passiert, dass sie eine Nacht nicht völlig verschnarcht hätte; heute krähte schon der Haushahn auf dem Mist, und die Kühe brüllten dumpf, als sie endlich eindruselte.
Sie hatte sich gründlich verschlafen; als sie nach ängstlichen Träumen auffuhr, stand Rózyczka schon vor dem Spiegelscherben und flocht ihre beiden Zöpfchen, und vom Hofe herauf klang schon Holzschuhgeklapper, und die Kette, an der Jendrek den Wassereimer aus dem Brunnen zog, klirrte.
„Jesus Maria!“ Ärgerlich fuhr Marianna aus dem Bett und herrschte die Kleine an: „Warum wecktest du mich nicht, du Kobold?“
„Gerade, jetzt gerade wollte ich es tun,“ entschuldigte sich Rózia, die in ihrem kurzen Unterröckchen und den blossen Schultern noch recht unentwickelt und dürftig aussah. „Gerade wollte ich dich anstossen!“
Aber man sah es Rózia an, sie hatte gar nicht daran gedacht, die Magd zu wecken, ihre Gedanken waren anderweitig in Anspruch genommen. Sie träumte eben weiter mit offenen Augen. Ach, wenn sie doch sagen dürfte, was sie geträumt hatte! Es war so schön gewesen! Die Gottesmutter hatte ihr das Jesuskind zu halten gegeben, und sie hatte das weiche, warme Körperchen an ihrer Brust gefühlt. Wie es sich anschmiegte! Selig lächelte die Halbwüchsige in den blinden, seifen-bespritzten Spiegelscherben hinein.
Marianna rannte ungewaschen, ungekämmt hinab in die Küche. O weh, da stand schon die Herrin, sauber frisiert und niedlich wie immer, am Herd! Hatte sie wohl gar schon den Kaffee gemacht?!
Frau Tiralla sprach: „Der Kaffee ist fertig, du kommst ja so spät!“ Aber sie schalt nicht über’s Verschlafen, sondern händigte der Magd das Tablettchen ein, darauf die Kaffeetasse stand, gross wie ein Kübel: „So, das trage ihm nun hinein. Gesüsst ist schon!“
Mit aufgerissenen Augen sah Marianna die Herrin an. Alle Verschlafenheit war plötzlich von ihr gewichen; alles, was sie heute Nacht sich ausgedacht hatte, fiel ihr auf einmal wieder ein. Sie stotterte etwas und stand noch, bis die Herrin lachend rief: „Aber so bringe es ihm doch, was stehst du so dümmlich?!“
„Nein, es konnte nicht sein, dass einer, der ’was Giftiges in den Kaffee getan hatte, so lachen konnte; Marianna war ziemlich beruhigt. Aber als sie das Tablett über den Ziegelflur trug, schlug sie zur Sicherheit doch lieber ein Kreuz darüber: „Gesegne es Gott!“ Nun schadete es nichts! Und als ihr der Kaffee warm und stark in die Nase duftete, konnte sie sich nicht enthalten, rasch einen Schluck zu tun. Sie war noch so nüchtern, was Warmes würde gut tun! Ei, und war der Kaffee mal stark; trotzdem er gesüsst war, schmeckte er noch so bitter — pfui! Aber gut war er doch! Noch einmal einen ordentlichen Schluck.
Da schrie innen Herr Tiralla: „Psia krew, Frauenzimmer verdammtes, du naschest wohl, dass ich meinen Kaffee nicht kriege!“ Ein Stiefel, von kundiger Hand geschleudert, flog durch die halbgeöffnete Tür der Marianna mitten vor die Schürze. Da schrie sie hell auf und liess das Tablett fallen; auf ihre Füsse, auf den Ziegelflur hinab floss der gesüsste Kaffee.
„Psia Krew!“ Ein zweiter Stiefel kam geflogen. Die Tür sprang nun vollends auf, und man sah Herrn Tiralla auf seinem Bettrand sitzen, im kurzem Hemd, und mit den blossen Beinen nach den Pantoffeln angeln, die unters Bett gerutscht waren.
Auf der Schwelle stand die Magd, ganz begossen.
Herr Tiralla brach in ein schallendes Gelächter aus. „Du bist ein Tolpatsch, du bist ein Ungeschick!“ schrie er und klatschte sich die Lenden. „Bei Gott, nie habe ich ein dümmeres Schicksel gesehen! Glotze mich nicht so dummlich an — na na, zu heulen brauchst du nicht gleich! Geh, hole neuen Kaffee!“
„Die Pani wird mich schlagen!“ schluchzte das Mädchen. „Hab ich Angst, o, hab ich grosse Angst!“
„Frau,“ rief Herr Tiralla, der besonders gut ausgeschlafen hatte, „Frau, das dumme Mondkalb hat den Kaffee vergossen — Zoschchen, schlage sie nicht!“
Schon war Frau Tiralla zur Stelle; sie wurde totenblass, als sie den gesüssten Kaffee am Boden rinnen sah wie ein braunes Bächlein, und wurde dann glühend rot.
Schon duckte sich die Magd: jetzt würde die Herrin losschlagen! Aber sie schlug nicht los. Sie erhob nicht einmal drohend die Hand, sie sagte nur: „Es hat nicht sollen sein. Mache ihm einen anderen Kaffee!“ Holte dann selber einen Lappen, wischte selber auf, las die Scherben zusammen und sagte kein Wort weiter.
Marianna war ganz verwirrt: noch nie hatte sie einer Herrschaft etwas zerschlagen, ohne dass sie dafür einen Denkzettel bekommen hätte — und heute nicht mal eine Ohrfeige, nicht mal die Androhung einer solchen! Marianna ging umher wie ein witternder Hund: hier ging ’was nicht mit rechten Dingen zu! Hier war es nicht geheuer! Sie belauerte die Herrin. Aber die sass drinnen in der Stube beim Fenster und las; der Herr war hinaus anfs Feld gegangen, einen Hasen wollte er schiessen. Und Rózyczka war in der Schule. Ach, hätte sie nur eine Menschenseele zum Reden gehabt!
Die Magd fühlte sich beklemmt, als drücke sie ein viel zu schweres Geheimnis. Aber sie fühlte sich auch in Wirklichkeit seltsam beklommen auf der Brust. Was war das nur?! Sie musste in einem fort hastig atmen wie unter einem schweren Druck und den Speichel, der ihr im Munde zusammenlief, konnte sie gar nicht herunterkriegen; die Kehle war ihr so enge. Eine plötzliche Angst fiel sie an. Und einen Durst hatte sie, einen Durst! Der Mund war ihr so trocken, wie ausgebrannt. Schwankend ging sie zum Wassereimer, sie wollte trinken, aber sie konnte nicht. Heilige Mutter, warum konnte sie denn auf einmal nicht schlucken?! Ein Zittern lief ihr durch den ganzen Körper, ein Zittern, so stark, dass sie sich hinsetzen musste, wo sie gerade stand, platt auf den Boden. O, wie war ihr schlecht, ganz entsetzlich schlecht! Es wurde ihr schwarz vor den Augen, nass wurde sie am ganzen Körper von Schweiss. Und jetzt konnte sie auf einmal gar nicht mehr atmen. Sie wollte schreien, um Hilfe rufen, auch das konnte sie nicht. Sie rang, um aufzukommen, aber sie war steif wie ein Brett; der Kopf sass ihr fest wie in Eisen. Ihre Fäuste ballten sich im Krampf. O blutiger Heiland, erbarme dich! Sollte sie sterben hier?! Wie weh tat ihr alles, alles so weh, Brust, Bauch, Arme, Beine!
In furchtbarer Hilflosigkeit lag die Magd am Boden, bis der Atem ihr wiederkam und sie sich stöhnend aufraffen und hinauswanken konnte aus der Küche hinters Haus. Da stand sie nun, sich mit einer Hand gegen die Hauswand stützend, und ein schreckliches Würgen, bei dem es ihr bitter in den Mund kam, grausig bitter, erschütterte sie so, dass sie sich kaum auf den Füssen erhielt.
Jendrek kam dazu. Er lachte sie aus, als er sie so dastehen sah: he, war sie denn heimlich zu Tanze gewesen? Erntefest war doch schon vorüber, und Heilige drei Könige war noch nicht da! Er höhnte: ei, ihr hatte es aber mal gut gemundet! Was hatte sie denn Leckeres gegessen und getrunken, dass sie zu voll davon war?!
Sie gab keine Antwort. Sie konnte nur ein wenig den Kopf heben und ihn seltsam anstarren mit Augen, in denen die Pupillen ganz riesig gross waren.
Da bekam er doch einen Schrecken — hu, sah die aus! — und anstatt ihr zu sagen, wie es ihn freue, dass sie auch einmal fühle, wie ihm des Montags immer zumute sei, packte er sie am Arm: „Fehlt dir ’was? Sage!“
Sie aber stöhnte und nickte schwach. Wie er vorhin gesprochen hatte: ‚Was hast du gegessen?‘ — ja ja, da hatte es ihren dumpfen Schädel durchfahren: ihr war ’was angetan, sie hatte ’was gegessen oder ge — —
Und: „Gift, Gift!“ schrie sie plötzlich gellend auf, warf sich zu Boden und wälzte sich heulend, dass der Knecht zehn Schritte zurückfuhr vor Schrecken.
Frau Tiralla musste innen im Haus das Schreien auch gehört haben, schon kam sie heraus. Sie lief hin zur Magd, und als diese noch immer grässlich schrie: „Gift, Gift!“ und sich, die Hände auf den Leib gepresst, wie eine Unsinnige wälzte, wurde sie selber so leichenblass, dass der Jendrek dachte, auch sie würde gleich umfallen. „Still, still,“ sprach Frau Tiralla hastig und drückte der Marianna die Hand auf den Mund. Als diese sich wehrte und dumpf weiter gurgelte: „Gift, Gift,“ sah sie um sich wie ein in die Enge getriebenes verängstigtes Tier.
Dem Jendrek wurde ganz angst vor den wirren Augen der Frau. „Werde ich laufen nach Gradewitz, Doktor holen,“ sagte er sehr verschüchtert.
„Nein,“ stiess die Frau heraus. Und dann, sich ermannend, schrie sie ihn an und hielt ihn am Kittelzipfel: „Bist du verrückt? Sie ist nur betrunken — nur betrunken — weiter nichts!“
„Bin ich nicht betrunken,“ heulte Marianna; und dann wurde sie wütend: „Der Esel, der Jendrek, spricht, ich sei betrunken. Soll er sich an eigene Nase ziehen. Hab ich nicht getrunken — nichts — keinen Tropfen nicht, kann ich schwören bei Gott!“ Marianna konnte jetzt auf einmal wieder sprechen. „Der Esel der! Hab ich nur Gift in Leibe — bin ich vergiftet — muss ich sterben — o, o!“
Der Knecht machte grosse Augen. Frau Tiralla sah, wie er aufhorchte; sie wurde so glühend rot, wie sie vordem blass gewesen war, Blässe und Röte jagten sich förmlich auf ihrem Gesicht. Gezwungen lachte sie kurz auf: „Unsinn — Gift — woher?! Du sprichst irre, mein Kind! Komm, so“ — sie half der Magd vom Boden auf — „so, stütze dich auf meinen Arm! Ist dir schon besser — ja, nicht wahr, es ist dir schon besser? Ich werde dich zu Bette bringen. Ich werde dir einen starken Tee kochen. Ich werde dir Wärmkruken machen. Und danach, wenn dir besser wird sein, werden wir sehen, ob dir von meinen Unterröcken einer wird passen, du musst wärmer gekleidet gehen!“ Sie befühlte das dünne Röckchen der Magd. „Sie hat ja nichts an! Sie hat sich erkältet! Ich werde schon sorgen. Dir ist jetzt besser, nicht wahr? Heilige Mutter! Marianna, so sage doch, dir ist schon besser?!
Marianna schüttelte verneinend den Kopf. Sie tat nun wieder sehr kläglich, verdrehte die Augen, stöhnte, wimmerte und hing sich so schwer an die Herrin, dass sie alle beide taumelten.
Jendrek musste zuspringen. Sie nahmen das Mädchen in die Mitte und schleiften es ins Haus hinein, die Treppe hinauf und ins Bett.
Der Knecht, als er sah, wie sich die Herrin um die Magd mühte, glotzte ganz starr: ‚Bei Gott, die war aber mal eine gute Frau!‘
Frau Tiralla rieb der Marianna die eiskalten Füsse und die Hände, und dazwischen fragte sie in einem fort: „Ist dir noch nicht besser? Ach Gott, dir ist doch schon besser, nicht wahr?!“
Es rührte den Knecht, wie die Gute sich ängstigte; man hörte es ja ihren Fragen an: ‚Ist dir schon besser, ist dir denn noch nicht besser?!‘ Da möchte man auch schon krank sein, dachte sich Jendrek und nahm sich vor, das nächste Mal am Montag auch so zu schreien und zu stöhnen: ‚Gift, Gift!‘ und sich auch so lang an den Boden zu legen und sich auch so zu wälzen. Es musste recht süss sein, wenn der Frau weiche Hände einen so streichelten — über die Backen, über die Stirn — wie sie jetzt der Marianna tat, und sie dabei fast weinte. Und wenn sie dann in die Küche rannte, was hast du was kannst du, und Tee brachte, gutes Warmes, eine ganze Tasse voll, und einem die an die Lippen hielt: ‚Trinke, mein Liebchen, trinke!‘
Aber Marianna mochte nicht trinken. Sie schlug der Herrin fast den Tee aus der Hand. Und als diese sanft zuredete: „Trinke, ei, so trinke doch, es wird dir gut tun,“ sagte sie patzig: „Werd ich mich hüten. Trink ich nicht!“ und kehrte sich ab, das Gesicht nach der Wand zu.
Ei, warum trank sie denn nicht so etwas Gutes?! Das hätte der Knecht gern gewusst.
Aber Frau Tiralla fragte nicht. Die Tasse klirrte in ihrer Hand; als sie vom Bette zurücktrat, zitterte sie so, dass sie sich hinsetzen musste auf den nächsten Schemel. Für einen Moment schloss sie die Lider ganz schwach. Aber dann riss sie sie auf, und die fragenden Blicke des Knechts bemerkend, sagte sie, wie entschuldigend, ihn dabei anschauend mit einem süssen, schüchternen Lächeln fast: „Ich bin nicht sehr stark. Mich greift es so an. O, der Schrecken!“
Als sie nun die Treppe hinabstiegen, die steil war und dunkel, tastete sie nach seinem Arm: „Führe mich, Jendrek! Ich kann nicht allein gehen. O, die arme Marianna!“