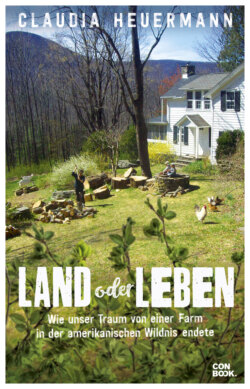Читать книгу Land oder Leben - Claudia Heuermann - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. KAPITEL ANKUNFT UND NIEDERKUNFT
ОглавлениеIch glaube, heute ist der Tag gekommen. Leila wollte schon am Morgen nicht raus. Jetzt steht sie mit gekrümmtem Rücken in der Ecke und gibt eigenartige Geräusche von sich. Es klingt wie ein Wimmern, und ich frage mich, ob sie Schmerzen hat. Sie dreht den Kopf, verdreht ihre schönen bernsteinfarbenen Augen und schaut mich flehend an. ›Tu was‹, scheint sie zu sagen. Ich bin nervös und weiß nicht, ob ich zu ihr gehen soll, ob sie meine Unterstützung oder lieber ihre Ruhe haben will. Ich bin mindestens so unruhig wie sie, es ist für uns beide das erste Mal. Hektisch beginne ich, die nötigen Sachen zusammenzusuchen. Plastikhandschuhe. Antibakterielle Flüssigseife. Saubere Handtücher. Jod. Auch einen Eimer mit warmem Wasser stelle ich bereit. Ich gebe Leila einen dicken braunen Vitamincocktail zur Stärkung – so steht es im Buch. Dann heißt es: warten.
Es ist nun fast ein Jahr her, dass wir unser Bauernhaus bezogen haben und mit Leidenschaft in das neue Leben eingetaucht sind. Dabei waren die ersten Wochen und Monate angefüllt mit Renovierungsarbeiten. Das undichte Dach des alten Hauses musste gedeckt, Kabel und Leitungen repariert werden. Auch die teils verrottete Außenfassade benötigte sofortige Aufmerksamkeit, in den Wänden schimmelte es bereits. Wir reparierten so viel wie möglich selbst, nur für einige wenige Spezialarbeiten ließen wir Experten kommen. Es gab nämlich nicht allzu viele Fachkräfte in der Gegend, und die wenigen, die es gab, kamen entweder immer zu spät, oder sie tauchten gar nicht erst auf. Wie Chuck, der langhaarige Dachdecker, der schon morgens nach Alkohol roch und eine Seite unseres Giebels mit Schindeln versah, doch dann nicht mehr gesehen ward. Sein Geld holte er auch nie ab (Rechnungen und Banküberweisungen stellten sich generell als unpopulär heraus), und wir konnten nur mutmaßen, was ihm wohl widerfahren war.
»Vielleicht hat er einen besseren Job gefunden«, spekulierte der vierjährige Paul.
»Oder er ist vom Dach gefallen«, argwöhnte Phillip.
»Unsinn, sicher hat er so viel Arbeit, dass er nicht mehr weiß, wo ihm der Kopf steht«, stellte Tom klar.
Ich enthielt mich eines Kommentars. Wir nahmen die Dinge selbst in die Hand, und obwohl es anstrengend war, sich um alles zu kümmern und dabei auch noch die Kinder zu versorgen, erfüllte uns die Arbeit mit Freude und Glück. Hier angekommen zu sein, den eigenen Hof aufzubauen und die Zukunft zu gestalten fühlte sich großartig an. Wir hatten es gewagt, fühlten uns frei und stark – und konnten alles schaffen!
Tom erneuerte neben dem Dach die hölzerne Fassade samt blätternder Außenfarbe, während ich Innenwände und Decken reparierte und sämtlichen Räumen einen neuen Anstrich verpasste. Die zerbrochenen Glasscheiben wurden ersetzt, und danach brachten wir Kamin, Terrasse und schließlich auch die Scheune auf Vordermann. Da in der Wildnis keine Wasserleitungen verlegt waren, hatten wir eine eigene Quelle und Sickergrube. Zum Glück stellte sich hier alles als einigermaßen intakt heraus, und die sanitären Anlagen waren benutzbar. Die Stromversorgung funktionierte zu Beginn zwar nicht, eine Überlandleitung musste repariert, die Verbindung zum Haus hergestellt werden, doch da wir im Sommer einzogen, ließ sich damit leben – der Elektriker war bestellt.
Bis dahin kochten wir über dem Feuer im Garten, gingen bei Sonnenuntergang schlafen und lebten im Rhythmus der Natur. Ich freute mich auf jeden neuen Morgen, freute mich darauf, die von der aufgehenden Sonne rot angeleuchteten Berge zu bestaunen und den Tag mit Tom und einem Bad im Fluss zu beginnen. Das Wasser des Esopus war kalt und glasklar, man konnte die bemoosten Steine auf dem Grund genau erkennen, ebenso wie die kleinen Forellen, die pfeilschnell hin und her flitzten. Zu dieser frühen Stunde hingen noch Nebelfetzen über dem Wasser und zwischen den Bäumen, und die kleine Bucht, die wir gleich zu Anfang für uns entdeckt hatten, bekam etwas absolut Magisches. Nach der morgendlichen Erfrischung tranken wir bitteren Cowboykaffee und frühstückten Äpfel direkt vom Baum. Und dann hämmerten, pinselten, spachtelten und schliffen wir wieder, bis es dunkel wurde.
Es waren aufregende, intensive und schöne Wochen, und an manch einem Abend sanken Tom und ich uns nach getaner Arbeit glücklich und erfüllt in die Arme, spürten die warme Erde unter unseren Körpern und waren uns und der Natur so nah wie nie zuvor.
»Hörst du das?«, wollte ich an einem dieser Abende wissen.
»Hmm. Klingt wie eine Banshee.«
»Das war irgendein Tier.«
Wir lagen eng umschlungen im Dunkeln auf der Wiese neben unserem Haus, die warme Luft roch nach Lagerfeuer und geschnittenem Gras. Es war spät, fast Mitternacht, aber wir wollten den Tag noch nicht beenden. Wir schauten in den Himmel, sahen die Abermillionen Sterne an, selbst die Milchstraße war gut zu erkennen. Wir konnten das Universum fühlen.
»Huh-hu-hu-huuarrr«, klang es wieder, viel näher als vorher.
Ich versuchte, in der Dunkelheit etwas zu erkennen, schaute in die Richtung, aus der das Heulen gekommen war. Nichts. Nur die Schatten der Bäume konnte ich ausmachen, wie eine schwarze Wand ragte der Wald in einiger Entfernung auf. Ich hatte plötzlich genug vom Draußensein.
»Lass uns reingehen, okay?« Ich stand auf und sammelte unruhig meine Sachen ein.
Da war es wieder. Eindringlich und laut. Diesmal kam es von oben.
»Ich hab’s doch gesagt, es ist ein Geist«, rief Tom halb erschreckt und halb amüsiert, als ein großer schwarzer Schatten über uns hinwegsegelte.
Wir vernahmen hier viele nie gehörte Geräusche, furchterregend zuerst, dann aber immer vertrauter. Wie diesen gruseligen Schrei des Streifenkauzes. Und das noch unheimlichere Heulen der Kojoten, die manchmal bis zum Haus kamen. Wenn sie mit ihrem Rudel, mit ihren Familien kommunizierten, dann schallte es wie ein hohes Jammern, manchmal wie ein gespenstisches Lachen oder auch wie menschliches Schreien durch die Nacht. Und dann war da dieses lang gezogene, laute und klägliche Pfeifen, von dem wir erst später lernten, dass es von winzigen Baumfröschen, den spring peepers, herrührte, die so ihre Weibchen anlockten.
Manche der nächtlichen Rufe und klagenden Schreie haben wir nie identifizieren können, aber wir wussten, dass es hier Luchse, Füchse, Bären und angeblich sogar Berglöwen gab.
Ich warte noch immer, eine Ewigkeit scheint vergangen. Leila steht unverändert, nun schon seit über einer Stunde, nur ihr Stöhnen und Wimmern ist zu hören. Ab und an stampft sie auf den Boden. Dann geht ein Ruck durch ihren Körper. Ich bemerke, dass ein schleimiger Faden aus ihrem Hinterteil heraushängt, auch Blut ist zu sehen. Es geht los.
Im Kopf gehe ich alles durch, was ich zuvor in meinem Ratgeber gelesen habe. Ich kann mir plötzlich überhaupt nicht vorstellen, im Fall einer Komplikation in die Vagina zu greifen, um das Baby umzudrehen oder dessen Beine zu ordnen. Was, wenn irgendetwas schiefgeht? Bitte, lass alles gut gehen, schicke ich ein Stoßgebet zum Himmel, während ich nervös und voller Spannung erwarte, was als Nächstes passieren wird.
Schon kurz nach unserem Einzug hatten wir festgestellt, dass es im Haus Schlangen gab. Anders als die Luchse, Füchse, Bären und Berglöwen schienen sie die menschliche Nähe und besonders unseren Keller zu mögen, und es dauerte nicht lange, bis Tom dort eines Abends die erste Begegnung machte. Er wollte Werkzeuge hochholen und trat fast auf das eingerollte Reptil, das in einer dunklen Ecke lag. Wir waren nicht schlangenkundig genug, um auf Anhieb zu erkennen, ob es sich um eine Giftschlange oder eine harmlose Gartennatter handelte, aber nach genauerer Betrachtung und einigem Blättern in unserem Tierführer beschlossen wir, uns lieber nicht zu nähern. Im Buch stand nämlich, dass es giftige Vipern in dieser Gegend gab, copperheads, die auch oft in der Umgebung von Menschen zu finden waren, da sie deren Holzhaufen und Steinmauern gern als Unterschlupf nutzten. Wir lasen, dass der Biss dieser weit verbreiteten nordamerikanischen Giftschlange zu den schmerzhaftesten Schlangenbissen überhaupt gehört, mit Nervenstörungen, Schwellungen, Übelkeit und Erbrechen einhergeht, zum Glück aber selten tödlich ist. Das war tröstlich.
Im trüben Licht der Kellerlampe glaubte ich, den dreieckigen Kopf erkennen zu können, ebenso wie die charakteristische ockerbraune Färbung mit den kupferroten Streifen. Was, wenn dieses Tier nach oben in die Wohnräume gelangte? Wenn es in die Spielkisten der Kinder kroch oder in die Küchenschränke? Oder gar in die Betten, da war es doch am wärmsten! Was sollten wir denn jetzt machen?
Verscheuchen? Bloß nicht! Es einfangen! Oder? Aber wie? Jemanden anrufen! Nein, einen Sack finden! Bloß keinen Sack, einen Eimer. Nein, eine Axt! Schnell!
Die Schlange lag friedlich zusammengerollt auf dem steinigen Boden, während wir hektisch und ohne festen Plan die Kellertreppe hinauf und hinunter liefen. Schließlich ging ich nach oben, um nach den Kindern zu sehen, während Tom draußen nach der Axt suchte, doch als wir uns kurz darauf wieder im Keller trafen, fehlte von der Schlange jede Spur.
Die Geburt hat begonnen. Leila schnauft laut, läuft nun herum, dreht sich, und hinten ist bereits ein Teil der Fruchtblase sichtbar. Ich sehe zwei kleine Hufe darin und bin erleichtert. So soll es sein, das Baby liegt richtig herum, die Vorderbeine kommen zuerst. Jetzt kann ich auch einen winzigen Ziegenkopf erkennen, eingezwängt zwischen den kleinen Beinchen, und dann geht alles ganz schnell. Das Junge gleitet heraus, fällt ins frische Stroh, die Fruchtblase platzt. Alles ist voll Fruchtwasser und Blut, aber Leila dreht sich um und beginnt, das Kleine abzulecken. Gut so. Ich helfe ihr mit Handtüchern, tauche das Ende der abgerissenen Nabelschnur in einen Becher mit Jod, desinfiziere den ganzen Babybauch und schaue dabei auch nach dem Geschlecht des Zickleins. Männlich. Und da eine kleine Ziege selten allein kommt, geht es gleich weiter: Die nächste Fruchtblase erscheint, wieder sehe ich kleine Hufe, wieder atme ich auf. Leila legt sich während des gesamten Geburtsvorgangs nicht einmal hin, erledigt alles im Stehen und Gehen, und bald ist auch die zweite kleine Ziege da, weiblich diesmal. Ich trockne und desinfiziere auch sie und helfe beiden kleinen Tieren, das pralle Euter der Mutter zu finden. Das Euter mit dem lebensnotwendigen Kolostrum und der nahrhaften Milch, die sie zum Start ins Leben brauchen. Blutverkrustet ist es noch, alles ist schleimig und klebrig, doch schon bald werde auch ich die weiße Flüssigkeit aus diesem beutelartigen Organ quetschen, werde sie trinken und zu Käse, Butter und Joghurt verarbeiten.
Ich packe die inzwischen ausgeschiedene Nachgeburt – einen Klumpen bläuliches, glitschiges Fleisch – in eine Plastiktüte und entsorge sie im Müll, obwohl mir das irgendwie falsch vorkommt. Manche Tierbesitzer lassen ihre Ziegen die eigene Plazenta fressen, was diese aus Instinkt tun, da in freier Wildbahn das blutige Fleisch hungrige Raubtiere anlocken würde. Das kommt mir in dieser Situation aber noch falscher vor, also weg damit. Ich räume auf, wische mit dem Handtuch alle Tiere noch einmal ab, gebe Leila Futter und verteile einen halben Ballen Heu – dann ist die Arbeit hier für heute getan, und es dauert nur wenige Stunden, bis die flauschigen weißen Zicklein munter durch den Stall springen.