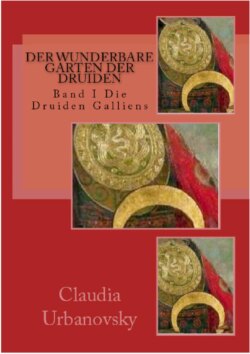Читать книгу Der wunderbare Garten der Druiden - Claudia Urbanovsky - Страница 5
EINFÜHRUNG
ОглавлениеEs ist außergewöhnlich schwierig, wenn nicht gar unmöglich, vollkommen unbefangen über die Druiden und ihr Heilwissen zu schreiben. Jeder, der sich an dieses Thema wagt, bewegt sich historisch und auch wissenschaftlich auf recht dünnem Eis, und das Risiko, nicht nur seine Glaubwürdigkeit zu verlieren, sondern sich gleichzeitig im Reich der eigenen frommen Wunschvorstellungen zu verlaufen, darf nicht unterschätzt werden. Außerdem besteht die Gefahr, der Versuchung zu erliegen, aufgrund einer eher spärlichen Quellenlage zwanghaft Fakten zurechtzubiegen, bis diese den eigenen Ansichten entsprechen.
Um diese Gefahren, wenn schon nicht völlig aus dem Weg zu räumen, aber vielleicht doch ein wenig zu mindern, möchte ich Sie zuerst zu einer kurzen Reise in das Reich der harten wissenschaftlichen Fakten einladen:
Es mag ungewöhnlich erscheinen, ein Buch über den Kräutergarten der Druiden mit einem Ausflug in die Sprachwissenschaften zu beginnen, aber er ist insofern sinnvoll, als sie es letzten Endes waren, die uns erlaubten, Zusammenhänge zu erkennen und zu behaupten, dass das Heilwissen der Druiden ganz und gar nicht verschwunden ist, sondern höchst lebendig, und – auch wenn in etwas nebulöser Form – die Jahrhunderte fast unbeschadet überdauern konnte.
Ein Wort der Warnung zum Anfang: Auch im deutschsprachigen Raum hat sich die geschichtliche Bewertung der keltischen Kulturen lange an den zeitgenössischen Sichtweisen der Franzosen und der Engländer orientiert, sofern dieser Aspekt der europäischen Kultur überhaupt ernsthaft und nicht bloß anekdotenhaft zur Kenntnis genommen wurde. Auch stand und steht teilweise heute noch in den Geschichtsbüchern Europas im Wesentlichen die Geschichte der »Sieger«! Die oben angedeutete spärliche Quellenlage ist außerdem lückenhaft, in keinem Fall absolut ursprünglich und stets in irgendeiner Weise römisch oder christlich verzerrt, entstellt oder überlagert. Dem zu Trotz sind außergewöhnlich viele Parallelen zwischen den keltischen Ländern zu verzeichnen, nicht zuletzt das Einsetzen einer keltischen Renaissance, die bereits in das ausgehende 18. Jahrhundert zurückdatiert werden kann. Diese Renaissance führte zu einer sehr positiven Entwicklung in den überlebenden keltischen Sprachgemeinschaften der sechs Länder des »keltischen Gürtels« im äußersten Westen unseres Kontinents: Irland, Cornwall, Schottland, Wales, die Isle of Man und die Bretagne.
Die keltischen Stämme haben in der Zeit ihrer höchsten Blüte einen riesigen Raum in Europa besiedelt: Sie lebten in Portugal, Spanien, in der norditalienischen Po-Ebene, in einem Teil der Türkei, in der Schweiz, in Österreich, in Tschechien, in einem Teil Polens, in Frankreich, Luxemburg, in den Niederlanden bis zur Mündung der Rheinausläufer ins Meer, in halb Deutschland bis zum nördlichen Rhein, in Belgien, Ungarn, Rumänien, der Slowakei und auf den Britischen Inseln. Man stelle sich einmal die Größe des von ihnen besiedelten Gebietes vor!
[Das Ausbreitungsgebiet der Kelten
in der Zeit ihrer höchsten Blüte 600–100 vor der Zeitrechnung]
Die Kelten sind von den Römern niemals vernichtet worden! Daran ändern weder Alesia, Julius Cäsar und das Jahr 58 vor der Zeitrechnung noch Suetonius Paulinus, 61 der Zeitrechnung und das Massaker der Druiden auf der Insel Anglesey (Ynis Mõn) während des Ikeneraufstandes unter Königin Boudica etwas. Die Nachfahren von Vergingetorix und Boudica leben heute noch und erfreuen sich bester Gesundheit. Der allergrößte Teil der Mitteleuropäer und viele Zentraleuropäer haben keltisches Blut in den Adern und keltische Vorfahren im Stammbaum. Durch die gewaltsame Romanisierung der keltischen Welt ist insbesondere die ursprüngliche keltische Sprache untergegangen, diese Sprache, die genauso wie das keltische Glaubenssystem der wichtigste Einheitsfaktor der auf riesigen Gebieten weit verstreut lebenden Stämme, Clans und Großfamilien gewesen war. Und da die Kelten nicht als ein geeinigter, militärisch organisierter Staat oder Staatenbund aufgetreten waren, hat sich im Verlauf der Romanisierung ebenfalls die traditionelle Staats- und Regierungsform der Kelten verwässert oder ist von anderen, moderneren Staats- und Regierungsformen aufgesogen worden. Es ist eben diese untergegangene keltische Sprache, in der sich die Druiden auszudrücken pflegten. Diese Lingua franca ermöglichte es erst einem Schüler aus dem Velay im französischen Zentralmassiv oder aus der italienischen Po-Ebene, bei einem Meister – einem Ollamh – auf der Druideninsel Ynis Mõn (Anglesey) zu studieren.
An dieser Stelle soll kurz auf die Expansion der Kelten eingegangen werden, bevor sie ihrer politischen Uneinigkeit und Individualität zum Opfer fielen: Im 1. Jahrtausend vor der Zeitrechnung erreichten keltiberische Stämme das Gebiet des heutigen Spaniens, als »Gallier« zusammengefaßte Stämme weite Teile Westeuropas und mit »Galater« bezeichnete Gruppen den Balkan. Etwa um 600 vor der Zeitrechnung setzten die ersten keltischen Stämme über den Ärmelkanal und assimilierten oder verdrängten die dortige Urbevölkerung.
Wann sich die keltische Lingua franca in einen brythonischen und einen goidelischen Sprachenzweig auseinander entwickelte – ob vor oder erst während der Ausbreitung der keltischen Kultur auf den Britischen Inseln –, ist auch heute noch nicht abschließend geklärt. Doch aus diesen beiden Sprachenzweigen heraus haben sich sämtliche heute noch lebendigen keltischen Sprachen entwickelt. Wenn man lediglich davon ausgeht, dass die Übermittlung druidischen Wissens in der urkeltischen Sprache erfolgte, also jener Lingua franca, die vor der Sprachverzweigung ins Brythonische und Goidelische existierte, dann müsste man sich eigentlich dem Allgemeingut anschließen, dass bis zum heutigen Tag noch nicht ein einziger Quellentext aus dem Bereich der Heilkunde gefunden wurde, der eindeutig einem druidischen keltischen Verfasser zugeordnet werden kann. Die Druiden haben ihr Wissen und ihre Wissenschaft in der vollständigen Form nur mündlich an auserwählte Schüler weitergegeben, vermutlich in einer Form der Mnemotechnik.
Wenn wir also um unserer wissenschaftlichen Glaubwürdigkeit willen diesem traditionellen Leitmotiv der Schriftlosigkeit druidischen Wissens folgen wollten, müssten wir logischerweise unser Buch hier an dieser Stelle sofort wieder beenden und es als eine gegebene Tatsache hinnehmen, dass es unmöglich ist, guten Gewissens über eine Heilkunst zu schreiben, von der nichts Konkretes überliefert werden konnte. So, wie wir auch akzeptieren müssten, dass die Kelten, deren wissenschaftliche und spirituelle Elite die Druiden waren, ein »verschwundenes Volk« sind, genauso wie die Etrusker oder die Maya, Azteken und Inka. Das gute Gewissen könnte noch dadurch verstärkt werden, dass im 5. Jahrhundert der Zeitrechnung das in Agonie liegende Römische Reich von plündernden, eroberungswütigen Völkerschaften überrannt wurde. Diese Vandalen gaben sich nicht nur damit zufrieden, zu morden und zu brandschatzen, sondern plünderten auch Kunstschätze und vernichteten dabei wertvolle Schriftrollen, die in ihren Augen keinen materiellen Wert besaßen. Sie zerstörten also quasi die gesamte klassische Zivilisation Westeuropas in einem gewaltigen Rundumschlag und nicht umsonst nennt man die Zeit nach dem Untergang des Römischen Reiches im englischen Sprachraum gerne »The Dark Ages« – »Die Dunkle Zeit«. Es ist also möglich, dass, falls entgegen aller wissenschaftlicher Fakten doch von Druiden verfasste Schriften oder Überbleibsel solcher Schriften aus der Glanzzeit ihrer Macht über die keltischen Stämme existiert haben sollten, diese letztendlich und mit allergrößter Wahrscheinlichkeit zum Zeitpunkt des Vandalensturms zerstört worden wären.
Oder vielleicht doch nicht?
Da geht zum einen die Geschichte, dass mit dem Einsickern des Christentums in die keltischen Länder das Verbot der Aufzeichnung von Texten – vielleicht aus Gründen einer bösen Vorahnung der Druiden gepaart mit einem gesunden Selbsterhaltungstrieb – aufgehoben wurde und dass somit ein großer Teil ihres Wissens im 3. und 4. Jahrhundert der Zeitrechnung schriftlich vorhanden gewesen war. Diese Texte sowie auch noch ältere Aufzeichnungen, möglicherweise in der von den Druiden so geschätzten griechischen Schrift, vielleicht aber auch in einer ihnen eigenen Schrift, wären aber in der nachfolgenden Zeit von übereifrigen Neuchristen als heidnisches Gedankengut vernichtet worden, wo auch immer sie auf solche Schätze stießen. Selbst der heilige Patrick soll im 9. Jahrhundert in seinem missionarischen Eifer insgesamt 180 Schriften mit druidischem Wissen den Flammen übergeben haben. Doch trotzdem überlebte noch etliches und wurde in Sammlungen auch immer wieder neu herausgegeben, wie etwa im Leabhar Buidhe Lecain, dem sogenannten »Gelben Buch von Lecon«, aus dem 14. Jahrhundert.
Vom europäischen Festland waren in der Zeit zwischen dem langen Untergang des Römischen Reiches und dem Aufbruch aus der dunklen Zeit ins Mittelalter Wissenschaft und Gelehrsamkeit so gut wie verschwunden. Doch auf den Britischen Inseln sah dieser Tage die Situation etwas anders aus: Rom, die Vandalen, die Völkerwanderungen und der ganze Aufruhr waren weit weg. Irland ist niemals von den Römern besetzt und damit niemals romanisiert worden. Die kontinentale Bretagne hat es aufgrund ihrer geographischen Lage »weit ab vom Schuss«, ihrer schweren Zugänglichkeit und eines Mangels an großen und wirtschaftlich reizvollen Bevölkerungszentren fertiggebracht, eine intensive Romanisierung zu entmutigen. Der letzte römische Legionär verließ im Jahre 423 der Zeitrechnung die britische Hauptinsel. In der kontinentalen Bretagne hatten seine Urenkel zu dieser Zeit bereits vergessen, dass Urgroßvater unter dem Namen Gaius oder Cassius eigentlich den Adlern Roms gedient hatte, wenn er überhaupt jemals wirklich irgendeinen Anspruch auf römische Vorfahren hatte erheben können. Schriften, die vor den anstürmenden Vandalen gerettet wurden, wurden in diesen Tagen des qualvollen Untergangs des Römischen Reiches in großem Ausmaß auf dem sicheren Seeweg auf die Britischen Inseln und dort hauptsächlich nach Irland gerettet. Dort entwickelte sich eine von Rom unabhängige und eigenständige Form des Christentums, die das Druidentum in sich aufnahm, anstatt danach zu streben, es zu vernichten und die alten Vorstellungen, Bräuche und Sitten abzuschaffen. Die Männer, die aufgebrochen waren, Irland das Wort vom Gottessohn zu bringen, waren nämlich nicht von Rom losgeschickt worden, sondern vom Patriarchat von Antiochia, das nach der Legende etwa im Jahre 34 der Zeitrechnung vom Apostel Petrus gegründet worden war und sich im 5. Jahrhundert der Zeitrechnung aufgrund von erheblichen Meinungsverschiedenheiten zum Glaubensdogma von Rom abspalten sollte. Dieses eigenständige irische Christentum basierte folglich nicht auf den von Rom so geliebten hierarchischen Strukturen, sondern auf einer Einsiedler- und Mönchsgesellschaft und auf Klöstern, die in ihrer Lebensweise den druidischen Gemeinschaften ähnlich waren. Diese irischen Mönche, die von ihrer Insel dann in die kontinentale Bretagne aufbrachen, kann man heute ohne zu übertreiben als christliche Druiden bezeichnen. In ihren Klöstern wurden in dieser Zeit der großen Umwälzungen auf dem Kontinent nicht nur die gesamte gerettete lateinische Literatur des untergehenden Römischen Reiches kopiert, sondern auch in der altirischen Landessprache geschrieben.
Während der heilige Columba, der von einem Druiden großgezogen worden war und selbst stark in der Druidentradition stand, eine Schlüsselfigur der Rettung der klassischen abendländischen Literatur war, waren es die zahllosen unbekannten Eremiten und Mönche, die in ihrer eigenen altirischen Sprache die vorchristlichen Überlieferungen zu Papier brachten – auch wenn die Helden und Elfenkönige in diesen Sagas aus Irland (aber auch aus Wales) nur noch andeutungsweise die Götter erkennen lassen, die sie in den früheren religiösen Mythen der Druiden gewesen waren. Nichtsdestotrotz bieten diese Schriften noch bis zum heutigen Tage die beste Textquelle zur Rekonstruktion der keltischen Spiritualität und damit auch zum druidischen Wissensschatz. Daneben boten die Sagas den ersten Chronisten auch Raum, viele wichtige Details des druidischen magischen Wissens und Heilwissens in oftmals ziemlich unverschlüsselter Form einfließen zu lassen. Natürlich sind diese Druidenüberlieferungen dann im Laufe der Zeit von den auf die ursprünglichen Chronisten folgenden Generationen von Schreibern und Kopisten schließlich doch fast bis zur Unkenntlichkeit bearbeitet worden – manchmal gewiss mit Absicht, oft wohl auch nur durch reine Nachlässigkeit. Und trotzdem: Wenn man sich die Mühe macht und aufmerksam die Texte des Mabinogion oder die der »Welsh Triads« liest, so entdeckt man immer noch die ursprünglichen Druidenberichte hinter den Rittererzählungen und Rittergestalten wie auch hinter den Göttergestalten. Manche der Ritter, selbst noch jene der Tafelrunde des Artus, die ab dem 11. Jahrhundert der Zeitrechnung durch Chretien de Troyes, den »Roman de Brut« des Anglonormannen Robert Wace und die »Historia Regum Britanniae« des Godefroi de Monmouth die größte Popularität erlangten, verfügen über wunderbare, magisch anmutende Fähigkeiten oder sie sind weise Ratgeber und in den Fragen der Rechtsprechung bewandert. Die Verwandlungen, die von Gwydion, Arianrod etc. berichtet werden, sind mit den Druidenwundertaten zu vergleichen, über die die irischen Mönche so gerne berichteten, wenn sie dazu ansetzten, vom Kampf des Christentums gegen das (druidische) Heidentum und seinem anschließenden Sieg zu erzählen. Ja selbst die Wundertaten, die sie ihren christlichen »Kämpfern«, wie z.B. Columba, selbst zusprechen, ähneln in Umfang und Aufmachung jenen der »heidnischen«, druidischen Widersacher und Gegner.
Die wandernden Kelten setzten im 6. Jahrhundert vor der Zeitrechnung über den Ärmelkanal auf die Britischen Inseln und nach Irland über. Rund tausend Jahre später zwangen sie die Umstände dazu – dieses Mal in Form von über die Nordsee hereinfallenden kriegerischen germanischen Stämmen –, auf dem gleichen Weg, auf dem sie einst gekommen waren, von der Hauptinsel und dort insbesondere aus Cornwall, dem heutigen Devon bis zum Severn und Somerset, wieder in die auf dem Kontinent liegende Bretagne – damals Armorica (»Land vor dem Meer«) – zurückzufahren. Man nimmt an, dass es zwei große Phasen der Abwanderung gab: eine erste vom frühen Ende des 4. bis zur Mitte des 5. Jahrhunderts und eine zweite im 6. und 7. Jahrhundert.
Die Urform des heutigen Bretonischen – Brezhoneg – wurde von diesen keltischen Völkerstämmen, die vor den Sachsen, den Nordmännern und den sehr heftigen Auseinandersetzungen der einzelnen Völkerstämme zurück auf den Kontinent nach Armorica flohen, mit übers Wasser gebracht und gehört dem brythonischen, inselkeltischen Sprachenzweig an. Sie ist aber dem ausgestorbenen Kornischen näher verwandt als dem Walisischen und unterscheidet sich ganz deutlich vom Altirischen. Darüber hinaus wird heute angenommen, dass Reste der keltischen Tradition der Gallier noch in der armoricanischen Kultur auf dem Festland überlebt hatten und diese nun mit der Kultur der Inselflüchtlinge verschmolz. Im Gegensatz zum restlichen Gallien ist das als Armorica bezeichnete Land am Meer durch seine besondere geographische Lage jedoch niemals vollständig romanisiert worden. Diese neue Bretagne – Britannia minor –, die nun hier entstand, war über viele Jahrhunderte hinweg ein Sammelsurium selbständiger Königreiche und Herzogtümer, gelegentlich auch ein großes Königreich oder Großherzogtum. Erst im 16. Jahrhundert fiel sie durch die erzwungene Heirat von Herzogin Anne de Montforzh mit zwei französischen Königen (nacheinander!) nach deren Tod vollständig an Frankreich. Und selbst nach dieser erzwungenen Union können die Bretonen noch heute unabhängig von Paris und der zentralen politischen Macht gewisse eigene Prärogative beibehalten. Und obwohl der zentralistische französische Nationalstaat seit der Französischen Revolution bis zum Ende der 50er Jahre aggressiv sämtliche Regionalsprachen und ganz besonders das Bretonische bekämpft hat, konnte sich diese Sprache doch bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges als die dominante Umgangssprache im westlichen Teil des Landes behaupten. Heute verzeichnet sie wieder – nach einem Einbruch in den 60er und 70er Jahren – stark ansteigende Tendenzen, vor allem in der jüngeren Bevölkerungsgruppe entwickelt sich wieder ein sehr ausgeprägtes bretonisches Nationalbewusstsein. Der Punkt an dieser Stelle ist, dass wir das Fragment eines Manuskripts in altbretonischer Sprache aus der Regierungszeit von König Nominoë (8. Jahrhundert der Zeitrechnung) in Händen halten, in dem nicht verschlüsselt, sondern in klarer und geradliniger, fast wissenschaftlich anmutender Form das Thema der Heilkunde und der Kräuterkunde behandelt wird. Dieses einzigartige und wertvolle Manuskript befindet sich heute in den Niederlanden, in der Bibliothek der Universität von Leiden, was ihm auch seinen Namen einbrachte: das »Leydener Manuskript«. Es handelt sich hierbei um ein Fragment – bestehend aus zwei großen Velum-Blättern – aus einem medizinischen Werk, dessen Ursprung eindeutig nicht klassisch griechisch-römisch und auch nicht orientalisch ist. Der Text wird in etwa auf das Jahr 750 datiert und ist damit fast ein Jahrhundert älter als der älteste erhaltene romanisch-französische Text, die Straßburger Eide, der aus dem Jahre 842 stammt. Die Besonderheit des Manuskripts von Leyden besteht darin, dass die lateinisch verfassten Textpassagen eine sehr genaue Bestimmung der in altbretonischer Sprache bezeichneten Heilpflanzen und damit ihrer Einsatzgebiete zulassen.
Genau wie bei den Kelten auf der anderen Seite des Meeres – in Irland – waren in den Tagen des Leydener Manuskripts die Zentren der Bewahrung und der Verbreitung der Kultur in den Klöstern angesiedelt. Die bretonische klösterliche Tradition ist auf den gleichen Grundlagen gewachsen wie die irische. Alle bedeutenden Klostergründungen wie Dol, Landevennec, Plean oder Redon gehen auf irische keltische Missionare zurück. Diese Einrichtungen bewahrten genauso wie ihre irischen Schwestern Handschriften der Antike auf und vervielfältigten diese. Daneben waren sie selbst literarisch höchst aktiv und verfassten eigene Handschriften in altbretonischer und auch lateinischer Sprache, die sie mit kunstvollen Miniaturen schmückten. Die Christianisierung Armoricas verlief ähnlich wie die von Irland verhältnismäßig gewaltlos. Nach anfänglichem Widerstand und Zweifeln öffnete sich der Druidenorden, vielleicht aus Berechnung, vielleicht aus der Not heraus, auch auf dem Kontinent der neuen Religion. Vielen Druiden gelang es, ebenso wie in Irland, hohe Ämter in der neuen kirchlichen Ordnung zu übernehmen, bei der – unabhängig von Rom und von der römischen Doktrin – die Klöster im Mittelpunkt des religiösen und geistlichen Lebens standen. Genauso wenig wie die Christianisierung Irlands hat die Christianisierung Armoricas echte Märtyrer hervorgebracht. Aber die armoricanischen Druiden brachten wie ihre irischen Brüder ihr über Jahrtausende gesammeltes und mündlich überliefertes Wissen ein; ein Wissen, das sich nicht nur auf religiöse Dinge beschränkte, sondern alle Gebiete berührte: von der Philosophie über die Dichtkunst, die Musik, fremde Sprachen und Geschichte bis zu den klassischen naturwissenschaftlichen Disziplinen wie Mathematik, Physik und Astronomie. Vor allem aber bereicherten sie die Klöster mit ihren außergewöhnlichen Kenntnissen in der Botanik, der Biologie und der Medizin. Und sie brachten dieses Wissen nicht nur mit und ließen zu, dass uralte Kenntnisse in schriftlicher Form festgehalten wurden. Genauso wie in Irland waren die bretonischen Klöster gleichzeitig auch Universitäten, die die gesammelten Kenntnisse und Erkenntnisse weitervermittelten. Auf diese Art und Weise setzte sich die druidische Lehrtätigkeit über die Epoche der offiziellen Christianisierung Armoricas hinaus ungestört und wohl organisiert fort.
Als die Druiden, die großen Weisen Armoricas, in die neuen Klöster des keltischen Christentums eintraten, schworen sie weder ihren keltischen Gottheiten noch ihren philosophischen und religiösen Vorstellungen ab, genauso wenig wie sie ihre Bräuche und Traditionen aufgaben. Sie integrierten diese einerseits einfach in das neue Glaubenssystem und beeinflussten es grundlegend, andererseits überlebte auch die reine und unverfälschte Weisheit der Druiden und ihre alte Religion im Schutz dieser monastischen Gemeinschaften. Oftmals führten die Druiden im Inneren einer columbanitischen Gemeinschaft ein richtiges Eigenleben, getrennt von den christianisierten Brüdern – Stab und Kreuz, so, wie es sich heute noch im Rahmen der orthodoxen keltischen Kirche fortsetzt, in der druidische und christische Würdenträger und Adepten respektvoll und friedlich koexistieren.
Diese columbanitischen Gemeinschaften siedelten bezeichnenderweise regelmäßig an oder unweit von ursprünglichen heiligen Stätten der Druiden; neben besonderen Quellen oder Seen, im Herzen bestimmter riesiger, undurchdringlicher Waldgebiete, die Armorica zu dieser Zeit überwiegend bedeckten, in der Nähe des heutigen Mont Saint Michel und auf dem Tombelaine selbst, auf die kaum zugänglichen Monts d’Arée oder entlang der zerklüfteten Küstenlinie des Atlantiks, direkt am Meer. Auch heute noch befindet sich der Sitz des Erzbischofs der orthodoxen keltischen Kirche in Sainte-Dolay, unweit des den Druiden heiligen Mont Dol im Morbihan.
Erst zu Anfang des 10. Jahrhunderts der Zeitrechnung wurde diese religiöse »Idylle« gestört, als die Normannen, von Rom angestachelt, in die Bretagne einfielen, die Bevölkerung so gut sie konnten massakrierten oder verjagten und die keltischen Klöster bis auf die Grundmauern niederbrannten. Das tiefgreifendste Ergebnis dieses normannischen Wütens war allerdings nicht etwa der Verlust der Unabhängigkeit und Souveränität Armoricas, denn im Jahre 937 gelang es König Alain Barbetorte, die Eindringlinge zu vertreiben und seine Herrschaft wiederherzustellen. Es war nicht einmal die physische Vernichtung der Druiden selbst. Aber die wunderbaren und wertvollen Handschriften, die in den keltischen Klöstern von christlichen Mönchen und christisierten Druiden hergestellt worden waren, waren zum allergrößten Teil unwiederbringlich verloren: zu Asche verbrannt und nur noch eine Erinnerung im Gedächtnis der Überlebenden der Massaker. Diese zogen sich aus ihren gut organisierten »Kloster-Universitäten« wieder in die Wälder und abgelegene Gebiete zurück, wo es eben keine Infrastrukturen für eine gezielte wissenschaftliche und Lehrtätigkeit mehr gab. Nur eine kleine Anzahl von handschriftlichen Fragmenten hat das Wüten der Eindringlinge überlebt. Vor etwa einem Jahr tauchte bei einer archäologischen Ausgrabung in der Bretagne ein neues Manuskriptfragment auf, das höchstwahrscheinlich aus derselben Zeit stammt wie das Leydener Manuskript, vielleicht aber auch ein wenig älter ist. Allerdings wurde von der Grabungsleitung über den Inhalt bis jetzt noch nichts Konkretes veröffentlicht, da das Vellum erst restauriert werden muss.
Neben dem Leydener Manuskript existiert eine weitere Schrift von herausragender Bedeutung. Sie stammt aus dem 4. Jahrhundert der Zeitrechnung und trägt den Titel »De Medicamentis Empiricis Physicis ac Rationalibus«. Der Autor dieses Werkes, Marcellus Empiricus oder auch Marcellus Burdigalensis genannt, war ein hoher Beamter des Kaisers Theodosius. Es ist immer noch eine Streitfrage, ob Marcellus Arzt war oder nur ein medizinisch interessierter Laie. Unumstritten ist jedoch seine keltische Muttersprache, die im Text »De Medicamentis« ständig durchschlägt.
Im Jahre 1847 veröffentlichte Jacob Grimm seine Abhandlung über diesen Marcellus Burdigalensis, in der er die damals ältesten bekannten keltischen Sprachzeugnisse erklärte. Zusammen mit seinem Bruder Wilhelm, der 1813 »Drei Altschottische Lieder« und 1826 »Irische Elfenmärchen« veröffentlichte, war er einer der wichtigsten Impulsgeber der modernen keltischen Philologie. Die Brüder Grimm pflegten nicht nur Kontakte nach Schottland zu Sir Walter Scott und nach Irland zu Crafton Croker, sondern auch in die Bretagne mit De la Villemarque, dem Chronisten der »Barzaz Breiz«. Jacob Grimm war bereits seit 1811 korrespondierendes Mitglied der Keltischen Akademie in Paris. Grimms Arbeit über Marcellus’ »De Medicamentis« ist die Grundlage, auf der die ersten historischen Grammatiken der keltischen Sprache, wie die von Johann Caspar Zeuß, aufbauen konnten. Sie eröffnete auch den ersten echten Einblick in das überlieferte heilkundliche Wissen der keltischen Druiden, ihre Tradierung in der Volksmedizin und ihr Überleben in der medizinischen Praxis sowohl der gallischen Ärzte als auch der einfachen Heilkundigen. Daneben unterstreicht der im »De Medicamentis« überlieferte Wissensschatz noch deutlich die Tendenz, sich an praktischen Mitteln zu orientieren und vorchristliche, gerne als abergläubisch bezeichnete Mittel und Praktiken zu integrieren. Diese Tendenz lässt sich bei der medizinischen Literatur der ausgehenden Antike, die aus dem Osten des Römischen Reiches und aus dem Orient stammt, nicht in so klarem Maße nachweisen, was darauf hindeutet, dass die ursprünglichen Quellen örtlichen und damit keltisch-druidischen Ursprungs gewesen sein müssen. Wenn man nämlich den Marcellus zwei zeitgleichen Werken gegenüberstellt – Cassus Felix’ »Über die Medizin« und Theodorus Priscianus’ »Leicht beschaffbare Heilmittel« –, die aus griechischen Quellen schöpfen, dann sind es genau diese Unterschiede, die zuerst ins Auge springen. Marcellus’ Werk ist ein außergewöhnliches Zeugnis der Naturphilosophie. Obwohl er an einer Stelle schreibt: »Barmherzigkeit empfängt man am besten von Gott«, was darauf hindeuten könnte, dass er vielleicht Christ war, ist seine Materie doch durch und durch mit heidnischem, pantheistischem Gedankengut durchsetzt. Er zitiert in den Quellen, die er für sein Werk verwendet hat, neben Apuleius, Plinius, Celsius, Eutopius und seinem Zeitgenossen Ausonius auch Patera von Bayeux, den Druiden, der zu dieser Zeit Professor für Heilkunde in Bordeaux war, und Phebicius, einen weiteren heilkundigen Druiden, der ebenfalls in Bordeaux lehrte, aber gleichzeitig auch Hüter des dortigen Heiligtums des Belenos war. Der Leser sollte an dieser Stelle nicht vergessen, dass wir uns im 4. Jahrhundert der Zeitrechnung befinden und Marcellus’ Herr, Kaiser Theodosius, gerade außergewöhnlich gewalttätige Edikte sowohl gegen die Heiden als auch gegen Magier aller Art erlassen hatte! Trotzdem zitiert Marcellus freimütig an vielen Stellen die Druiden Patera und Phebicius in seiner heilkundlichen Schrift, von der heute manche sagen, sie wäre nichts anderes als ein haarsträubendes Sammelsurium aus der Drecksapotheke.
Auch der Poet und Rhetoriker Decimus Magnus Ausonius, ein Zeitgenosse von Marcellus, zitiert Patera, schreibt mit Hochachtung über ihn sowie über Phebicius und rühmt sich, mit diesen Gelehrten befreundet zu sein. Ebendieser Ausonius ist der Lehrer von Paulinus, dem künftigen Bischof von Nola. Und Paulinus selbst wird nur wenige Jahrzehnte später der Lehrer des künftigen römischen Kaisers Gratian sein.