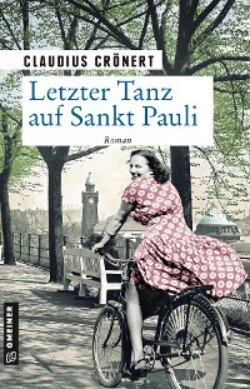Читать книгу Letzter Tanz auf Sankt Pauli - Claudius Crönert - Страница 6
Drei
ОглавлениеNach Ende des Krieges, als er zu Fuß aus Flandern nach Altona zurückkehrte, wog Hannes Krell weniger als 50 Kilo. Er war einen Meter 90 groß, ein Mann, der die Leute in seiner Umgebung stets überragte. Die 50 Kilo brachte er wohlgemerkt in Uniformhose und Hemd auf die Waage, im Lazarett hatte man sich nicht die Mühe gemacht, vor dem Wiegen die Kleidung abzulegen. Am Hintern fehlte jedwedes Fleisch, an der Brust stachen die Rippen heraus, und wenn er unterwegs in ein spiegelndes Fenster blickte, sah er einen hohlwangigen 19-Jährigen mit wirr flackernden Augen. Kurz vor Weihnachten traf er zu Hause ein und fand die Wohnung so, wie er sie zwei Jahre zuvor verlassen hatte. Die Mutter war gestorben, das hatten sie ihm ins Feld geschrieben, aber davon abgesehen hatte sich nichts verändert. Seine ältere Schwester Hilde führte dem Vater den Haushalt, die zweite Schwester Erika unterstützte sie dabei. Sie warteten beide darauf, dass jemand ihnen den Hof machte, doch Männer waren knapp in dieser Zeit, Abertausende waren gefallen, ihre toten Körper verwesten auf den Schlachtfeldern oder waren in endlos langen Reihen auf den Soldatenfriedhöfen in Belgien und Nordfrankreich verscharrt. Es kam niemand, weder für Hilde noch für Erika.
Auf sein Klopfen hin hatte damals der Vater die Tür geöffnet und einen Moment gezögert, während er sich wohl gefragt hatte, was der abgemagerte Kerl wollte, der da vor seiner Tür stand.
Dann hatte er die Hand ausgestreckt. »Ich freue mich, Hannes, dass du heil zurück bist. Auch wenn es um unser Deutschland nicht gut steht.«
Krell war es schwergefallen, sich wieder einzugewöhnen. Beinahe alles in seinem Elternhaus ging ihm auf die Nerven, obwohl er es von früher kannte: die knappen Anweisungen des Vaters, der unbedingte Gehorsam der Schwestern, das viele Schweigen, selbst das Ticken der Standuhr im Wohnzimmer. Den Befehlston des Alten hielt er nur mit größter Selbstbeherrschung aus, und es gab Momente, da formten sich wilde Schreie in ihm und wollten heraus. Es kostete ihn viel Kraft, sie zu unterdrücken. Er schaute sich dabei zu, wie er die Zähne zusammenbiss und die Kiefer anspannte.
Auch das Tischgebet konnte er kaum ertragen:
Alle guten Gaben,
alles was wir haben
kommt, o Gott, von dir,
Dank sei dir dafür.
Gott war nicht in Flandern gewesen, und wenn er dort nicht war, war er auch nirgendwo sonst. War sein Vater blind, dass er das nicht sah? Oder schauten er und die Schwestern nur auf sich und auf niemanden sonst? Der Hungerwinter hatte die Familie nicht weiter beeinträchtigt, ein preußischer Finanzbeamter war auch während des Krieges versorgt worden, und auch jetzt gab es ausreichend zu essen. Aber Krell schmeckte es nicht, weder die sämige dunkelbraune Soße, in der die Kartoffeln schwammen, noch die Linsen und auch nicht das Fleisch am Sonntag. Er kaute auf seinen Bissen herum und nahm nicht zu. Er schlief schlecht, kürzer als je im Feld, schreckte nachts auf und konnte nicht wieder zur Ruhe finden, weil sein Herz so laut pochte. Nicht ein einziges Mal erkundigte sich der Vater nach seinen Erlebnissen, und nach seinem Vorbild taten es die Schwestern auch nicht. Den Krieg – genau genommen die Niederlage – gab es nicht, durfte es nicht geben. Seine einzige Frage stellte der Alte am Abend des zweiten Weihnachtstages. Er saß in seinem Sessel, ein Glas Weinbrand in der Hand und seine Tonpfeife im Mund, ein Rauchutensil aus dem letzten Jahrhundert, während er sich mit zwei Fingern den Backenbart kratzte:
»Was wirst du tun, Sohn?«
»Ich suche mir eine Arbeit«, erwiderte Hannes. Beinahe von selbst kam der zweite Teil des Satzes hinterher: »Und eine Unterkunft.«
Der Vater verzog keine Miene und gab keinen Kommentar ab, neuerliches Schweigen legte sich über das weihnachtliche Zimmer. Man glaubte, das Brennen der Kerzen am Tannenbaum zu hören. Die Standuhr tickte. Hannes schloss die Augen und stellte sich vor, zur See zu fahren, er wollte weg, nur weg, alles hinter sich lassen, Familie und Krieg und Erinnerungen, er träumte vom Blau der Ozeane und sah sich fremde Länder entdecken. In seiner Fantasie tauchte stets der Süden auf, mit bunten Farben und herzlichen, lebensfrohen Menschen. Aber im Hungerjahr 1919 gab es keine deutsche Handelsschifffahrt. Die britische Blockade an der Nordsee dauerte an, nicht weniger total als während des Krieges, die Reedereien im Reich hatten den größten Teil ihrer zivilen Flotte verloren, und den anderen Nationen ging es ebenso. Deutschland durfte nicht einmal Küstenschifffahrt oder Hochseefischerei betreiben. Handel gab es fast nicht, zumal die heimische Industrie daniederlag und die Bevölkerung kein Geld hatte, um eingeführte Waren zu kaufen. Krell fand ein Zimmer auf Sankt Pauli, in der Seilerstraße, mitten im Vergnügungsviertel, eine Dachkammer mit Bett, Kleiderschrank, einem Stuhl und einem gusseisernen Ofen. Er verdingte sich auf dem Bau, manchmal auch am Hafen, wenn doch einmal ein ausländisches Schiff entladen werden musste, und im Spätsommer als Erntehelfer auf den Obstfeldern im Alten Land. Sankt Pauli wurde sein neues Zuhause. An seinen Vater und die Schwestern dachte er am Anfang hin und wieder, dann immer weniger. Zu einem Besuch konnte er sich nicht aufraffen.
Obwohl Hannes Krell seit mehr als 15 Jahren nicht mehr auf dem Kiez wohnte, akzeptierten ihn die Anwohner. Im Normalfall mieden die Sankt Paulianer die Obrigkeit und sprachen nur mit der Polizei, wenn es nicht anders ging, wenn Beugehaft oder Knüppelschläge drohten, und selbst dann behaupteten sie meistens, sie hätten nichts gesehen und wüssten nichts, ehrlich nicht. Bei Krell war das anders. Mit ihm redeten sie.
Er schritt über die Reeperbahn Richtung Große Freiheit und grüßte, wenn er einen Bekannten sah, zweimal deutete er sogar ein Hutheben an. Vor drei Jahren hatte dieser Teil von Sankt Pauli noch zur Stadt Altona gehört, doch das war nun Vergangenheit. Ohne jegliche Ankündigung hatte die NS-Regierung Altona in einem Verwaltungsakt der Stadt Hamburg zugeschlagen. Die Stellung als selbstständige dänische und später preußische Stadt war mit einem Schlag vorbei gewesen. Viele Leute, auch Krell, hatten sich darüber mokiert, allerdings war er Beamter, es stand ihm nicht zu, Kritik zu äußern, und wenn man ehrlich war, musste man einräumen, dass sich durch den Zusammenschluss nicht viel verändert hatte. Auch der Altonaer Teil von Sankt Pauli und die Reeperbahn blieben nach dem Zusammenschluss, was sie vorher gewesen waren. Die Einbußen, unter denen der Kiez litt, waren dem Krieg geschuldet, der eingestellten Handelsschifffahrt. Seit U-Boote den Atlantik beherrschten, kamen kaum noch Matrosen, gleichwohl ging das Leben hier weiter, die Amüsierlokale öffneten Abend für Abend, halbnackte Mädchen tanzten oder warteten auf Kundschaft, es wurde gesoffen, gehurt und um Geld gespielt wie früher, und wie damals fand sich mancher am nächsten Morgen nicht nur verkatert, sondern auch pleite.
Auch das Bild, das die Reeperbahn am Vormittag abgab, hatte sich nicht verändert. Wie früher hatte man den Eindruck, man dürfe nicht zu laut sein, weil die Anwohner noch schliefen. Muffiger Geruch kam aus den Fenstern der Lokale und aus den Hauseingängen, auf dem Bürgersteig lagen Scherben von mancher Bierpulle, an den Wänden gab es gelbliche Pfützen und Flecken. Die Nazis machten den Betrieb in ihren Reden und Zeitungsartikeln verächtlich, weil er unsittlich war. Aber sie duldeten ihn. Offenbar blieb ihnen nichts anderes übrig.
In der Großen Freiheit öffnete Krell eine Tür. Eine Glocke klingelte. Er stieg drei Stufen hinab in ein Souterraingeschäft. Der Mann hinter dem Tresen sah von seiner Lektüre auf. Der Raum war länglich, dabei ziemlich eng. Auf dem Tresen lagen Zeitungen, an der Rückwand waren Zigarettenschachteln in ein Regal sortiert. Schnaps lagerte unter dem Tisch und wahrscheinlich auch in der Kammer, deren Türumrisse in die Tapete geschnitten waren.
»Oh, der Herr Kommissar.« Der Mann hatte eine von Tabak und Alkohol kratzige Stimme. »Da sage ich doch gleich mal brav: Heil Hitler.«
»Heil Hitler, Jan.«
»Moin.«
Jan Weller hatte ein kräftiges Gesicht mit vollem Bart. Die grauen Haare waren nach hinten gekämmt, aber so ganz ließen sie sich nicht zähmen. Er mochte zehn Jahre älter sein als Krell, dann wäre er Anfang 50. In seiner Hand hielt er eine Zigarre.
»Ich habe den Völkischen Beobachter. Druckfrisch von heute Morgen.«
»Schön.«
»Nehmen Sie einen?«
»Nein danke.«
»Seltsam – warum habe ich mir das gedacht? Vielleicht ’ne Zigarre?« Er öffnete ein Holzkistchen und hielt es Krell hin. »Geht aufs Haus.«
Krell griff zu. »Danke«, sagte er, als Jan ihm seine Streichhölzer hinüber schob. Er entzündete den Tabak, beide begannen zu paffen, heller Rauch erfüllte den Laden. Unter dem Fenster gab es einen zweiten Stuhl. Das Polster der Sitzfläche war abgeschabt, man konnte das Muster kaum noch erkennen. Krell zog ihn zu sich heran und setzte sich.
»Büsschen über die alten Zeiten plaudern?«, fragte Jan.
»Jo. Und büsschen über heute.«
»Was gibt’s da zu erzählen? Heldengeschichten aus unserem Krieg? Da kenne ich keine. Für so was habe ich Landserhefte.« Er zeigte auf die Seite des Tresens. »Wenn Sie solche Sachen lesen, Kommissar …«
Anstelle einer Antwort zog Krell an seiner Zigarre und pustete den Rauch aus. Sie brannte nicht gut. Er drehte die Spitze zu sich und blies gegen sie, woraufhin sie aufglühte. Auf Sankt Pauli gehörten die mokanten Töne dazu. Mancher Kollege hätte sie gemeldet, sie erfüllten gleich mehrere Tatbestände, Defätismus, bürgerliche Kritisiererei, vielleicht sogar Wehrkraftzersetzung. Krell aber achtete darauf, sich seine Kontakte auf der Reeperbahn zu bewahren. Sie waren nützlich bei der Verbrechensbekämpfung, und er hatte sich vor Längerem dazu entschieden, nicht jedes Wort auf die Goldwaage zu legen, erst recht nicht bei einem Mann wie Jan.
Die Glocke schlug an, die Tür ging auf, eine junge Frau trat ein. Sie hatte Sommersprossen im Gesicht, war in einen weiten hellen Mantel gehüllt, die roten Haare hatte sie notdürftig zusammengebunden. Ihre Schuhe hatten hohe Absätze, doch ihr Gang darauf schien nicht ganz sicher zu sein. Ohne ein Wort von ihr griff Jan hinter sich und nahm ein Päckchen Juno aus dem Regal.
»Moin«, sagte sie mit leiser Stimme und nickte auch Krell zu. »Herr Kommissar.«
»Morgen, Bella«, entgegnete Krell.
»Wie geht’s dir?«, fragte Jan.
»Wunderbar«, sagte sie gegen den Augenschein. Sie sah blass und übernächtigt aus und wirkte wie jemand, der die Zeit vor dem Mittag verabscheut.
»Das ist schön«, sagte Jan trotzdem.
»Finde ich auch.« Ihre Münzen hatte sie bereits abgezählt, sie legte sie auf den Tresen, nahm die Zigaretten, warf Krell einen Blick zu, nickte und verschwand.
»Sie kennen Bella, Herr Kommissar?«
Krell gab nicht gleich eine Antwort, er war in Gedanken. »Ja«, sagte er schließlich.
»Na, ist ja auch egal. Wo waren wir stehengeblieben?«, fragte Jan. »Beim Krieg, stimmt’s? Ich bin zu alt, um eingezogen zu werden. Ich kann nicht mal mehr richtig laufen. Sie wissen ja, Herr Kommissar, in unserem stolzen Vaterland bin ich nicht der Einzige, der untauglich ist. Unser Flugzeugminister würde mit seiner Wampe in kein Cockpit passen, und der Radiominister hat ’nen Hinkefuß, der schafft es sicher nicht bis Afrika.«
»Jan!«, mahnte Krell.
»Jo. Ich spar mir den Rest. Weiß ja sowieso jeder, dass wir besser nicht nach der Abstammung des obersten Führers fragen. Der hat ja selber keine Ahnung, wer sein Vadda war.«
»Mensch, Jan, nu’ is’ gut. Du sabbelst dich noch um Kopf und Kragen.«
Jan setzte ein unschuldiges Gesicht auf, zog die Schultern hoch und breitete die Hände aus. »Sie haben doch das Thema aufgebracht, Herr Kommissar.«
Krell schüttelte den Kopf. »Ich wollte über einen anderen reden.«
Schubert und er hatten, nachdem sie die Fingerabdrücke des Toten bekommen hatten, mehrere Stunden beim Schein ihrer Schreibtischlampen im abgedunkelten Büro über der Kartei gesessen. Der Abgleich hatte schließlich einen Namen preisgegeben. Der Mann war zu Lebzeiten zweimal wegen Diebstahls aktenkundig geworden. 1931 hatte er sieben Monate in Fuhlsbüttel gesessen.
»Nun bin ich aber gespannt«, meinte Jan.
»Gustav Limba.«
»Ach, Limba. Kein großes Licht.«
»Kein großes Licht gewesen«, sagte Krell.
»Hat jemand ausgepustet«, entgegnete Jan ohne sichtbare Gefühlsregung. »Schon gehört.«
»Ach«, machte Krell.
»Die Reeperbahn ist ganz wie früher.« Jan klopfte auf den Zeitungsstapel vor ihm auf dem Tresen. »Eigentlich brauchst du hier keine Zeitungen, so viel wie hier geschnackt wird.«
»Hast du auch gehört, wem Limba im Weg war?«
Jan lachte. Es klang künstlich, trotzdem lachte er weiter, bis es in ein Husten überging. »Bin ich der Kommissar, oder was?«
»Das nicht. Aber du bist der mit den Ohren auf der Reeperbahn.«
»Das stimmt. Leider kann ich nicht helfen, davon hab ich nichts gehört.«
Krell pustete neuen Rauch in die Luft. Die Glut seiner Zigarre hatte jetzt eine satte rötlichgelbe Farbe. Der Tabak war aromatisch, er schmeckte etwas süßlich. Trotz des Krieges hatte Jan gute Ware in seinem Laden.
»Limbas Leiche wurde in einem Schuppen neben der Sankt Pauli-Brauerei gefunden. Von den Nachbarn dort hat niemand etwas mitbekommen«, behauptete Krell, obwohl Schubert noch nicht zurück war und also auch noch nicht berichtet hatte. »Fast könnte man denken, es sei allgemeine Taubheit ausgebrochen.«
»Tja«, machte Jan.
»Was soll das heißen?«
»Fragt sich der Kriminale da nicht, warum das so ist?«
»Doch, sicher. Und ich frage dich. Müssen wir an ein hohes Tier denken, das allen Leuten auf dem Kiez eingeschärft hat, auf keinen Fall das Maul aufzumachen? Vielleicht sogar einem freundlichen, Zigarre rauchenden Herrn in einem Zeitungskiosk.«
Jan paffte gedankenversunken. Krell hatte den Eindruck, er überlege sich seine Antwort. Anders als bei seinen losen Reden über die hohen Nazis wirkte er auf einmal bedacht, ja kein falsches Wort von sich zu geben. Er bekam eine Verlängerung seiner Bedenkpause, als die Tür ein weiteres Mal aufging. Ein Mann, der seinen Hut nicht abzog, verlangte nach einem Päckchen Nil. Während Jan ihm die Zigaretten auf den Tresen legte, musterte der Mann Krell mit zusammengekniffenen Augen und fragte sich offenbar, ob er von ihm etwas zu befürchten hatte. Dann sagte er zu Jan: »Ich hab so einen trockenen Mund. Gib mir was zum Befeuchten.«
Unter dem Tresen zog Jan eine Schublade auf und nahm ein etwa fingergroßes Glasfläschchen heraus. Der Kunde drehte am Deckel und trank einen ersten Schluck. Er zahlte und grüßte mit einem Nicken, bevor er ging.
»Die Tageszeitungen gehen offenbar nicht so gut?«
»Zeitungen? Die laufen unten am Fischmarkt besser. Als Packpapier. Im Unterschied zu hier ist es da schietegal, wie alt sie sind. Steht doch sowieso nur Mist drin.«
»Mensch, Kerl«, seufzte Krell. »Pass bloß auf, dass sie dich nicht mal abholen. Weißt du noch, wo wir waren?«
»Sicher. Das große Schweigen auf dem Kiez.«
»Lass mich mal theoretisch fragen: Wenn du mir erzählen würdest, was wahrscheinlich schon ganz Sankt Pauli weiß … Aber für mich wäre das ein entscheidender Hinweis … Und daraufhin verhafte ich einen der Großluden, den Kahlen Conny oder Paul mit der Narbe – könntest du dann sicher sein, dass du morgen deinen Laden noch aufschließen kannst?«
»Über die Zukunft kann man sich nie sicher sein. Da ist der liebe Gott vor.«
»Heute kommst du mir aber ganz besonders blöd, Jan. Der liebe Gott lebt nun gewiss nicht auf’m Kiez.«
»Stimmt auch wieder.« Jan rauchte und mied dabei Krells Blick. »Obwohl wir hier ’ne Kirche haben.« Plötzlich richtete er sich auf. Auch seine Stimme veränderte sich, sie bekam etwas Offiziöses. »Sie haben recht, Herr Kommissar, es gibt viel Sünde im Viertel des heiligen Paulus, und es gibt eine Menge Leute, die glauben, der Herr wird eines Tages Feuer über uns ausgießen wie über Sodom und Gomorrha.« Jan steckte seine Zigarre zwischen die Lippen und schmunzelte, er wollte zeigen, dass er einen Scherz gemacht hatte. »Soll ich mal ganz ehrlich antworten, Herr Kommissar?«
»Ich bitte darum.«
»Ich habe keine Ahnung, wer Limba ins Jenseits befördert hat und warum. Das Einzige, was ich sagen kann: Auf Sankt Pauli war der Junge ein kleines Licht. Ein besserer Laufbursche. Manchmal verdiente er ’ne Mark oder zwei damit, dass er mit älteren Damen tanzte, deren Männern das zu anstrengend war. Und wenn sie das mochten, hat er seine Hand auch über ihren Hintern gleiten lassen. So einer war der Limba.«
»Mit einem solchen Typen geben sich die großen Tiere nicht ab?«
Jan zuckte mit den Achseln.
»Verstehe«, sagte Krell. »Wo hat er gewohnt?«
»In der Pension Grüber, soweit ich weiß. Können Sie mich aber nicht drauf festnageln.«
»Am Hamburger Berg?«
»Genau da.«
Krell stand auf. Seine Zigarre war erst zur Hälfte geraucht. Er würde sie mitnehmen und auf der Straße weiterpaffen. »Mach’s gut, Jan. Bis zum nächsten Mal.«
»Es ist mir immer eine Ehre, Herr Kommissar. Viel Glück.«
»Dir auch.«
»Und dann noch Heil Hitler. Damit Sie beruhigt sind.«
»Heil Hitler«, erwiderte Krell und verschwand.