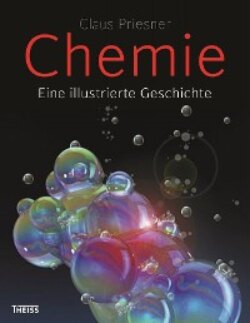Читать книгу Chemie - Claus Priesner - Страница 35
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Stoa und Gnosis
ОглавлениеDer rein materielle Materiebegriff, wie er eben dargestellt wurde, hätte dem Denken der Alchemisten nur teilweise entsprochen. Er wurde durch die Vorstellungen zweier anderer Denkschulen ergänzt. Die Schule der Stoa entstand gegen Ende des 4. Jh. v. Chr. und erhielt ihren Namen von der »Poikile Stoa«, einer bunt ausgemalten Wandelhalle auf der Agora, dem Hauptplatz, von Athen, die von den Stoikern ursprünglich als Unterrichtsort benutzt wurde. Die Stoiker glaubten an einen vernunftbegabten, beseelten Kosmos, der von einer geistigen Kraft, dem Logos, durchdrungen und gelenkt wird. Aus Feuer und Logos formt sich das Pneuma, das »feinstofflichen« Charakter besitzt. Logos und Pneuma verhalten sich wie Seele und Geist, bisweilen werden sie auch gemeinsam einem himmlischen Äther gleichgesetzt. Der Geist wird zur treibenden Kraft im Kosmos. Um wirksam werden zu können, benötigt das Pneuma jedoch eine stoffliche Basis, die unvergängliche, aber veränderliche Materie (Hyle), die die Qualitäten warm, kalt, trocken und feucht, in stets wechselnden Verhältnissen, annehmen kann. In seiner mit dem Pneuma unverbundenen Form ohne Qualitäten existiert der Urstoff als Materia prima, die eines der zentralen Rätsel der Alchemie ausmacht, denn mit ihr beginnt das Große Werk, das mit der »Materia ultima«, dem Stein der Weisen endet. Mit Poseidonios (135–51 v. Chr.) kommt die Astrologie in das Denken der Stoa und wird danach in die Alchemie integriert. Ausgehend vom Zusammenhang der Mondbewegung mit den Gezeiten folgerte er, dass nicht nur Sonne und Mond, sondern auch die übrigen Himmelskörper das Geschehen auf der Erde beeinflussen. An die Stelle babylonischer traten griechisch-römische Planetengötter, die in der Alchemie mit den sieben klassischen Metallen identifiziert wurden. Materielle Güter galten den Stoikern als völlig unbedeutend (daher kommt die »stoische Ruhe«).
Mehr noch als die Stoiker beeinflusste die Gnosis die sich entwickelnde Alchemie. Unter diesem Namen, der »Erkenntnis« bedeutet, fasst man eine Reihe spätantiker religiös-mystischer Bewegungen zusammen, in denen sowohl christliche wie babylonische, persische und ägyptische Vorstellungen vereinigt wurden und die im 2. Jh. n. Chr. in Alexandria ihre Blütezeit erlebte. Den Gnostikern ging es nicht um die Erkenntnis rationaler Zusammenhänge, sondern vielmehr darum, den in der Schöpfung wirkenden Gott zu erkennen, nachzuahmen und auf diese Weise selbst Macht über die Natur zu erlangen. Ferner besteht bei der Gnosis ein durchgängiger Dualismus von Gott und Materie als Gegensatz von Gut und Böse. Die Gnosis nahm hier die persische, auf Zarathustra (um 630–533) zurückgehende Vorstellung vom Lichtgott Ahura Masda auf, der mit dem Herrscher der Finsternis, Ahriman, im Kampf liegt. Der Lichtgott bzw. das göttliche Licht repräsentiert für die Gnostiker die gute, immaterielle, reine Seele, Ahriman die unvollkommene, das Niedere, Dunkle und moralisch Böse verkörpernde Materie. Am Ende der Zeiten steht die Niederlage Ahrimans, gnostisch interpretiert der Sieg des Geistes über die Materie.
Isaac Newton als Demiurg. Gemälde von William Blake, 1795.
Ein unerreichbar ferner höchster Gott überträgt das Schöpfungswerk der Welt untergeordneten Göttern, den Demiurgen, die den stufenweisen Abstieg des reinen, göttlichen Geistes in die Niederungen der sündhaften materiellen Welt bewerkstelligen. Die Demiurgen sind selbst nicht frei von Sünde und können daher keine vollkommene Welt schaffen.
Nur die reine Seele stammt vom höchsten Gott, muss jedoch auf ihrem Weg ins Körperliche die Demiurgen passieren und dabei Mängel und Fehler aufnehmen, aber ihr verbleibt ein »Göttlicher Funke«, dank dessen der Mensch sich selbst bzw. seine Seele reinigen kann. Die gnostische Geringschätzung des Materiellen und die Überbetonung des Geistig-Seelischen als des einzig »Reinen« entsprechen vollkommen der christlichen Weltdeutung und stehen in klarem Gegensatz zur ägyptischen Auffassung. Die Alchemie greift diesen Dualismus auf, vermeidet aber jede einseitige Gewichtung. Für die Alchemie liegt der entscheidende Aspekt nicht auf der Überlegenheit eines von zwei Antipoden, sondern auf deren Aufgehen in einer gemeinsamen »höheren« Synthese, bekannt als Vereinigung der Gegensätze. Diese Vereinigung resultiert in ihrer höchsten Form im Stein der Weisen.
Die ältesten im Original erhaltenen Textzeugnisse chemischen Inhalts stammen vermutlich vom Ende des 3. oder dem Beginn des 4. Jh. v. Chr. und werden nach ihren heutigen Aufenthaltsorten »Papyrus Leiden« und »Papyrus Stockholm« benannt. Die Papyri waren nicht zum praktischen Gebrauch bestimmt, sondern bildeten Grabbeigaben. Die Inhaber der Gräber waren wahrscheinlich Tempelpriester gewesen. Beide Texte behandeln die Herstellung von Legierungen, die wie Gold und Silber aussehen, aber nur wenig echte Edelmetalle enthalten. Weitere Themen sind die Nachahmung von Edelsteinen und von wertvollen Farbstoffen wie Purpur. Die Verfasser wie die Anwender der in den beiden Papyri beschriebenen Rezepturen waren keine Alchemisten, denn sie waren sich durchaus im Klaren, dass sie Vorschriften zur Imitation oder zumindest zur Verfälschung edler Metalle, Farben oder Steine gaben. Die Alchemisten dagegen entwickelten die Vorstellung, dass, ausgehend von der Lehre der Umwandelbarkeit der Elemente, auch die Möglichkeit bestehen müsste, insbesondere Gold und Silber nicht nur zu imitieren, sondern tatsächlich zu erzeugen.
So entstand eine Theorie der Metallgenese, die scheinbar einen praktisch gangbaren Weg zu diesem Ziel wies und Folgendes besagte: Alle Stoffe bestehen aus einer an sich formlosen Ursubstanz (hyle, materia prima), die mittels einer Formkraft (pneuma) zu den vier Elementen wird, die sich ihrerseits zu den aktuell vorhandenen Körpern vereinigen. Die Unterschiede der konkreten Substanzen beruhen auf der unterschiedlichen Mischung der Elemente. Die Materie an sich wird passiv-empfangend und weiblich gedacht, das Pneuma erscheint aktiv-befruchtend und männlich. Die Materie ist letztlich die »Mutter Erde«, auf der wir leben, die Formkraft ist astralen Ursprungs. Beide werden als gleichwertige Antipoden begriffen, die sich im Idealfall einer perfekten Vereinigung zu Gold verbinden. Im Gold sind die vier Elemente vollkommen harmonisch vereint, in allen anderen Substanzen erfolgt diese Mischung und Vereinigung mehr oder weniger mangelhaft. Mit Hilfe der Alchemie vermag der Adept (der »Kundige«) diesen natürlichen Vorgang im Labor nachzuahmen. Schon in den frühesten alchemischen Texten erscheint auch die Behauptung, dass diese Umwandlung mittels eines bestimmten Pulvers, das als »Stein der Philosophen«, als »Stein, der kein Stein ist« oder als »Xerion« bezeichnet wird. Später setzte sich der Name »Stein der Weisen« bzw. »Lapis philosophorum« durch. Das Große Werk (Opus magnum) umfasst folgende Arbeitsschritte:
Zunächst muss man einen geeigneten Ausgangsstoff in den Urzustand der Materia prima, auch Chaos genannt, zurückführen. Welcher konkrete Körper sich dafür am besten eignet, ist unsicher. Von den frühen Autoren werden insbesondere das Blei, das Kupfer oder die sog. »Tetrasomie« genannt, eine Legierung der vier unedlen Metalle Blei, Kupfer, Zinn und Eisen. Die Hinzufügung eines kleinen Quantums echten Goldes oder Silbers als eine Art Metallsamen wird verschiedentlich empfohlen. Die erste Stufe des Opus ist mit der Farbe Schwarz verbunden (wird als Nigredo bezeichnet, auch als Rabenhaupt oder caput corvi). Der nächste Schritt besteht in der Neuformierung der Urmaterie durch das Pneuma, wobei die vier Elemente perfekt gemischt werden müssen. Diese Stufe führt entweder direkt oder über eine als Pfauenschweif (cauda pavonis) bezeichnete Vielheit von glänzenden Farben zu einem weißen Körper (Albedo). Dieser noch nicht völlig ausgereifte »Stein« vermag schon Metalle zu verwandeln, zwar nicht in Gold, immerhin aber in Silber. Über eine vorwiegend in der frühen alchemischen Literatur genannte gelbe Phase (Xanthosis, Citrinitas) gelangt der Alchemist zum perfekten »Lapis philosophorum«, der mit der Farbe Rot verbunden ist (Rubedo). Diese Farbe steht in der Alchemie für die höchste Vollendung, nicht etwa das dem Gold eigene Gelb. Der Stein der Weisen ist selbst kein Gold, er ist ein Verwandlungs- oder Heilmittel (pharmakon, xerion), das die imperfekten, unedlen, also irgendwie »kranken« Metalle heilt, indem es sie zum Gold veredelt.
In diesem Kupferstich nach einem Wandgemälde von Hans Vredeman de Vries werden die beiden Aspekte alchemischen Arbeitens, nämlich die Praxis und die mystisch-religiöse Versenkung, aber auch der durch die Musikinstrumente symbolisierte Bezug zur Kunst – schließlich sprach man von der »ars hermetica« – zusammengefasst. Derart geräumige und prächtige Laboratorien dürfte es indes kaum gegeben haben.
Wegen der Verbindung der unterschiedlichen Stufen des Prozesses mit bestimmten Farben wurde die Alchemie auch als eine Färbekunst betrachtet und der »Stein« deshalb auch als »Tinktur« (Färbemittel) bezeichnet. Farben spielen in der Alchemie eine wichtige Rolle. Dies gilt für die einzelnen Stufen des Opus magnum, aber auch für Planeten und Metalle. In dem, dem Opus magnum metaphorisch analogen, Isis-Osiris-Mythos wird der immer wieder sterbende und nach dem Tod wiederbelebte Osiris, der als Symbol der Fruchtbarkeit und der sich ständig erneuernden Natur galt, mit der Farbe Schwarz verbunden, sofern sein Sterbeaspekt, mit der Farbe Weiß hingegen, sofern seine Wiederauferstehung gemeint war. Das Auftreten bestimmter Farben während des Großen Werkes darf nicht mit einem beobachtbaren Vorgang gleichgesetzt werden. Die Farben werden den Reifungsstufen ähnlich zugewiesen wie die Qualitäten den Elementen. Ihre Zuordnung ist als Metapher zu verstehen, ähnlich unseren assoziativen Verbindungen, wo Rot für Liebe oder Hass steht, Grün für die Hoffnung, Gelb für den Neid, Schwarz für den Tod und Weiß für die Unschuld.
Das Große Werk selbst dauert je nach Ansicht der unterschiedlichen Autoren neun oder sieben Monate, Wochen oder Tage (auch andere Zeitspannen kommen vor). Wegen des engen Zusammenhangs der Alchemie mit der Astrologie ist es auch wichtig, für die einzelnen Prozessschritte den richtigen Zeitpunkt zu bestimmen, der durch entsprechende Planetenkonstellationen gegeben ist. Die Anwendung des Lapis, die Projektion, erfolgt durch Einbringen einer winzigen Portion desselben in eine Metallschmelze (meist Blei) oder erhitztes Quecksilber. Die Umwandlung in Gold vollzieht sich dann innerhalb weniger Augenblicke.
In seiner Arbeit wiederholt der Alchemist symbolisch den Isis-Osiris-Mythos; er ahmt aber auch eine Schwangerschaft nach oder das Wachstum eines Getreidehalms aus einem Samen in der Erde Die Bereitung des »Steins« erlernte man in den heiligen Kultstätten Ägyptens und in den Bibliotheken der Ptolemäer, besonders aber im Serapeion, dem Tempel des ägyptisch-hellenistischen Gottes Serapis (einer Mischgottheit von Osiris und dem heiligen Stier Apis) in Alexandria.
Auch wenn der Alchemist mit seinem Werk die Natur nachahmt, tritt in Form des Lapis doch ein in der Natur nicht vorhandener und daher von dem allsorgenden Schöpfer quasi auch nicht vorgesehener Stoff zutage. Dies war in der Welt des Christentums problematisch, wurde doch die göttliche Schöpfung als vollkommen hingestellt.
Entsprechend dem mythisch-magischen kulturellen Kontext ihrer Entstehung verehrten die Alchemisten auch mehrere legendäre götterähnliche Gestalten als Gründer, unter denen besonders eine hervorragt – Hermes Trismegistos. In der Gestalt dieses »dreimalgrößten Hermes« sind zwei Götterfiguren vereinigt, nämlich der ägyptische Thot und der griechische Hermes bzw. der römische Merkur, der für die Hellenisten die göttliche Personifikation allen Wissens und des schöpferischen Geistes war. Auf diese Weise symbolisiert Hermes Trismegistos auch sehr treffend die Vereinigung von ägyptischem und griechischem Kulturgut zu einem neuen Ganzen. Ursprünglich hieß die Alchemie nach jenem Hermes Trismegistos auch die »Hermetische Kunst« (ars hermetica). Hermes wurde eine Vielzahl von Texten zugeschrieben, die in der Zeit von 100 v. Chr. bis 300 n. Chr. entstanden. Diese »Hermetica« wurden während des Mittelalters von den Arabern weitertradiert, gerieten aber in Europa in Vergessenheit und wurden erst 1491 von Marcilio Ficino (1433–1499) wieder entdeckt und übersetzt. Sie galten bis ins 17. Jh. hinein für die authentischen Werke eines überragenden ägyptischen Gelehrten, der vielleicht schon vor der Zeit Abrahams gelebt habe.
Der älteste historisch fassbare Alchemist, Zosimos von Panopolis, entstammte der oberägyptischen Stadt Panopolis und scheint schon in früher Jugend nach Alexandria gelangt zu sein. Seine Lebenszeit lässt sich auf das späte 3. und frühe 4. Jh. eingrenzen. Offenbar stark von der Gnosis beeinflusst, setzt Zosimos die Alchemie in eine innere, psychologische Beziehung zum Alchemisten. Um zum Adepten, also zum in alle Geheimnisse eingeweihten Meister der hermetischen Kunst zu werden, muss der Alchemist nicht nur von geeigneten Lehrern unterwiesen werden, die Schriften und die Natur studieren, sondern er muss auch charakterlich geeignet, ja göttlich begnadet sein. Erlernbares Wissen und praktische Fähigkeiten müssen durch visionäre und intuitive Inspiration ergänzt werden. Zosimos schildert seine Traumvision des Opus magnum, in welcher der »Kupfermensch« (Chalkanthropos) zum »Silber«-(Argyranthropos) und schließlich zum »Goldmenschen« (Chrysanthropos) vervollkommnet wird. Hier wird erstmals eine unmittelbare Beziehung zwischen der Veredelung der Materie und derjenigen des Alchemisten hergestellt. Die Alchemie wird bei Zosimos zu einem geheimnisvollen Gesamtgebilde aus Mystik, Magie, Naturerforschung und Selbsterfahrung. Diese Sichtweise begründet die bis heute andauernde Faszination, die die Alchemie ausstrahlt. Auf ihr baute auch der Psychologe Carl Gustav Jung (1875–1961) seine Studien zur Alchemie auf; er glaubte in Letzterer eine Projektion menschlicher Grundgefühle (Archetypen) zu erblicken. Zosimos repräsentiert jenes Verständnis der Alchemie, das weniger auf die Erforschung der Natur und die konkrete Suche nach dem Stein der Weisen ausgerichtet ist, sondern die Alchemie als Allegorie der göttlichen Schöpfung begreift und durch mystische Versenkung das Wesen der Natur und des Menschen und seiner Eingebundenheit in die Einheit von Makro- und Mikrokosmos zu ergründen sucht.