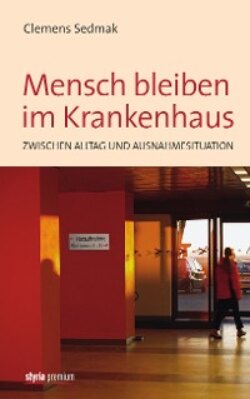Читать книгу Mensch bleiben im Krankenhaus - Clemens Sedmak - Страница 9
ALLTAG
ОглавлениеAlltag ist das, was dem Leben Halt und Struktur gibt; Alltag ist die Gesamtheit der sich täglich wiederholenden Abläufe und der Inbegriff dessen, was wir als „gewöhnlich“ ansehen. Die Frage: „Ist heute etwas Besonderes vorgefallen?“, zielt auf Außeralltägliches ab. Alltag aber hat mit Normalität, Erwartbarkeit, Vorhersagbarkeit, verlässlicher Wiederholung zu tun. Die individuelle „Alltagstauglichkeit“ wiederum sagt viel über seelische und soziale Gesundheit aus, über das Vermögen, das Leben mit seinen Anforderungen zu bewältigen.
In der sozialen Welt gibt es das Phänomen der „erschöpften Familien“; es handelt sich dabei um Familienkonstellationen, die dem Alltag nicht mehr gewachsen sind: Eltern, die keine Post mehr öffnen, Eltern, die die Kinder nicht mehr in die Schule schicken, Eltern, die lethargisch geworden sind und den Kindern keine Fürsorgehaltung mehr entgegenbringen. In erschöpften Familien kann der Haushalt nicht mehr geführt werden. Aus diesem Grund haben Hilfsorganisationen Programme zur Unterstützung von erschöpften Familien in der Haushaltsführung entwickelt, dabei geht es um vermeintlich triviale Dinge wie das Putzen von Badezimmer und Toilette, die Entsorgung von Müll, das Erledigen von Einkäufen, die Ordnung im Haus. Diese elementaren Aspekte der Lebensbewältigung prägen den Alltag.
Gerade in einer „entrhythmisierten“ Zeit, die hohes Tempo und große Flexibilität abverlangt, ist der Alltag auf vielfache Weise bedroht. Damit geht viel an Lebenssicherheit verloren. Die deutsche Philosophin Hannah Arendt hat den alltäglichen Lebensvollzügen, die viel mit „Arbeit“ zu tun haben, besondere Aufmerksamkeit geschenkt und deren strukturierende Kraft hervorgehoben. Die ungarische Soziologin Agnes Heller hat den Zusammenhang zwischen Alltag und Kreativität beziehungsweise Fortschritt betont.21 Heller war in ihrem Denken von der Überzeugung geleitet, dass die großen Leistungen einer Kultur aus Herausforderungen, Problemen, Konflikten und Bedürfnissen des täglichen Lebens herrühren. Auch Alltag und die Bewältigung des Alltags strukturieren somit maßgeblich unser Leben.
Alltag im Krankenhaus
Fragen von „Alltag“, der Aufbau von Strukturen von Regelmäßigkeit, spielen auch in einem Krankenhaus eine entscheidende Rolle. Beispielsweise sind Kinder, die für einen längeren Krankenhausaufenthalt aus ihrer vertrauten Umgebung herausgerissen werden, traumatisiert und auf die Errichtung eines „Schutzraums“ angewiesen, der innere und äußere Sicherheit bietet. Bezugspersonen und die Etablierung eines Alltags sind hier wichtige Schritte zum Aufbau eines solchen Schutzraums.22 Gerade in Zeiten der Verunsicherung (der Körper lässt aus, die Institution ist fremd, die Zukunft ist ungewiss) geben Alltagsstrukturen als Pfeiler der Verlässlichkeit und Wiedererkennbarkeit Stütze und Halt. Man könnte auch sagen: Alltag zu etablieren – nicht zuletzt über stabile Bezugspersonen – ist wichtiger Teil einer Ethik des Krankenhausalltags.
Gleichzeitig gehört zu einer „Ethik des Alltags“ auch die hilfreiche Unterbrechung des Alltags. Viele Patient/inn/en erleben den Alltag als „lang“ und „langweilig“. Im oft eintönigen Tagesablauf empfinden sie die Zeit, die andere Menschen ihnen bewusst zur Verfügung stellen und mit ihnen verbringen, als besonders wertvoll. Insbesondere die Zeit während der Besuche von Freunden und Verwandten (von sogenannten „intimates“) gilt als kostbar, was sich darin zeigt, dass Patient/inn/en versuchen, diese Zeit ganz bewusst zu verbringen.23 Diese Momente des Austauschs und der Begegnung mit anderen – zum Teil finden sie auch zwischen den Patient/inn/en statt – bewirken nach einigen Erfahrungsberichten ein „schnelles Verstreichen der Zeit“, das im Gegensatz zur Trägheit und Schwere des üblichen Krankenhausalltags steht. Für Patienten, die ans Bett gefesselt sind und darüber hinaus wenig Besuch von Angehörigen erhalten, ist es naturgemäß am schwersten, die erwähnten Momente der Abwechslung zu erleben.
Hier ist die Frage nach der kreativen Alltagsdurchbrechung, nach Feierkultur und Ausnahmeregelungen zu stellen. Peter von Matt hat in seiner Rede zur Eröffnung der Salzburger Festspiele 2012 die Bedeutung von „Freiheit“ und „Überfluss“ für das Fest hervorgehoben. Menschliches Leben findet dort statt, wo auch Alltag unterbrochen und gefeiert werden kann. Es war Aristoteles, der auf die Bedeutung dieser Freiheit hingewiesen hat: „Überall den Nutzen zu suchen, passt nicht für den Hochgemuten und für den Freien.“24 Nach einem Gedanken von Matthew Fox ist es ein Zeichen von Gemeinschaftskultur, wenn Menschen miteinander feiern können. Oder anders gesagt: Man erfährt viel über eine Gemeinschaft, wenn man den Blick darauf richtet, wie sie den Alltag gestaltet, aber auch durchbricht.
Eine Ethik für den Krankenhausalltag wird sich deswegen auch die Frage nach „Ausnahmen von Regelungen“ stellen. Ein Beispiel:
„Die Nachtschwester hat sich daran gewöhnt, dass in meinem Zimmer meist das Licht brennt. Sie kommt auf ihren Runden stets auf einen Sprung herein, und während sie die Leintücher strafft und die Kissen aufschüttelt, plaudern wir ein wenig über das Buch, in dem ich gerade lese, oder über die Gedanken, die einem so kommen, wenn einen der Schlaf flieht. Doch die Gespräche bleiben meist nur Fragmente, weil nach kurzer Zeit schon die rote Suchlampe zu blinken beginnt. Dann huscht meine Gesprächspartnerin, eine Entschuldigung murmelnd, eilends in den stillen Korridor hinaus, um einem anderen Patienten auf der Abteilung Hilfe zu bringen. Dennoch freuen mich diese nächtlichen Visiten. Sie unterbrechen die Stille der langen Stunden und sind echte menschliche Begegnungen.“25
Es geht also um Alltag mit seiner Verlässlichkeit und seinem Schutz und auch um die Durchbrechung und Unterbrechung dieses Alltags. Nun stehen wir vor der Aufgabe, allgemeines ethisches Nachdenken mit den Herausforderungen des Alltags zusammenzubringen. Ethisches Nachdenken über gutes Leben stellt eine Fundamentalfrage: Worum soll es überhaupt gehen, wenn wir über „gutes Leben“ nachdenken? An welchen Punkten sollen wir uns orientieren? Welche „moralischen Güter“ sollen geschützt werden? Sie machen „gutes Leben“ in einem ethischen Sinn erst möglich. Die Menschenrechtskataloge beispielsweise enthalten eine Vielzahl von direkten wie indirekten Aussagen über moralische Güter. Woran sollen wir uns halten? Oder auch: Welche moralischen Güter sollen im Krankenhausalltag hergestellt werden? Ich möchte im Folgenden drei nennen, an denen wir uns im Krankenhausalltag orientieren sollten:
Menschenwürde und Selbstachtung,
Gemeinschaftsordnung,
Menschlichkeit.
Menschlichkeit im Beruf leben
Am ausführlichsten will ich mich dem ersten Punkt „Menschenwürde und Selbstachtung“ zuwenden. Bevor dies diskutiert wird, einige Bemerkungen zu „Gemeinschaftsordnung“ und „Menschlichkeit“. „Menschlichkeit“ ist die Fähigkeit, den Menschen als Menschen zu sehen. Susan Spencer-Wendel erinnert in ihrer eigenen Krankheitsgeschichte an den Unterschied von „technischer Perfektion“ und „Menschlichkeit“: Nach ihrer ALS-Diagnose wurde sie in eine auf ALS spezialisierte Klinik in Miami aufgenommen. Eine Messung nach der anderen wurde durchgeführt, ein Kurzgespräch folgte dem anderen, Spezialistinnen und Spezialisten aus verschiedenen Disziplinen begutachteten sie. Es war technisch perfekt, nur … „This was a cattle call, not treatment“, „Sie messen mich zu Tode“26 … Susan Spencer-Wendel setzte keinen Fuß mehr über die Schwelle dieses hoch angesehenen und bestausgestatteten Krankenhauses. Es fehlt an Menschlichkeit, an jenem Blick auf den besonderen Menschen als besonderen Menschen.
„Menschlichkeit“ ist auch die Fähigkeit, nicht in die Falle der „Menschenblindheit“ zu tappen, die der israelische Philosoph Avishai Margalit beschrieben hat.27 Menschenblindheit ist die Unfähigkeit, Menschen als Menschen zu sehen, und zeigt sich darin, dass Menschen wie Objekte behandelt werden. Anna Sam hat in der Schilderung ihrer mehrjährigen Erfahrungen als Kassiererin in einem Supermarkt die Dynamik beschrieben, selbst wie eine Sache, wie ein Gegenstand behandelt worden zu sein.28 Sie identifiziert die Kundinnen und Kunden als die größte Belastung und als Eintrittsstelle für Erniedrigung in diesem Beruf. Sie hat als Supermarktkassiererin die Menschenblindheit der Kundinnen und Kunden beschrieben, die die Interaktion mit der Kassiererin in vielen Fällen ohne Blickkontakt abwickelten. Die Dame an der Kassa wird zum Teil des Objekts „Kassa“ und nicht mehr als Mensch wahrgenommen.
„Menschlichkeit“ ist eine Kultur, die den besonderen Menschen noch als besonderen Menschen sehen lässt. In einem Krankenhaus bedeutet dies etwa, dass ein Patient nicht nur ein Mensch mit Gesundheitsproblemen ist, sondern auch eine unverwechselbare Person mit einzigartigen Eigenschaften, dass eine Patientin nicht nur eine Kostenstelle ist, sondern auch ein Mensch mit Innenleben und Geschichte. Realistischerweise ist es im Alltag des Krankenhauses nicht immer und überall möglich, den ganz besonderen Menschen zu sehen, aber es mag hilfreich sein, dann und wann innezuhalten und sich vor Augen zu führen: Wir haben es mit Menschen zu tun! Dies gilt auch für die Sichtweise von Patient/inn/en, die das pflegende und ärztliche Personal als Menschen und nicht bloß als „Leistungserbringer/innen“ einstufen sollten. Auch Patient/inn/en sollten sich vergegenwärtigen: Hier arbeiten Menschen!
Ina Yalof erzählt ein berührendes Beispiel von Menschlichkeit aus dem „Columbia Presbyterian Medical Center“ in New York. Eine offensichtlich unter massiven Herzproblemen leidende Frau schleppte sich, ihre kleine Enkeltochter auf dem Arm, ins Krankenhaus und wurde sofort notversorgt. Das kleine Mädchen blieb im Warteraum sitzen, wurde immer ungeduldiger und fragte schließlich den anwesenden Sicherheitsbediensteten: „Meine Oma hat mir versprochen, mir etwas von McDonald’s zu kaufen. Können Sie bitte hineingehen und ihr sagen, dass sie endlich kommen soll?“ Der Mann ging zu einem durch einen Vorhang abgetrennten Bereich, spähte hinein und sah, wie Ärzte und Schwestern fieberhaft an der Dame arbeiteten. Er zögerte, ging zurück zum Wartebereich, kniete sich vor dem Mädchen hin, dass er auf Augenhöhe mit ihr war, griff in die Tasche und holte eine Handvoll Münzen hervor, gab sie dem Mädchen und sagte: „Deine Oma will, dass du da hinten in der Cafeteria etwas zu essen für dich besorgst. Und dann kommst du gleich wieder zurück und wartest hier auf sie.“29 Das ist ein Zeichen von Menschlichkeit. Hier wurde ernstgenommen, dass wir es in einem Krankenhaus mit Menschen zu tun haben, die ein- und ausgehen.
Jede Gemeinschaft braucht Ordnung
Das moralische Gut der Gemeinschaftsordnung bezieht sich auf die Idee, dass ein Krankenhaus nach bestimmten Regeln abläuft, um „auf Dauer und im Ganzen“ gut funktionieren zu können. Ein Krankenhaus braucht Ordnung. Diese Ordnung ist im Interesse des Ganzen zu schützen; es kann nicht sein, dass eine Patientin eine ganze Abteilung „in Geiselhaft“ nimmt oder dass ein Patient ein Mehrbettzimmer rücksichtslos dominiert. Florian Teeg beschreibt einen Patienten, der Schmerzen hatte und ein Schmerzmittel verlangte – unter Umgehung aller Prozeduren: „Ich bring dich gleich um, du Idiot, wenn du mir nicht gleich was gibst! Gibt es denn in diesem Krankenhaus nirgends einen richtigen Arzt?“30 Es war derselbe Patient, der die Mitpatienten in seinem Zimmer tyrannisierte und das Personal durch ständige Sonderwünsche irritierte. Hier gilt der Hinweis auf die Notwendigkeit einer für alle verbindlichen Ordnung im Sinne der Sicherung des Ganzen, ein Hinweis, der auf möglichst alltagstaugliche Weise umgesetzt werden sollte. Erinnern wir uns an John Rawls: Auf welche Art von Krankenhaus würden wir uns verständigen, wenn wir unter einem Schleier des Nichtwissens zusammenkämen?
Neben der Verpflichtung auf größtmögliche Freiheiten wird wohl auch die Idee einleuchten, dass ein Krankenhaus seinen Auftrag bestmöglich erfüllen können muss. Und dieser Auftrag hat Aspekte, die eine Gemeinschaft als Ganze berühren. Menschen sind als soziale Wesen auf eine Sozialstruktur angewiesen, die mindestens Sicherheit und in einem anspruchsvolleren Sinn Zugang zu eigenen Fähigkeiten ermöglicht. Man könnte unter gesellschaftlicher Wohlordnung die Strukturiertheit eines Gemeinwesens verstehen, das von drei Eigenschaften getragen ist:
Es weist ein Regelwerk mit Stabilität und Spielraum auf,
es ist identifizierbar und weist die Fähigkeit zur lokalen Verdichtung auf,
es ermöglicht Zugang zu Quellen von Selbstachtung.
Diese drei Eigenschaften ergeben sich aus folgenden Überlegungen: Ohne Regelwerk, das der Verhaltensabstimmung dient, kann eine Gemeinschaft nicht überleben; ohne die Anpassung des Regelwerks an besondere und lokale Gegebenheiten geht es ins Leere – gerade deswegen sind Überlegungen in Richtung einer „kleinen Ethik für den Krankenhausalltag“ sinnvoll. Und: Selbstachtung wird als entscheidendes Gut identifiziert, das wir im Krankenhaus, wo wir es mit besonders verwundbaren Menschen zu tun haben, schützen wollen. Das bringt uns zum nächsten Punkt.
Die Selbstachtung
Das vielleicht entscheidende moralische Gut, das im Alltag eines Krankenhauses zu schützen ist, ist das Gut der Selbstachtung. Selbstachtung stellt im Kontext eines Krankenhauses ein gefährdetes Gut dar. Eine Sozialarbeiterin sagte im Interview:
„Manche regredieren regelrecht und … nehmen alles hin, was passiert. Sie übernehmen nicht mehr die Verantwortung für das, was passiert … sie fragen nicht nach. Viele fühlen sich sehr ohnmächtig … Sehr wenige trauen sich, nachzufragen … und manche fallen dadurch auf und werden unbequem … diese Abläufe im Krankenhaus … das stresst sie wahnsinnig.“
Durch Regression und Resignation wird Selbstachtung nicht gerade gefördert. Gerade auch aus diesem Grund wird man die Verantwortung der Patient/inn/en betonen. Ebenso entscheidend sind Möglichkeiten der Selbstgestaltung und die Schaffung bestimmter Schutzzonen. Das wichtige Wort, das in diesem Zusammenhang gerne genannt wird, um ethische Ziele zu formulieren, ist der Begriff der Menschenwürde. Ein Krankenhaus ist so zu gestalten, dass es Respekt vor der Würde des Menschen ausdrückt. Der Begriff der Würde schillert allerdings zwischen drei Bedeutungen: „würdig sein“ (Fest, Würdenträger, Kleidung); Würde im Sinne von sozialer „Ehre“ (die wiederum abgestuft und verwirkbar ist) und schließlich Würde im Sinne von „Menschenwürde“ (die nach unserem Verständnis unveräußerlich und für alle Menschen immer gleich ist).
In der Alltagssprache wird „Menschenwürde“ häufig als eine Form der besonderen „Ehre“ aufgefasst, was aber gefährlich ist, weil es im Unterschied zur sozialen Ehre für die Menschenwürde charakteristisch ist, dass sie nicht sozial abgestuft ist. So muss immer wieder daran erinnert werden, dass Würde eben nicht „Ehre“ ist, sondern tiefer geht. Das macht den Begriff etwas sperrig. Der Begriff der Menschenwürde ist auch deswegen sperrig, weil er so „pompös“ klingt, bei feierlichen Anlässen bemüht wird und wir nicht wirklich wissen, was wir mit dem Begriff im Alltag anfangen sollen.
Against all odds
Ich möchte drei Vorschläge für eine ethische Selbstvergewisserung machen. Erstens sollte der Umgang mit Menschen unter widrigen Umständen als Lackmustest für Menschenwürde angesehen werden (nennen wir das „decency in adversity“), also die Frage, ob Menschen auch unter erschwerten Rahmenbedingungen anständig behandelt werden. Man wird also mit besonderer Sensibilität auf solche widrige Umstände achten, zum Beispiel im Umgang mit Menschen, die nicht Deutsch als Muttersprache haben, im Umgang mit Menschen, deren Geisteskraft stark eingeschränkt ist, im Umgang mit Menschen, die als Wohnungslose zu den schwächsten Mitgliedern einer Gesellschaft zählen. Ethisch sensibel ist ein Kontext dann, wenn er die Würde jeder beteiligten Person in den Mittelpunkt rückt, insbesondere die Würde derjenigen, die darin besonders verletzbar sind. Ethik zeichnet sich also durch eine besondere Option für die „schwächere“ Partei aus. Ethisch handeln heißt also mit Blick auf den Respekt vor der Würde gerade auf den Umgang mit den verwundbarsten Mitgliedern einer Gesellschaft zu achten.
Menschenwürde und Intimsphäre
Zweitens möchte ich vorschlagen, in elementaren Lebensvollzügen (Gestaltung von Zeit und Raum, Schlafen, Essen und Trinken, Waschen, Ausscheiden) sensible Stellen, an denen Entwürdigung auftreten kann, zu sehen. Gerade für eine kleine Ethik des Krankenhausalltags ist diese Frage eine Einladung, sich Gedanken darüber zu machen, wie solche Abläufe möglichst würdesichernd gestaltet werden können – hier stellen sich konkrete Fragen wie: In welchen Abständen wird in einem Mehrbettzimmer die gemeinsame Toilette gereinigt? Wie kann man die Geräuschs- und Geruchsbelästigung von Mitpatient/inn/en durch die Toilettenbenutzung (was gleichzeitig für viele eine Hemmschwelle beim Ausscheiden ist) reduzieren? Wie kann guter Schlaf in einem Krankenhaus gesichert werden?
Dass wir es hier mit einem sensiblen Bereich zu tun haben, ist nicht von der Hand zu weisen. Menschen schlafen in der Regel in einem Krankenhaus nicht so gut wie daheim: „Schlaf“ ist im Krankenhaus ein heikles Thema. Das betrifft das Personal, bei dem guter Schlaf durch häufige Nachtschichten, durch Überarbeitung und Stress zur Mangelware werden kann. Das betrifft aber auch den Ort des Krankenhauses selbst: Im Rahmen des Krankenhausbetriebs ist es fast zwangsläufig so, dass auch in der Nacht keine vollständige Ruhe garantiert werden kann. Eine Metastudie31 untersuchte die Schlafqualität auf Intensivstationen und getestete Methoden zur Verbesserung der Schlafqualität. Sie schließt, dass die Schlafqualität vieler Patient/inn/en im Krankenhaus eher schlecht ist, dass aber verschiedene Formen der Intervention möglich sind. Diese reichen von Ohrstöpsel, der Vermeidung von lauten Geräuschen durch das Personal bis hin zu einer besseren Isolierung der Zimmer und Türen. Hier gibt es also Handlungsspielräume.
Neben dem Schlafen stellt auch das Essen als elementarer Vollzug eine Herausforderung dar: Häufig wird das Essen als Einschränkung empfunden, weil die Wahlmöglichkeiten natürlich begrenzt sind. Dazu kommt, dass die Mahlzeiten ein besonderes Gewicht in einer für Patient/inn/en „geschrumpften“ Welt bekommen – wenn der Handlungsradius klein geworden ist, werden solche regelmäßigen Ereignisse zu Höhepunkten. Das Essen ist auch insofern ein besonderes Thema, als sich hier alle zu Recht zuständig und urteilsberechtigt fühlen: Selbst wenn ich nicht das Niveau meiner medizinischen Behandlung treffsicher beurteilen kann, kann ich doch mit Autorität sagen, ob mir mein Essen schmeckt. In den Worten David Wagners: „Sich über das Essen zu beklagen gehört zur Krankenhausfolklore.“32 Hier hat man einen Bereich, in dem man sich kompetent artikulieren kann. Gleichzeitig ergibt das natürlich auch ein Gesprächsthema für die häufig schwierigen Krankenhausbesuche.
Einer der delikatesten Punkte der Krankenhausethik in Bezug auf elementare Vollzüge betrifft das Ausscheiden. Wir haben es hier mit einer alltäglichen, allen bekannten und intimen Handlung zu tun; eine Handlung, die vielfach auch im Rahmen von intimen Familienbeziehungen im geschützten Raum allein und in Ruhe vollzogen werden will. Besonders für Patient/inn/en, die nicht selbstständig auf die Toilette gehen oder diese aus medizinischen Gründen nicht benützen können, und auch für Patient/inn/en in einem Mehrbettzimmer ist dieses Thema problematisch.
„Ich lasse mir den Topf bringen und setze mich selbst drauf, das ist mir furchtbar peinlich. Ich versuche es bestimmt eine Stunde lang. […] Ich rede mir selbst gut zu. ‚Stell dich nicht so an, andere können das auch.‘ Es geht einfach nicht. Mir ist zum Heulen.“33
Dieser Hinweis auf die belastenden Bedingungen findet sich auch in einem Interview mit einer Krankenschwester wieder:
„Generell ist blöd, dass sie meistens zu zweit im Zimmer liegen … es kommt oft vor, dass Männchen und Weibchen in einem Zimmer liegen … es ist ein Vorhang dazwischen, aber mehr auch nicht. Du hörst jedes Geräusch … generell ist die Intimsphäre schwierig, vor anderen Patienten sowie auch vor mir … Unangenehm ist ihnen auch teilweise die Hilflosigkeit, wobei ich da auch mit ihnen darüber rede und sage:, Das ist halt so, ich übernehme das jetzt für Sie‘, weil beim Waschen ist es ja oft so, die können außer dem Gesicht nicht viel waschen, weil sie teilweise zu fertig sind beziehungsweise wegen den ganzen Sachen gar nicht wirklich können. 99 Prozent der Patienten wasche ich.“
Hier kann konkret an einer Ethik des Alltags gebaut werden – was kann getan werden, um diese elementaren Lebensvollzüge menschenwürdig, möglichst menschengerecht, menschengemäß und menschenfreundlich zu gestalten? Ein Hinweis am Rande: Humor hilft! Bischofberger erzählt aus Sicht einer Krankenschwester:
„(…) Er wollte sich sogleich wieder bei uns für den unangenehmen Geruch entschuldigen, aber meine erfahrene Kollegin ließ ihn gar nicht erst zu Wort kommen, sondern sie meinte spontan: ‚Machen Sie sich mal keine Sorgen, den Geruch kriegen wir gleich wieder aus dem Zimmer raus. Und wissen Sie, ich arbeite nun schon sehr lange in meinem Beruf, aber ich habe noch nie jemanden gepflegt, der Parfum scheißt.‘ Herr Müller blickte sie zunächst verdutzt an. Aber sofort hellte sich sein Gesicht auf und er begann herzhaft zu lachen. Eine für ihn unangenehme Situation hatte sich völlig unerwartet entschärft. Er wirkte sehr erleichtert. Derselbe Spruch war auch bei späteren ‚Aktionen auf dem Thron‘ eine wertvolle Hilfe (…)“34
Menschenwürde und Selbstachtung
Drittens möchte ich vorschlagen, dass der Begriff der Menschenwürde mit dem Begriff der Selbstachtung verbunden wird. „Selbstachtung“ drückt eine grundsätzliche Haltung mir gegenüber aus und spricht die Achtung an, die ich mir aufgrund meines Menschseins schulde. Selbstachtung ist eine Form des Respekts.
S. D. Hudson hat in einer bekannten Differenzierung vier Formen von Respekt unterschieden:35
„Evaluativen Respekt“, der mit „Bewunderung“ oder „Anerkennung von Leistung“ zu tun hat und erworben wird; eine Form des Respekts, die mit „Einschätzung“ zu tun hat;
„Hindernisrespekt“, der eine rücksichtnehmende Haltung gegenüber einem Gegenstand oder einer Person ausdrückt im Wissen, dass ohne entsprechende Rücksicht das Erreichen von Zielen verhindert werden kann. Diese Form des Respekts hat damit zu tun, etwas beziehungsweise jemanden ernst zu nehmen;
„direktiver Respekt“, der sich darin äußert, dass man Regeln und Abmachungen ehrt,
„institutionellen Respekt“, der sich darin äußert, dass man Institutionen und deren Repräsentant/inn/en durch entsprechendes Verhalten würdigt. Diese Form des Respekts drückt eine Anerkennung von sozialer „Ehre“ und sozialer „Bedeutung“ aus.
Wenn wir davon ausgehen, dass diese vier Formen von Respekt auch für die Diskussion des Begriffs der Selbstachtung relevant sind, und wenn wir sie nun auf den Begriff der Selbstachtung übertragen, könnten wir Folgendes festhalten:
Selbstachtung kann verbunden werden mit der Fähigkeit zur Selbsteinschätzung, also eigene Fähigkeiten und Leistungen zu sehen und zu würdigen.
Das wird dort erschwert, wo Menschen keinen Sinn für eigene Fähigkeiten entwickeln oder erbrachte Leistungen nicht entsprechend einschätzen können. Für ein Krankenhaus kann dies etwa die Frage bedeuten: Welche Handlungen kann ein/e Patient/in selbst vollbringen? Wird die „Eigenarbeitsfähigkeit“ der Patienten ernst genommen – das, was man auch „salutogenetische Eigenarbeit“ nennt? Wie viel wird der Patientin im Krankenhausalltag aus Gründen der Bequemlichkeit und Effizienz abgenommen, obwohl es die Patientin, wenn auch vielleicht mit höherem Zeitaufwand, selbst erledigen könnte? Inwieweit wird, um ein gewichtiges Wort zu verwenden, „die salutogenetische Eigenarbeit“ der Patient/inn/en ernst genommen, eingefordert und unterstützt? Wie ernst wird die subjektive Gesundheits- und Krankheitswahrnehmung der Patient/inn/en genommen? Wie sehr kann auch ein Krankenhausaufenthalt zur Ausbildung neuer Fähigkeiten genutzt werden?
Selbstachtung kann verbunden werden mit der Idee, sich selbst als ernst zu nehmendes Subjekt zu würdigen, das anderen als „Hindernis“ in den Handlungsweg treten kann.
Anders gesagt: Wenn ich mich selbst achte, nehme ich mich als Quelle von Ansprüchen, die an andere herangetragen werden und von ihnen Rücksichtnahme mir gegenüber abverlangen, wahr und ernst. Im Krankenhaus bedeutet dies, dass Patient/inn/en um ihre Rechte wissen, nicht alles unhinterfragt akzeptieren, auch Rückfragen stellen. Natürlich besteht in einem Krankenhauskontext die Möglichkeit, dass Patient/inn/en „herumgeschubst“ werden, ohne dass sie als relevantes „Hindernis“, auf das Rücksicht zu nehmen wäre, wahrgenommen werden. Das hat auch mit der erhöhten Verwundbarkeit zu tun. Reduzierter Gestaltungsspielraum und erhöhte Verwundbarkeit unterminieren die Möglichkeit von Selbstachtung als „Hindernis“-Selbstrespekt. Das ist in einem Krankenhaus nicht von der Hand zu weisen.
Selbstachtung kann als direktiver Selbstrespekt auftreten, als eine Form des „Ehrens von Abmachungen oder Regeln“.
Wenn man den Umgang zwischen Personal und Patient/in als Abmachung sieht, dann ist klar, dass Selbstachtung durchaus damit zu tun hat, den jeweils eigenen Teil der Abmachungen zu halten, also auch Pflichten anzuerkennen. Auf das Thema der Patient/inn/en-Pflichten werden wir noch zurückkommen. Weiters sind die Möglichkeiten, „Verträge mit sich selbst zu schließen“, sich selbst „Gesetze zu geben“, Kern des Gedankens von Autonomie in einem Kant’schen Verständnis.
Eine Patientin kann sich etwa vornehmen, in Würde mit der Krankheit umzugehen. Sie kann sich selbst das Gesetz geben, solange es möglich ist, sich Gesetze geben zu wollen. Das war der Entschluss von Ruth Picardie, einer jungen Engländerin, die in den 1990er-Jahren an Krebs starb und die sich vorgenommen hatte, die letzten Monate mit Würde und Lebensfreude zu leben. Ähnliches hat sich Susan Spencer-Wendel vorgenommen, die mit ALS diagnostiziert wurde und das voraussichtlich letzte Jahr, in dem sie sich bewegen konnte, intensiv für Reisen und Begegnungen nutzen wollte.36 Krankheit gefährdet diesen „Bestimmungs-Aspekt“ von Selbstachtung, weil kranke Menschen aufgrund der Ungewissheit ihrer Krankheitsentwicklung Schwierigkeiten haben, Versprechen abzugeben („An deinem Geburtstag bin ich wieder zu Hause“, oder: „Ich werde mit dir nach Rom fahren“). Ähnlich können auch die behandelnden Frauen und Männer nur bedingt Versprechen abgeben („Ich verspreche Ihnen, dass die Operation gut gehen wird“; „Ich verspreche Ihnen, dass Sie Weihnachten mit Ihrer Familie daheim feiern werden“). Auch hier sieht man, wie Selbstachtung in einem Krankenhaus ein gefährdetes Gut darstellt.
Selbstachtung kann viertens als „institutioneller Selbstrespekt“ auftreten.
Damit ist die Zugehörigkeit zu einer überindividuellen Einrichtung ausgedrückt – in diesem Fall jene zur „Menschheitsfamilie“. Jeder Mensch, so könnte man sagen, „repräsentiert“ Menschsein auf eine je besondere Weise. Mit dem Menschsein ist die angesprochene Idee der Menschenwürde verbunden. Selbstachtung wird dort unterminiert, wo Menschen nicht als vollwertige Mitglieder der Menschheitsfamilie angesehen und behandelt werden. Hier kann es verschiedene Formen der Diskriminierung geben, Sexismus, Rassismus, Herabwertung aufgrund des Lebensalters oder der religiösen Zuordnung. Der Punkt, an dem eine Erosion von Selbstachtung in diesem Sinne festgemacht werden kann, könnte die Erniedrigung sein. Auf diesen Begriff werden wir gleich zurückkommen.
Selbstachtung: ein gefährdetes Gut im Krankenhausalltag
Im Krankenhaus, wie wir im nächsten Abschnitt sehen werden, gibt es eine Reihe von möglichen Nährböden für Demütigung und Erniedrigung. Birgit Heimerl beschreibt Krankenhäuser als „Brutstätten und Austragungsorte peinlicher Situationen.“37 Hier steht immer wieder die Selbstachtung auf dem Spiel. Selbstachtung ist in einem Krankenhaus für alle Beteiligten ein moralischer Auftrag, gerade auch im Alltag, in dem sich Kulturen der Selbstachtung handfest zeigen. Dabei sind die Anerkennung als besonderer Mensch, die Gestaltungs- und Handlungsmöglichkeiten, die Anerkennung als Mitglied der Menschheitsfamilie die entscheidenden Quellen von Selbstachtung, die bestmöglich zu schützen sind. So kann man mithilfe des Begriffs der Selbstachtung den Begriff der Würde „operationalisieren“, also greifbarer machen und in Handlungen übersetzen. Es lassen sich wenigstens drei solche Bedingungen unterscheiden: symbolische, soziale und materielle Bedingungen der Möglichkeit von Selbstachtung. Diese können durch andere maßgeblich unterstützt werden.
Symbolische Bedingungen sind zum Beispiel Gesten, Worte und Taten der persönlichen Zuwendung und solche, in denen das Individuum in den Mittelpunkt gestellt wird. Einem Patienten zum Geburtstag zu gratulieren ist beispielsweise ein Akt, der dies unterstützt. Soziale Bedingungen sind solche der Mitbestimmung und der Information, der Kommunikation und der Interaktion mit anderen. In einem Krankenhaus hat das sehr viel mit „Informiertheit“ zu tun – weiß die Patientin, was im Laufe des Tages geschieht? Wurde der Patient über die einzelnen Diagnose- beziehungsweise Behandlungsschritte informiert? Materielle Bedingungen wiederum sind die Versorgung mit den Mitteln und Möglichkeiten, legitime Bedürfnisse zu befriedigen sowie die Gestaltung der äußeren Bedingungen nach Maßgabe des Möglichen. Das kann sich auch in Kleinigkeiten ausdrücken, am Beispiel eines Hinweises einer Krankenhausangestellten: „Ich möchte nicht im Krankenbett am Krankenhausareal herumgeschoben werden, in meinem Nachthemd, in meinem Bett … was man tagtäglich sieht.“
Auf diese Weise kann man mit den Hinweisen auf „Alltagsstruktur, „Durchbrechung und Unterbrechung des Alltags“, „Menschlichkeit“, „Gemeinschaftsordnung“ und „Selbstachtung“ mit besonderem Blick auf elementare Lebensvollzüge und die besondere Aufmerksamkeit auf die schwächsten Mitglieder eines Gemeinwesens Bausteine für das Projekt „Kleine Ethik im Krankenhausalltag“ anführen.