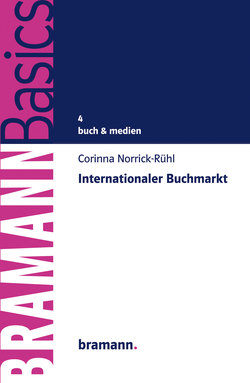Читать книгу Internationaler Buchmarkt - Corinna Norrick-Rühl - Страница 10
Оглавление| 1 | Buchmärkte in nationaler und internationaler Perspektive |
Praxisbeispiel
Jedes Jahr darf sich ein ›Ehrengast‹ der Welt auf der Frankfurter Buchmesse präsentieren. Meistens sind das Länder: daher spricht die Branche hier von den sogenannten Gastlandauftritten auf der Buchmesse. Doch zeigt ein Blick in die lange Gästeliste seit 1988, dass die Nation nicht immer das entscheidende Merkmal war, um die Präsentation mit Leben zu füllen. Mal war die ganze ›arabische Welt‹ zu Gast (2004), mal nur eine kleine, wenn auch wirtschaftsstarke Sprachregion: Katalonien (2007). Gleich zwei Mal, 1993 und 2016, standen Bücher, die auf Niederländisch oder Flämisch produziert worden waren, ganz gleich ob in den Niederlanden oder in Belgien, im Mittelpunkt des Interesses. Und 2017 wollte Francfort en français nicht nur die Literatur aus dem Nachbarland, sondern die frankophone Literatur weltweit vorstellen. Die anglophonen Länder sind hingegen auffällig unterrepräsentiert – nur Neuseeland (2012) findet sich auf der Liste der bisherigen Ehrengäste. 2020 wird sich Kanada zweisprachig mit englisch- und französischsprachiger Literatur vorstellen. Die Inszenierung der verschiedenen Nationen und Sprachräume durch die Länder selbst sowie durch die deutschen Verlage, die die übersetzten Bücher vermitteln, rückt zunehmend in den Blick der Forschung. Marco Thomas Bosshard untersucht Buchmessen als Räume kultureller und ökonomischer Verhandlung, mit einem besonderen Schwerpunkt auf den spanischsprachigen Buchmarkt und deren Wechselwirkung mit dem deutschen Buchmarkt.
Reflektion Kapitel 1: Ein Gedankenspiel zum besseren Verständnis der internationalen Beziehungen im Buchmarkt: Überlegen Sie, welches Buch aus einem anderen Sprachraum Sie zuletzt gelesen haben. Das kann auch ein Sachbuch oder wissenschaftliches Werk sein. Wenn Sie das Buch noch zur Hand haben, recherchieren Sie im Impressum den Ursprungsverlag, den Namen des Übersetzers, ggf. die Institution, die die Übersetzung finanziell gefördert hat. Online können Sie sich auch die Gestaltung der Originalausgabe anschauen. Sie werden sehen: es muss nicht nur der Text übersetzt werden, sondern auch die Paratexte müssen in eine andere Sprache und für einen anderen Markt überführt werden.
PARATEXTE Der französische Literaturwissenschaftler Gérard Genette (1930–2018) entwickelte die Idee der Schwellen (frz. seuils) zum Text in seiner Monografie Seuils (1987), die 1989 ins Deutsche übersetzt wurde. Der Übersetzer Dieter Hornig wählte für die Schwellen den treffenden Begriff Paratexte. Unter den Paratexten versteht Genette das ›Beiwerk des Buches‹ – alles, was dem eigentlichen Text zugeordnet ist. Das kann den Text direkt umgeben, also materiell und räumlich: das Cover, der Titel, das Vorwort, der Klappentext, das Impressum. Es können aber auch Texte sein, die nur indirekt mit dem Ursprungstext zusammenhängen, also zum Beispiel Rezensionen, Interviews, oder auch Tagebucheinträge des Autors. Genette unterscheidet verschiedene Kategorien, etwa verlegerische Para-texte und auktoriale Epitexte. Interessanterweise wurde das Buch erst 1997 ins Englische übersetzt (Paratexts. Thresholds of Interpretation, Cambridge UP).
Am Eingangsbeispiel wird klar: die Nation ist nur bedingt ein sinnvolles Ordnungskriterium für Buchmärkte. Auch historisch gewachsene Sprach- und Kulturgemeinschaften können hilfreiche Beschreibungsmerkmale sein. Wie eng Buchmarktstrukturen mit kulturhistorischen Fragen zusammenhängen, wird bei einem Blick nach Afrika deutlich. Kommunikationshistorisch spielt Oralität (also die mündliche Überlieferung von Informationen und Texten) in afrikanischen Gesellschaften eine viel größere und wichtigere Rolle als Schriftlichkeit. Auch heute sind der Austausch von Informationen und die Weitergabe von Traditionen eng mit Oralität verbunden. Da die Kolonialmächte das Lesen aus Europa mitgebracht und den Ureinwohnern aufgezwungen haben, ist bis heute das Verhältnis zu Büchern und Lesen problembehaftet. Isabel Hofmeyer plädiert in ihrem lesenswerten Aufsatz The Globe in the Text: Towards a Transnational History of the Book für eine kritische und ganzheitliche buchhistorische Betrachtung der Buchdistribution in den Kolonien am Beispiel der British and Foreign Bible Society, gegründet im 19. Jahrhundert. Hofmeyer betont darin, dass das Buch je nach Kontext als ›Geschenk‹ (oft von christlichen Missionaren) oder als ›Ware‹ in die Kolonien importiert und damit von Vornherein mindestens doppelt kodiert und politisch brisant war. Für viele Menschen in den ehemaligen Kolonien ist bis heute die Identifikation mit einer westlich geprägten Buch- und Lesekultur schwierig. Damit sind die Anforderungen an einen funktionstüchtigen Buchmarkt in Gesellschaften, in denen der Buchdruck und das Lesen als ›Mitbringsel‹ des Kolonialismus gesehen werden, anders als in Gesellschaften, in denen Schriftlichkeit und Buchdruck schon seit Jahrhunderten das Kommunikationssystem prägen.
Einen weiteren Zugang könnten wirtschaftliche beziehungsweise politische Gemeinschaften bieten, die buchpolitische und buchwirtschaftliche Maßnahmen gemeinsam veranlassen und durchsetzen. Ein Beispiel für eine buchpolitisch abgrenzbare Gemeinschaft wären die Staaten, die sich in der Berner Übereinkunft (Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works) von 1886 oder der Genfer Konvention (Universal Copyright Convention) von 1952 zusammengefunden haben, um Urheberrechtsfragen international anzuerkennen. Ferner werden auf EU-Ebene Fragen zur Buchpreisbindung, zu E-Books usw. verhandelt; somit könnte eine solche geografisch-politische Gemeinschaft auch eine weiterführende Perspektivierung bieten. Auch der Lizenzmarkt, der zwischen nationalen Rechten, Rechten für einen Sprachraum und globalen Rechten trennt, löst diese Frage von Fall zu Fall auf unterschiedliche Weise. So wurden im 20. Jahrhundert im Rahmen des Traditional Markets Agreement (TMA, 1947 bis 1976 in Kraft) im anglophonen Bereich, wie weiter unten ausgeführt wird, Rechte in drei Kategorien geteilt: das Vereinigte Königreich und die traditionellen Commonwealth-Mitglieder (je nach Vertrag mit oder ohne Kanada) bilden einen Lizenzraum; die USA und die Philippinen einen zweiten Lizenzraum und die restliche Welt einen offenen Markt.
Auch die Geschichtswissenschaft ist in Folge von Diskussionen transnationaler und postkolonialer Theorien gegenüber der Nation als Untersuchungseinheit kritisch(er) eingestellt. Denn politische Grenzen sind beweglich und zum Teil diskutabel. Nationale Besonderheiten wiegen in vielen Bereichen weniger schwer als die transnationalen Gemeinsamkeiten. Angewandt auf die Buchwissenschaft und book history ist hier zur weiteren Vertiefung Sydney Sheps Analyse und Modellvorschlag in Books in global perspectives empfehlenswert. Außerdem widmet sich James Raven in seiner neuen Einführung in die Buchwissenschaft What is the history of books? (2018) der zunehmend globalen Perspektive der Disziplin; er spricht gar von einem #global turn in der book history.
Global perspectives demand new approaches.
James Raven4
Dennoch: die bestehenden großen Projekte zur Buchhandelsgeschichtsschreibung sind national initiiert und angelegt. In Deutschland wird die Geschichtsschreibung des Buchhandels von der Historischen Kommission des Börsenverein des deutschen Buchhandels vorangetrieben. Die derzeit noch unvollständig vorliegenden Handbücher in der Reihe Geschichte des deutschen Buchhandels beginnen mit dem Kaiserreich und führen die buch- und verlagshistorisch interessierten Leser über die Weimarer Republik in das ›Dritte Reich‹, ins Exil, in die Jahre 1945 bis 1949 und danach parallel in die DDR und die BRD bis zur Wiedervereinigung. Hier gilt also klar das Prinzip der Nation als Beschreibungsmerkmal. Damit vergleichbar sind auch andere groß angelegte buchhistorische Projekte in Frankreich (Histoire de l’édition française, Fayard, 4-bändig, abgeschlossen), den USA (A History of the Book in America, University of North Carolina Press, entstanden in Zusammenarbeit mit der American Antiquarian Society, 5-bändig, abgeschlossen), Großbritannien (The Cambridge History of the Book in Britain, Cambridge University Press, bislang 7-bändig, seit 2019 abgeschlossen) oder Kanada (History of the Book in Canada, University of Toronto Press, 3-bändig, abgeschlossen).
Despite the permeability of political borders
nation is not irrelevant in the history of the book.
Leslie Howsam 5
Zur weiteren kritischen Einordnung solcher Publikationen können Leslie Howsams Gedanken zu ›Place‹ in ihrem Aufsatz Where Is the Book in History? hinzugezogen werden.
In diesem Band wird versucht, neben der Nation auch den Sprachraum als mögliches strukturierendes Kriterium anzuwenden. Das heißt, der Blick auf den deutschen Buchmarkt ist nicht akkurat, wenn nicht auch die Gegebenheiten in Österreich und der (deutschsprachigen) Schweiz berücksichtigt werden. Bei den anglophonen Buchmärkten wiegt dieses sprachliche Kriterium noch schwerer. Selbst wenn nur die größten anglophonen Buchproduzenten analysiert werden, können dennoch eine große Bandbreite und sehr unterschiedliche Marktgepflogenheiten zwischen den USA, Großbritannien, Kanada und Australien festgestellt werden. Und auch viele andere Buchmärkte produzieren erhebliche Mengen anglophonen Schrifttums – etwa Indien, Nigeria, Neuseeland usw. Kurzum: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile, weswegen ein Verständnis vieler nationaler Marktstrukturen noch keine Durchdringung der Struktur des internationalen Marktes ergibt.
In diesem Spannungsfeld zwischen nationalen Grenzen und international agierenden Akteuren ist auch die Frage zu diskutieren, ob von einem internationalen Buchmarkt oder von verschiedenen, wenn auch miteinander vernetzten, nationalen Buchmärkten die Rede sein soll, also von internationalen Buchmärkten. Die deutsche Branchenpresse (Börsenblatt, BuchMarkt, buchreport) variiert die Terminologie, wie es scheint, nach dem Zufallsprinzip. In englischsprachigen Fachzeitschriften ist in der Regel in der Einzahl von the international book industry oder the Anglophone book industry die Rede. In diesem Band wird in Anlehnung an die englischsprachige Variante einheitlich im Singular vom internationalen Buchmarkt gesprochen, um Abstand vom traditionellen nationalen Beschreibmodus (›der deutsche Buchmarkt im Vergleich mit dem französischen Buchmarkt‹ usw.) zu bekommen.
1.1 Ein Blick auf internationale Branchenorganisationen
Zu nennen ist hier zuallererst die # International Publishers Association (IPA), die seit 1896 als Dachverband verschiedener national sowie regional tätiger Verlegerverbände und anderer Spezialverbände fungiert. Derzeit (2019) finden sich 81 Organisationen aus 69 Ländern in Afrika, Asien, Australasien, Europa und Nord-, Mittel- und Südamerika in der IPA zusammen. Die IPA-Mitglieder versorgen gemeinsam mehr als 5,6 Milliarden Leser.
Obgleich diese Organisation viele Alleinstellungsmerkmale aufweist, ist die Forschungslage zur IPA als unzureichend einzustufen. Die IPA erfüllt drei Hauptaufgaben: die Verteidigung der Freiheit der Publikation, den Schutz des Copyrights sowie Leseförderung im weiteren Sinne. Sie arbeitet vielschichtig an diesen drei Hauptzielen. So wird im Hintergrund viel Lobbyarbeit geleistet, aber es werden auch öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen durchgeführt wie die Vergabe des Prix Voltaire, für besondere Bemühungen zur Förderung oder Verteidigung der Freiheit der Meinung und Publikation oder der Auszeichnung World Book Capital. Der IPA kommt damit eine wichtige Vermittlerrolle zu. Sie richtet auch in Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen alle zwei Jahre den International Publishers Congress aus, zuletzt im Februar 2018 in Indien. 2020 wird er in Norwegen stattfinden.
Für Deutschland ist der Börsenverein des deutschen Buchhandels Mitglied in der IPA; der Börsenverein ist zugleich Mitglied in der europäischen Verlegerorganisation Federation of European Publishers (FEP). Auch die Publishers Association of China (PAC) ist seit 2016 Mitglied in der IPA, was schon bei der Aufnahme für Überraschung und Protest sorgte, da die PAC der chinesischen Regierung nahesteht. Anfang 2018 spitzte sich die Kontroverse zu, als der IPA Prix Voltaire an den in China inhaftierten Verleger Gui Minhai verliehen wurde. Der Prix Voltaire – ursprünglich der Freedom to Publish Prize – wird seit 2005 jährlich von der IPA verliehen. In der Preisbegründung beruft sich die IPA auf Artikel 19 der Menschenrechtserklärung: »Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.« Das Preisgeld in Höhe von 10.000 Schweizer Franken wird zusammen mit einer Urkunde an eine Person vergeben, die sich trotz Gefahren für diese Rechte einsetzt. Auf der Website der IPA wird deutlich, dass überdurchschnittlich viele deutsche Firmen und Organisationen den Preis finanziell unterstützen: zu den Sponsoren gehören der Börsenverein des deutschen Buchhandels, die Verlagsgruppe Random House, Bonnier Media Deutschland und die Holtzbrinck Publishing Group.
Organigramm der Governance-Struktur der IPA
Why is the Chinese Publishers Association allowed to be part of the IPA? How is this defensible?
Angela Gui, Tochter von Gui Minhai6
Auf das Konfliktpotential bei der Zusammenarbeit mit Akteuren auf dem chinesischen Buchmarkt wiesen 2009 auch schon die schwierigen Diskussionen rund um den Gastlandauftritt Chinas auf der Frankfurter Buchmesse hin. Wie in Kapitel 2 noch zu sehen sein wird, ist China einer der größten und aktivsten Buchmärkte weltweit. Zudem sind chinesische Verlage aktuell die mit Abstand stärksten Lizenzabnehmer aus dem deutschen Raum – besonders im Bereich Kinder- und Jugendbuch werden jährlich hunderte Lizenzverträge mit chinesischen Abnehmern geschlossen. Dadurch ist es schwer, als Branchenteilnehmer an einer Zusammenarbeit mit chinesischen Verlagen und Organisationen vorbeizukommen. Es gibt aber de facto eine Zensur in China: Autoren und Verleger, die nicht politisch auf einer Linie mit der Regierung sind, werden bedroht und inhaftiert. Dieses Beispiel verdeutlicht eine Herausforderung im internationalen Buchmarkt: eine Zusammenarbeit findet trotz unterschiedlicher gesellschaftlicher, politischer und rechtlicher Rahmenbedingungen statt. So unterscheiden sich historisch wie politisch bedingt die Auffassungen von Zensur, Publikations- und Pressefreiheit bisweilen sehr.
Neben der IPA sind weitere Verbände und Organisationen global engagiert für die Akteure in der Buchbranche. Die Tatsache, dass im Börsenverein des deutschen Buchhandels sowohl Verleger als auch Buchhändler organisiert sind, ist im internationalen Vergleich als eher ungewöhnlich zu bezeichnen. Allerdings wird diese Doppelrolle im deutschsprachigen Raum gleichermaßen vom Hauptverband des Österreichischen Buchhandels (HVB) und vom Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verband (SBVV) erfüllt. Alle drei müssen bzw. können Konflikte zwischen Buchhändlern und Verlegern intern verhandeln. Das stärkt die Verhandlungsposition nach außen, da mehr Marktmacht und mehr individuelle Mitglieder in der Organisation zusammenfinden. Meistens jedoch gibt es global gesehen getrennte Buchhändler- und Verlegervereinigungen, etwa in Großbritannien mit der Publishers Association (PA) und der Booksellers Association of the UK and Ireland. Daher besteht auch ein europäischer Dachverband für Buchhändlerorganisationen, die in Brüssel ansässige European and International Booksellers Federation (EIBF). Auch hier ist für Deutschland der Börsenverein des deutschen Buchhandels Mitglied. Außerdem gibt es für den Antiquariatsbuchhandel die Gesellschaft International League of Antiquarian Booksellers (ILAB); hier ist für Deutschland der Verband Deutscher Antiquare e.V. (VDA) Mitglied.
| DIE WICHTIGSTEN BRANCHENORGANISATIONEN IM INTERNATIONALEN BUCHMARKT (STAND: OKTOBER 2019)* | ||||
| Internationaler Verband zum Schutz von Geistigem Eigentum | World Intellectual Property Organization | Agentur der Vereinten Nationen | Aktuell 192 Mitgliedsstaaten | www.wipo.int |
| Internationale Verlegerverbände | International Publishers Association (IPA) | Dachverband international | Aktuell 81 Organisationen aus 69 Ländern | https://www.internationalpublishers.org/ |
| Federation of European Publishers (FEP) | Dachverband für Europa | Aktuell 28 nationale Verlegerverbände | https://www.fepfee.eu/ | |
| International Alliance of Independent Publishers | Aktuell 750 Verlage | https://www.alliance-editeurs.org | ||
| Internationale Buchhändlerverbände | European and International Booksellers Federation (eibf) | Dachverband international (früher nur Europa) | Aktuell 27 nationale Buchhändlerverbände in Europa und 7 außerhalb von Europa | http://www.europeanbooksellers.eu/ |
| Independent Online Booksellers Association (IOBA) | Dachverband international (Schwerpunkt: USA) | www.ioba.org/ | ||
| International League of Antiquarian Booksellers (ILAB) | Dachverband international | Aktuell 22 Verbände antiquarischer Buchhändler in 37 Ländern | https://ilab.org/ |
*Die wichtigsten Branchenorganisationen im anglophonen Buchmarkt werden auf S. 61 vorgestellt
Neben den klassischen Branchenorganisationen gibt es viele andere international tätige Verbände und Gesellschaften, die die Buchhandelsakteure und -strukturen auf nationaler Ebene sozusagen spiegeln beziehungsweise einen Dachverband bilden.
Seit nahezu einhundert Jahren geben unsere Mitglieder auf der ganzen Welt denjenigen eine Stimme, die zum Schweigen gebracht wurden.
Jennifer Clement, Präsidentin des PEN International7
PEN wurde 1921 in London gegründet. ›PEN‹ heißt auf Englisch Stift oder Kugelschreiber – wurde aber gleichzeitig als Akronym für Poets, Essayists, Novelists (Dichter, Essayisten, Romanautoren) konzipiert. PEN war die erste internationale Vereinigung von Schriftstellern; heute gehören 140 nationale PEN-Zentren zu der internationalen Vereinigung. Diese ist insofern exklusiver als ein regulärer Berufsverband, weil Neumitglieder nur durch einen schriftlichen Antrag zweier bestehender Mitglieder (Bürgen) und durch Bestätigung der jährlich ausgerichteten Vollversammlung aufgenommen werden können. Damit soll gewährleistet werden, dass wirklich nur Menschen mit solider schriftstellerischer Qualifikation in die Reihen von PEN eintreten können.
Das zentrale Dokument von PEN International und allen PEN-Zentren ist die PEN-Charta, die zwischen 1926 und 1948 erstellt, überarbeitet und 1948 in Kopenhagen ratifiziert wurde. Die wichtigste Leitidee darin lautet, dass Literatur keine Ländergrenzen kennt und »auch in Zeiten innenpolitischer oder internationaler Erschütterungen eine allen Menschen gemeinsame Währung bleiben [muss]. Unter allen Umständen, und insbesondere auch im Krieg, sollen Werke der Kunst, der Erbbesitz der gesamten Menschheit, von nationalen und politischen Leidenschaften unangetastet bleiben.«
Im PEN International sind namhafte Autoren über ihren Landesverband vertreten; das European Writers’ Council (EWC, vor 2010 European Writers’ Congress; für Deutschland: der Verband deutscher Schriftsteller, VS, der Gewerkschaft ver.di) vertritt Menschen, die mit Schreiben ihren Unterhalt (zumindest teilweise) bestreiten. Auf europäischer wie auf weltweiter Ebene gibt es zahlreiche andere Verbände und Organisationen, die Akteure oder Institutionen im internationalen Buchmarkt repräsentieren. So vereint etwa das European Literacy Policy Network (ELINET) die Leseförderungsinstitutionen (für Deutschland: Stiftung Lesen) und das International Board on Books for Young People (IBBY; für Deutschland: Arbeitskreis für Jugendliteratur e.V.) die Kinder- und Jugendbuchinstitutionen. Als weiteres Beispiel: Für den Bereich des wissenschaftlichen Publizierens ist STM. The Global Voice of Scholarly Publishing der einschlägige Fachverband (für Deutschland als korrespondierendes Mitglied: Börsenverein des deutschen Buchhandels), zudem vertritt die international tätige Association of University Presses (AUP) über 140 Mitglieder weltweit, allerdings keine deutschen Mitglieder, da Universitätsverlage keine große Tradition in Deutschland haben (die Mainz University Press der Johannes Gutenberg-Universität Mainz zum Beispiel wurde in Zusammenarbeit mit Vandenhoeck & Ruprecht und dem Imprint V&R unipress erst 2014 gegründet). In der Association of Learned and Professional Society Publishers (ALPSP) hingegen sind aus Deutschland sowohl die Verlage de Gruyter (Berlin) und Springer Nature (Berlin) Mitglied wie auch der Göttinger Universitätsverlag der Georg-August-Universität Göttingen (2003 gegründet).
Auch die Kulturinstitution der Vereinten Nationen, die UNESCO, spielt auf dem internationalen Buchmarkt eine wichtige Rolle als Vermittler. Die UNESCO (Auflösung des Akronyms auf Englisch: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; Übersetzung des Akronyms auf Deutsch: Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur) ist eine selbstständige Sonderorganisation der Vereinten Nationen mit Sitz in Paris. Gegründet wurde sie vertraglich im Jahr 1945; ratifiziert wurde der Vertrag Ende 1946. Seitdem ist die UNESCO innerhalb der UN für die Förderung von Bildung, Wissenschaft, Kultur, Erziehung sowie für Kommunikation und Information zuständig. Aus historischer Sicht hat Christina Lembrecht die Rolle der UNESCO als Buch- und Buchmarktförderer eindrücklich analysiert. In ihrer Dissertation wird klar, dass dem Buch wichtige Aufgaben und große Potenziale zugesprochen werden. Das Buch (und die Bibliothek) werden seit Mitte des 20. Jahrhunderts als zentrale Bestandteile weltweiter Bildungsbemühungen verstanden. Ihnen wird als Instrument zur Vermittlung zwischen Kulturen eine wichtige Rolle zugesprochen – umgekehrt wird die Zerstörung von Büchern und Bibliotheken deswegen als politischer und kulturvernichtender Akt weltweit geächtet (Rebecca Knuth spricht dabei von ›libricide‹). Die Bedeutung von Büchern als Kulturvermittler wird nicht zuletzt auch an der Durchführung und dem Engagement der Ehrengäste bei der Frankfurter Buchmesse deutlich – um eine Brücke zum Eingangsbeispiel zu finden.
1.2 Die wichtigsten internationalen Buchmessen
In diesem Kapitel ist schon mehrfach die Frankfurter Buchmesse erwähnt worden. Bei der Beschreibung internationaler Branchenstrukturen müssen jedoch auch andere relevante Buchmessen Erwähnung finden.
Business development and communication happens increasingly online. However, it is still important for publishers to meet their counterparts in person, create a real contact and have the opportunity to handle paper books. Book fairs are still a place for discovering and networking.
Karine Vachon, IPA World Book Fair Report 20168
Auch in Zeiten schnelllebiger und unkomplizierter Kommunikation über E-Mail, Skype usw. sind Messen ein wichtiger Ankerpunkt des internationalen Handels – nicht nur des Buchhandels. 2016 hat die IPA in einem Bericht die Lage der internationalen Buchmessen beschrieben und eine Liste der wichtigsten Buchmessen veröffentlicht. Dazu wurden Branchenteilnehmer weltweit befragt, welche Buchmessen für sie wichtig sind und welche regelmäßig besucht werden. Der IPA Global Book Fair Report 2017 geht zudem ergänzend auf einige der neueren Buchmessen mit kurzen Artikeln ein und soll deswegen an dieser Stelle Erwähnung finden.
Als ein Zeichen für die Bedeutung von Buchmessen im digitalen Zeitalter, aber auch für die Herausforderungen, denen sie gegenüberstehen, kann die Gründung des Aldus European Bookfairs Network gedeutet werden. Von 2016 bis 2019 wird das Aldus Network von der EU im Rahmen des Programms Creative Europe gefördert. Koordiniert wird das Netzwerk in Italien unter der Ägide der Italienischen Verlegerorganisation Assoziazione Italiana Editori (AIE). Das Aldus Network hat 2018 eine übersichtliche Broschüre mit allen wichtigen Daten der 16 Mitgliedsmessen in 13 europäischen Ländern publiziert, das einen Vergleich der Messen vereinfacht.
Die internationale Abteilung der Frankfurter Buchmesse organisiert deutsche Gemeinschaftsstände auf Messen weltweit und unterhält zudem Büros als Informations- und Servicezentren (in Moskau, Neu Delhi, New York und Peking). Auf folgenden Buchmessen sind deutsche Gemeinschaftsstände vertreten – diese Kategorisierung folgt der Frankfurter Buchmesse. Als die ›wichtigsten‹ Buchmessen aus deutscher Sicht mit Blick auf Zielmärkte werden London, Bologna, Abu Dhabi, Warschau, Peking und Guadalajara eingestuft; danach folgen die ›Klassiker‹ unter den Buchmessen in Kairo, Taipeh, Havanna, Paris, Teheran, Istanbul und Moskau. Außerdem tritt der Gemeinschaftsstand auf bei den ›seltenen‹ Messen (Vilnius, Bogotá, Kiew und Jakarta) und den ›neuen‹ in Tiflis, Montréal und Sofia.
2015 wurden laut IPA World Book Fair Report 2016 die folgenden Buchmessen am häufigsten von Branchenteilnehmern besucht
1. Frankfurter Buchmesse, jährlich im Oktober
2. London Book Fair, jährlich im April
3. Bologna Children’s Book Fair, jährlich im April
4. Guadalajara International Book Fair, jährlich im November
5. Salon livre Paris, jährlich im März
6. BookExpo America, jährlich im Mai/Juni an wechselnden Standorten in den USA
7. Beijing International Book Fair, jährlich im August
8. Göteborg Book Fair, jährlich im September
Auf Platz 9 und 10 entfielen jeweils mehrere Buchmessen:
9. Moscow International Book Fair (jährlich im September) Seoul International Book Fair (jährlich im Juni) Taipei International Book Exhibition (jährlich im Februar)
10. New Delhi World Book Fair (jährlich im Januar) Istanbul Book Fair (jährlich im November)
Aus dieser Fülle an internationalen Veranstaltungen ragt die Frankfurter Buchmesse seit vielen Jahrzehnten als die größte internationale Buchmesse heraus. Sie gilt unangefochten als wichtigster Dreh- und Angelpunkt für Lizenzen und bietet zudem seit der langjährigen Leitung des Messedirektors Peter Weidhaas (1975 bis 2000) eine gelungene Mischung aus B2C, also Publikumsveranstaltungen (u.a. mit dem Gastlandauftritt) und B2B, also Fachveranstaltungen, Workshops usw. Seit 2009 begleitet das Kulturamt der Stadt Frankfurt die dortige Buchmesse mit einem Lesefestival unter dem Titel Open Books (www.openbooks-frankfurt.de) – sicherlich auch inspiriert von dem älteren Festival Leipzig liest (http://www.leipziger-buchmesse.de/ll), das parallel zur Leipziger Buchmesse stattfindet, dort aber auch von der Messe getragen wird.
Zudem bietet sich bei der Frankfurter Buchmesse der regelmäßige Termin im Herbst (meistens Anfang Oktober) für viele Verlage als Kommunikationsplattform für die Markteinführung neuer Produkte (sogenannte Produktlaunches) und als ideales Erscheinungsdatum für Spitzentitel an, da die Neuerscheinungen dann pünktlich zum Weihnachtsgeschäft im Handel und auf der Bestsellerliste angekommen sind.
Verwendete und weiterführende Literatur
Bosshard, Marco Th.: Buchmarkt, Buchindustrie und Buchmessen in Deutschland, Spanien und Lateinamerika. Berlin/Münster: LIT 2015.
Howsam, Leslie: Old Books and New Histories. An Orientation to Studies in Book History and Print Culture (Studies in Book and Print Culture). Toronto: University of Toronto Press 2006.
Lembrecht, Christina: Bücher für alle: die UNESCO und die weltweite Förderung des Buches 1946– 1982. Berlin [u.a.]: De Gruyter 2013.
Raven, James: What is the history of the book? (What is History?). Cambridge/Medford, MA: Polity Press 2018.
Shep, Sydney: Book. In: Literature Now. Key Terms and Methods for Literary History. Hrsg. von Sashca Bru, Ben De Bruyn und Michel Delville. Edinburgh: Edinburgh UP 2016, S. 36–45.
Shep, Sydney: Books in global perspectives. In: Cambridge Companion to the History of the Book (Cambridge Companions to Literature). Hrsg. von Leslie Howsam. Cambridge: Cambridge University Press 2015, S. 53–70.
Weidhaas, Peter: Zur Geschichte der Frankfurter Buchmesse (st 3538). Frankfurt: Suhrkamp 2004.
Linkhinweise
Aldus European Bookfairs Network. URL: www.aldusnet.eu [01.10.2019].
Aldus European Bookfairs Network: European Book Fairs. Facts and Figures 2018. URL: http://www.aldusnet.eu/wp-content/uploads/2018/12/ALDUS_European_Bookfairs_Facts_Figures_2018.pdf [01.10.2019] .
Arbeitskreis für Jugendliteratur e.V. URL: www.jugendliteratur.org [01.10.2019].
Association of Learned & Professional Society Publishers. URL: https://www.alpsp.org/ [01.10.2019].
Association of University Presses. URL: www.aupresses.org/ [01.10.2019].
Bologna Children’s Book Fair. URL: www.bookfair.bolognafiere.it/home/878.html [01.10.2019].
Booksellers Association in the UK & Ireland. URL: booksellers.org.uk [01.10.2019].
European and International Booksellers Federation.
URL: www.europeanbooksellers.eu [01.10.2019].
European Literacy Policy Network. URL: www.eli-net.eu [01.10.2019].
Federation of European Publishers. URL: www.fep-fee.eu [01.10.2019].
Frankfurter Buchmesse International. URL: www.buchmesse.de/de/internationalbusiness [01.10.2019].
Hauptverband des Österreichischen Buchhandels. URL: www.buecher.at [01.10.2019].
Index Translationum. URL: http://www.unesco.org/xtrans/ [01.10.2019].
International Board on Books for Young People. URL: www.ibby.org [01.10.2019].
International League of Antiquarian Booksellers. URL: https://www.ilab.org/ [01.10.2019].
International Publishers Association. URL: www.internationalpublishers.org [01.10.2019].
IPA Global Book Fair Report 2017. URL: https://www.internationalpublishers.org/images/industry-news/2017/IPA_Global_Book_Fair_Report_2017.pdf [01.10.2019].
London Book Fair. URL: www.londonbookfair.co.uk [01.10.2019].
STM. URL: https://www.stm-assoc.org/ [01.10.2019].
Verband deutscher Antiquare e.V. URL: www.antiquare.de [01.10.2019].
Aufgaben zu Kapitel 1
1. Inwiefern kann die Nation eine sinnvolle Grundlage für buchbezogene wissenschaftliche Fragestellungen sein?
2. Bei welchen internationalen Organisationen ist der Börsenverein des deutschen Buchhandels Mitglied?
3. Welche sind neben der Frankfurter Buchmesse die wichtigsten Buchmessen weltweit?