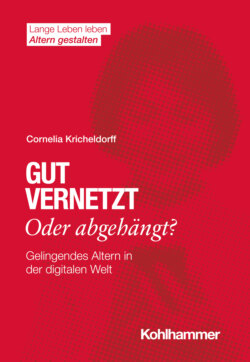Читать книгу Gut vernetzt oder abgehängt? - Cornelia Kricheldorff - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.3 Demografischer Wandel und soziale Veränderungen – Rahmenbedingungen für das Altern in der digitalen Welt
ОглавлениеDie Lebensrealität älterer und alter Menschen in Deutschland wird kontinuierlich und mit zunehmender Geschwindigkeit durch die Auswirkungen des demografischen Wandels bestimmt, der mit dem in der deutschen Gerontologie schon lange gebräuchlichen Begriff des sog. dreifachen Alterns der Bevölkerung sehr anschaulich beschrieben wird (Tews, 1999, S. 138). Skizziert wird damit eine Entwicklung, gekennzeichnet erstens von einem kontinuierlichen Anstieg des Durchschnittsalters, zweitens von der zahlenmäßig deutlichen Zunahme älterer und alter Menschen und drittens von den sich daraus ergebenden Verschiebungen im zahlenmäßigen Verhältnis zwischen Jung und Alt (vgl. Kricheldorff, 2020b).
So wuchs beispielsweise die Anzahl der Personen im Alter ab 70 Jahren in Deutschland zwischen den Jahren 1990 und 2018, von rund 8 auf 13 Millionen. Die Zahl der Menschen im Erwerbsalter zwischen 20 und 66 Jahren wird voraussichtlich in den nächsten zwei Jahrzehnten abnehmen. Und die Alterung der Bevölkerung in Deutschland wird sich trotz hoher Zuwanderung und höherer Geburtenrate weiter verstärken (Destatis, 2020b, S. 2 f.).
Das Altern von Frauen und Männern in unserer Gesellschaft ist noch immer deutlich geprägt von typischen genderspezifischen Ausprägungen und Bedingungen. Diese haben für die Gestaltungsoptionen unseres Lebens eine nicht zu unterschätzende Relevanz, was von den Betroffenen so auch erlebt und bewertet wird. Auch in der Frage der digitalen Beteiligung gibt es einen deutlichen Gender-Gap. Die im Januar 2020 veröffentlichte Studie »Digital Gender Gap« weist deutlich nach, dass Frauen generell einen geringeren Digital-Index als Männer erreichen. Auf der Skala von 0 bis 100 Punkten liegen Frauen bei einem durchschnittlichen Digitalisierungswert von 51 und Männer bei 61 Indexpunkten. Diese Lücke wird mit zunehmendem Alter und abhängig vom beruflichen Status noch deutlich größer (Kompetenzz/Initiative D21 e. V., 2020).
Aus den aktuellen Prognosen des Statistischen Bundesamtes wird deutlich, dass mittlerweile – und das ist ein neuer Trend – nicht nur Frauen, sondern auch immer mehr Männer ein höheres Lebensalter erreichen können. Bei den vor ca. 100 Jahren geborenen Menschen gab es hier noch deutliche Unterschiede (so wurden bspw. etwa 54 % der Männer und 65 % der Frauen des Jahrgangs 1917 mindestens 65 Jahre alt). Von den 2017 Geborenen könnten dagegen bis zu 95 % der Jungen und 97 % der Mädchen dieses Alter erreichen (Destatis, 2020b, S. 10).
Das bislang zahlenmäßig sehr deutliche Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern, vor allem im höheren Lebensalter, wurde in der Gerontologie lange als Feminisierung des Alters beschrieben (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung, 2020), verbunden mit dem bekannten Leitsatz »Das Alter ist weiblich«. Heute gilt das auf jeden Fall noch für das sehr hohe Alter, aber es bleibt offen, wie sich das künftig für die Generation der »Babyboomer«, also für die geburtenstarken Jahrgänge der frühen 1960er Jahre, entwickeln wird. Einen maßgeblichen Einfluss darauf wird das Gesundheits- und Präventionsverhalten über den gesamten Lebenslauf hinweg haben. In der Gesundheitsberichterstattung des Robert-Koch-Instituts wird dazu festgestellt: »Frauen und Männer unterscheiden sich sowohl in Bezug auf Gesundheit und Krankheit als auch in ihrem Gesundheitsverhalten deutlich.« (RKI, 2015, S. 141) Hier ist deutlich anzumerken, dass vor allem im Kontext der Inanspruchnahme von gesundheitlichen Vorsorgemaßnahmen digitale Anwendungen, wie die digitale Patientenakte, unter Umständen relevante Veränderungen bewirken könnten.
Aktuell wird die durchschnittliche Lebenserwartung für neugeborene Mädchen mit 83,4 Jahren und für neugeborene Jungen mit 78,6 Jahre angegeben. Und gegenwärtig machen Frauen im Alter von über 80 Jahren rund 66 % der gesamten Altersgruppe aus, im Alter von über 90 Jahren sind es nahezu 75 % (Destatis, 2020d).
Nicht nur in Bezug auf die Lebenserwartung gibt es Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Frauen sind im Alter materiell auch deutlich schlechter gestellt als Männer. So weist beispielsweise eine Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD, 2019) nach, dass deutsche Frauen mit 46 % heute von der OECD-weit größten Geschlechter-Rentenlücke betroffen sind. Da das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen über dem OECD-Durchschnitt liegt und viele Frauen in Deutschland Teilzeit arbeiten, dürften ihre zukünftige Rentenansprüche im Vergleich zu Männern auch niedrig bleiben. Der weibliche Anteil bei den rund 510.000 älteren Menschen in Deutschland, die im Jahr 2017 Grundsicherung im Alter bezogen, liegt mit 59 % deutlich über dem der Männer, auch wenn sich die Anteile hier allmählich angleichen: Im Jahr 2003 waren Frauen mit 71 % noch deutlich überproportional als Bezieherinnen von Grundrente ausgewiesen (Loose & Kaltenborn, 2018, S. 8).
Ein deutlicher Unterschied ergibt sich ebenfalls hinsichtlich der Lebensform im Alter, weil deutlich mehr Frauen als Männer in der nachberuflichen Phase allein leben ( Abb. 1.6).
Abb. 1.6: Alleinlebende Personen in Deutschland nach Altersgruppen und Geschlecht im Jahr 2017 (eigene Grafik auf Basis von Daten aus Destatis, 2020e)
Steigende Scheidungszahlen bei Langzeitehen und Tod des Partners haben auf die wachsende Zahl von Einpersonenhaushalten im Alter einen deutlichen Einfluss. Auch die Anzahl derer, die immer schon in Singlehaushalten gelebt haben, nimmt kontinuierlich zu.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich die Bedingungen für das Leben im Alter zwischen Männern und Frauen zwar in Teilbereichen allmählich annähern, aber in absehbarer Zukunft in wichtigen Bereichen nach wie vor von großen Unterschieden geprägt sein werden. Frauen werden zwar im Durchschnitt älter, sie sind bei einem zunehmenden Hilfe- und Pflegebedarf im höheren Alter jedoch deutlich häufiger auf sich selbst gestellt und auf Unterstützungsressourcen außerhalb des eigenen Haushalts angewiesen. Denn ihr Anteil an den Singlehaushalten verändert sich nach dem 65. Lebensjahr auffällig und ist ca. 2,5mal so hoch wie der der Männer. Sie sind materiell deutlich schlechter abgesichert, was einen negativen Einfluss auf soziale Teilhabe und Partizipation und damit auf das subjektive Gesundheitserleben und auf ihre Lebensqualität hat.
Auch der Zusammenhang zwischen sozialer Benachteiligung und Multimorbidität, also von mehreren chronischen Erkrankungen zur gleichen Zeit, ist hinlänglich bekannt und wird wie folgt beschrieben: Die Wahrscheinlichkeit des Auftretens und die Komplexität von Mehrfacherkrankungen steigen mit dem Alter und treffen sozial benachteiligte ältere Menschen stärker.« (Kuhlmey, 2009, S. 294)
Die Vernetzung mit dem sozialen Umfeld – digital und analog – hat für Frauen eine ungleich höhere Relevanz, weil sie viel stärker als Männer von der zunehmenden Singularisierung betroffen sind. Sie werden zwar durchschnittlich älter, aber sind damit von Multimorbidität viel stärker betroffen. Gleichzeitig sind ihre genderspezifischen Voraussetzungen und Ressourcen deutlich schlechter, vor allem auch in Bezug auf die Möglichkeiten und Zugänge zur digitalen Welt und die dafür notwendigen Kompetenzen.
Nach den aktuellen Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung des Statistischen Bundesamtes werden im Jahr 2040 insgesamt 82,1 Millionen Menschen in Deutschland leben, 21,4 Millionen werden dann älter als 67 Jahre und damit im gesetzlich definierten Rentenalter sein. Ihre Zahl stieg zwischen 1990 und 2018 bereits um 54 % von 10,4 Millionen auf 15,9 Millionen an. In den nächsten 20 Jahren wird diese Zahl um weitere 5 bis 6 Millionen auf mindestens 20,9 Millionen wachsen. Die künftige Entwicklung ist für diese Altersgruppe im Wesentlichen durch den aktuellen Altersaufbau vorherbestimmt. Der Einfluss von Geburten und Migration spielt hierfür nur eine geringe Rolle. Und in 30 Jahren wird dann voraussichtlich etwa jede zehnte Person mindestens 80 Jahre alt sein. (Destatis, 2020b, S. 11)
Der vorübergehende Trend einer gewissen Verjüngung der Bevölkerung durch die in den vergangenen Jahren vermehrte Zuwanderung vor allem jüngerer Menschen, die aus ihren Heimatländern nach Deutschland geflüchtet sind, ist in diesen Prognosen schon berücksichtigt.
Mit Blick in die Zukunft wird dies zu einem tiefgreifenden und nahezu alle Lebensbereiche betreffenden strukturellen Wandel führen, der sich teilweise schon heute deutlich abzeichnet (vgl. Aner, 2020) und familiäre Systeme und Netzwerke ganz besonders betrifft. Die Frage, wie Unterstützung, Versorgung und Pflege alter Menschen auch weiter in guter Art und Weise gewährleistet werden können, trifft das in ganz besonderem Maße, denn parallel dazu ändern sich auch die Familien- und Verwandtschaftsstrukturen.
Während heute etwa 10 % der 60-jährigen Frauen kinderlos sind, wird dies in 20 Jahren auf ein Viertel und in 30 Jahren auf ein Drittel von ihnen zutreffen. Steigende Zahlen bei Ehescheidungen sowie die wachsende Mobilität – oft als Tribut an die sich verändernde Arbeitswelt – zeigen ebenfalls deutliche Auswirkungen und führen in der Konsequenz zu brüchiger werdenden innerfamiliären Ressourcen und Möglichkeiten der sozialen Unterstützung im Alltag (vgl. Kricheldorff, 2019, 2015).
Auch in familiären Konstellationen, in denen die Bereitschaft zur Übernahme von Versorgungsleistungen durchaus vorhanden, die Lebensrealität jedoch von räumlicher Distanz geprägt ist, stehen Angehörige immer häufiger vor der schwierigen Herausforderung, Pflege und Sorge auf Distanz leisten zu müssen (Engler, 2020, S. 81 ff.).
Zusammenfassend gilt, dass sich durch die Veränderungen in den Familienbeziehungen auch die sozialen Bindekräfte verändern, die deshalb modifiziert oder substituiert werden müssen. Dort, wo traditionelle Beziehungen nicht oder nicht mehr vorhanden sind, werden neue Modelle und strukturelle Voraussetzungen gebraucht, die eine Einbindung ins soziale Umfeld ermöglichen oder Distanzen überwinden können. Es stellen sich also neue Fragen in Bezug auf aktuelle Formen gelingenden Alterns. Der Einfluss und die Bedeutung digitaler Medien und Technologien ist dabei unübersehbar.
In Verbindung mit neuen Ansätzen im Bereich der gemeindeorientierten Pflege (Community Care) werden soziale Beziehungen im Alter verstärkt in Verbindung mit digitalen Medien und technischen Assistenzsystemen diskutiert. Informations- und Kommunikationstechnologien, die das Leben im digitalen Zeitalter generell bestimmen, werden zunehmend zu relevanten Einflussgrößen im Alltag älterer Menschen. Denn auch wenn die Rolle von Technologien nicht überbewertet werden darf, ergeben sich durch die fortschreitende Digitalisierung doch klare Erwartungen und neue Möglichkeiten der positiven Gestaltung und Entfaltung des höheren Lebensalters sowie der Förderung von Autonomie und Selbstbestimmung, auch bei einem objektiv feststellbaren Verlust an Selbständigkeit und entsprechender Alltagskompetenzen (vgl. BMG, 2013).
Dabei muss immer berücksichtigt werden, dass Altern in einer digitalisierten Welt auch unmittelbare menschliche Begegnungen und Bezüge braucht, denn das subjektive Erleben von Lebensqualität und -zufriedenheit ist immer auch verbunden mit sozialer Interaktion und direkter Kommunikation (Kricheldorff & Tonello, 2020; Scholl, 2010). Diese zentralen Prozesse vollziehen sich in der Logik sorgender Gemeinschaften (Caring Communities) vor allem in lebendigen Nachbarschaften, in Sozialraum und Wohnquartier (vgl. Deutscher Bundestag, 2016).
Damit dies gelingen kann, muss zur Sicherung der häuslichen Pflegesettings zusätzlich eine Vernetzung mit dem sozialen Nahraum erfolgen, um die unmittelbare und tägliche Unterstützung und Pflege pflegebedürftiger Menschen vor Ort verlässlich abzusichern. Alle bisher bekannten Modelle von Distance Care (Pflege auf Distanz) setzen, neben dem Einsatz von Technik und digitalen Assistenzmodellen (Franke, Kramer & Jann, 2019), vor allem auf die Unterstützung häuslicher Pflegesettings durch ambulante Dienste und soziale Netzwerke. Pflege auf Distanz braucht also digitale Plattformen und Medien in Verbindung mit personengetragenen Netzwerken vor Ort.
Für eine angemessene Beantwortung der diversen Bedürfnisse des alten Menschen wird also immer stärker der Einsatz technischer Assistenzsysteme oder einzelner Technologien im Wohnumfeld als mögliche Option ins Spiel gebracht. Dabei bildet einerseits das Streben nach Selbstbestimmung und Autonomie, andererseits nach Bindung und Schutz einen an Werthaltungen orientierenden Rahmen (Wahl, Kricheldorff & Hedtke-Becker, 2018, S. 1). Die Zielperspektive bei der Entwicklung und beim Einsatz technischer Produkte und Systeme ist also geprägt vom Selbstverständnis der Autonomieförderung, bei wachsendem Bedarf an Hilfe- und Unterstützung im Alter, um einen langen Verbleib im gewohnten Umfeld auch dort zu ermöglichen, wo familiäre Unterstützung nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung steht (vgl. Kricheldorff, 2019).