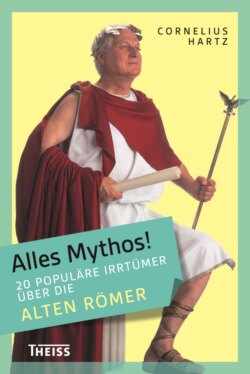Читать книгу Alles Mythos! 20 populäre Irrtümer über die alten Römer - Cornelius Hartz - Страница 9
|25|IRRTUM 3: Texte wurden stets in Stein genauen
ОглавлениеMan kennt das aus den „Asterix”-Comics: eine römische Schreibstube, in der mehrere Leute damit beschäftigt sind, lange Texte in große Tafeln aus grün glänzendem Marmor zu hauen. Einen Postboten, der sich unter der Last mehrerer solcher Steinplatten abmüht, weil er die „Zeitung” ausliefert. Werbebroschüren, die im Circus verteilt werden – natürlich ebenfalls in Marmor gemeißelt.
Wie so oft ist hierin ein Fünkchen Wahrheit, denn die meisten Texte, die heute noch als direktes schriftliches Zeugnis und nicht als bloße Abschrift aus der römischen Antike erhalten sind, sind tatsächlich in Stein gemeißelt worden: Inschriften, wie wir sie vor allem auf Grabsteinen und an Gebäuden finden, die bis heute überlebt haben. Ein seltenes Beispiel für einen längeren literarischen Text als Inschrift ist der „Tatenbericht” von Kaiser Augustus, der ursprünglich im Mausoleum des Augustus in Rom aufgestellt war. Jene Version ist verloren, die uns bekannte Fassung – das sogenannte Monumentum Ancyranum – stammt aus einem Tempel im heutigen Ankara in der Türkei. Ansonsten waren es kurze, prägnante Texte wie Weihinschriften oder eben Grabsprüche, die man in Stein haute. Entsprechend gab es eine ganze Reihe Abkürzungen, mit denen man Platz, Mühen und damit auch Kosten sparte: |26|IMP bedeutete imperator, COS consul, F hieß filius („Sohn”) oder filia („Tochter”).
Es ging bei einer Inschrift aber auch noch hochwertiger, als dass man bloß Buchstaben in Marmor meißelte: so zum Beispiel beim Pantheon in Rom, das von Augustus’ Weggefährten Agrippa erbaut wurde. Durch einen Brand im Jahr 80 n. Chr. wurde das Pantheon stark beschädigt, und ab 118 baute es Kaiser Hadrian wieder auf. Erst der architekturbegeisterte Hadrian gab dem Gebäude seine heutige markante Form. Die riesige Inschrift über seinem Eingang bezieht sich dennoch auf den ursprünglichen Erbauer des Tempels. Man fand jedoch, dass eine einfache eingemeißelte Schrift für einen so wichtigen Tempel, der allen römischen Göttern galt, nicht angemessen genug war. So entschied sich der Kaiser für Buchstaben aus Bronze, was die Inschrift besser lesbar und in jeder Hinsicht hochwertiger machte – ein Gestaltungsmerkmal, das später vielfach kopiert wurde.
Die Grabinschriften sind eine wichtige Quelle für Historiker, denn sie verraten oft viele Details zu den Lebensumständen der Bestatteten – wie alt sie wurden, woher sie stammten, welchem Beruf sie nachgingen, wer ihr Grabmal bezahlte; so hat man beispielsweise zum Leben von römischen Soldaten oder Gladiatoren wertvolle Erkenntnisse gewonnen. Aus den Grabsprüchen entstand sogar eine ganz eigene literarische Gattung: das Epigramm, ein kurzes Gedicht im elegischen Versmaß, wie man es ursprünglich auf griechischen Grabsteinen fand. Die Kürze war dabei wiederum dem mangelnden Platz zu schulden. Manche literarische Epigramme ahmten sogar direkt einen Grabspruch nach, wie dieses von Kallimachos, bei dem der Grabstein sozusagen den Vorübergehenden anredet (AP 7.318): „Frag nicht: Wie geht’s?, oh böser Mensch, sondern geh vorüber;/gut geht’s mir dann, wenn du mir nicht zu nahe kommst.”
Grabmale und Gebäudeinschriften waren buchstäblich für die Ewigkeit gedacht. Wenn die Römer etwas aufschreiben wollten, das nicht so lange Bestand haben musste, gab es andere Mittel und Wege |27|als teure, schwere Marmortafeln. Die Werke der römischen Literaten beispielsweise, wie man sie in einer der zahlreichen Buchhandlungen am Forum Romanum kaufen konnte, waren auf Papyrus geschrieben. Neben literarischen Texten schrieben die Römer auch offizielle Urkunden, Handelsregister und Briefe auf Papyrus. Papyrus, den man aus den Fasern des Cyperus papyrus herstellte, wurde zumeist aus Ägypten importiert, wo die bis zu 4 m hohen Pflanzen im Nildelta im Überfluss wuchsen. Hier, im Land der Pharaonen, verwendete man Papyrus bereits seit dem 3. Jahrtausend v. Chr. als Schreibmedium.
Nahe dem Ort Herculaneum, der wie Pompeji 79 n. Chr. beim Vesuvausbruch verschüttet wurde, entdeckte der Schweizer Archäologe Karl Weber im Jahr 1750 die „Villa dei Papiri”, die in einem nur 9 m2 großen Raum eine erstaunliche Bibliothek mit über 1800 verkohlten Papyrusrollen beherbergte. Darunter befanden sich bislang unbekannte Texte von Phaedrus, Statius, Ennius, Polystrat, Philodemos und vielen anderen mehr. Seit 1910 untersucht man die Papyri aus Herculaneum in der Universität von Neapel, und inzwischen hat man Mittel und Wege gefunden, die stark mitgenommenen und beinahe mumifizierten Rollen, die aussehen wie Kohlestücke, mittels Computertomografie so zu untersuchen, dass sie nicht sofort zu Staub zerfallen, wenn man versucht, sie zu entrollen und ihren Inhalt zu entziffern. Die Rollen bergen zahlreiche griechische und römische Texte, die nur auf diesen Papyri erhalten sind. Im Archiv der Universität befinden sich jedoch noch so viele Exemplare, dass es sicherlich Jahrzehnte dauern wird, bis man hier einen kompletten Überblick hat. Trotz seiner Verbreitung war Papyrus ein teurer Rohstoff, der aufwendig aus Pflanzenfasern geschöpft werden musste. In der Spätantike wurde der Papyrus durch das haltbarere Pergament abgelöst, das man aus Tierhäuten herstellte. Hier gab es immerhin die Möglichkeit, einen einmal geschriebenen Text wieder auszukratzen und das Pergament dann neu zu beschriften. Dennoch war auch dieses Schreibmaterial äußerst kostspielig und viel zu teuer für einfache Notizen.
|28|Wenn man sich nur kurz etwas notieren wollte, gab es dafür ein anderes Medium: die Wachstafel (tabula cerata). Es gab sie bereits im alten Griechenland, schon das früheste literarische Werk Europas, Homers „Ilias”, nennt solche Wachstafeln (6.168f., Übers. Johann Heinrich Voß): „Aber er sandt’ ihn gen Lykia hin, und traurige Zeichen/gab er ihm, Todesworte geritzt auf gefaltetem Täflein.”
Dabei handelte es sich um rechteckige hölzerne Brettchen, die aussahen wie kleine Bilderrahmen und deren Innenfläche mit Wachs bezogen war. Der Rahmen bestand in der Regel aus Holz, man hat aber auch höherwertige Exemplare mit Elfenbein- und Goldrahmen gefunden. Für die Wachsfläche verwendete man typischerweise Bienenwachs mit einer Beimischung von je etwa 10 % Baumharz und Ruß. Das Harz sollte die Viskosität des Wachses verbessern, damit es zum Beispiel bei hohen Temperaturen im Sommer nicht einfach schmolz; der Ruß diente zur Färbung (je nach Vorliebe aber manchmal auch diverse Farbpigmente). Mitunter kamen bei der Herstellung der Wachsfläche auch Leinöl oder Talg zur Anwendung. So entstand ein sogenanntes Diptychon, das aus zwei mit einem Lederband oder einem Scharnier miteinander verbundenen Täfelchen bestand, die man zuklappen konnte, sodass sich die Wachsseiten innen befanden. Das Diptychon war die übliche Form, es kamen aber durchaus auch Polyptycha mit mehr Tafeln vor – die größten bekannten Exemplare maßen bis zu 30 × 40 cm und umfassten mehr als ein Dutzend Tafeln. Solche Konvolute waren aber nicht zum Transport gedacht, sondern dienten als Kassenbücher oder Ähnliches.
Zum Schreiben verwendete man einen Stilus, einen kleinen Stab aus Holz, Blei, Bronze, Silber oder Knochen mit einem spitzen Ende, mit dem man Buchstaben oder Zahlen ins Wachs ritzte. Das andere Ende des Stilus (oder Griffels) war abgeflacht: Damit konnte man über das, was man geschrieben hatte, streichen, das Wachs glätten und so das bisher Geschriebene quasi ausradieren – daher stammt der Terminus tabula rasa, „ausradierte Tafel”. Dieses Ausradieren war der große Vorteil der Wachstafel gegenüber allen anderen |29|Schreibmedien, und es war der Grund dafür, dass die tabulae ceratae auch im Mittelalter noch weit verbreitet waren. Vereinzelt benutzten Unternehmen Wachstafeln sogar noch im 19. Jahrhundert; dies ist für die Salzminen in Schwäbisch Hall bezeugt und für den Fischmarkt im französischen Rouen.
Im alten Rom kam die tabula cerata überall da zum Einsatz, wo es etwas aufzuschreiben galt, das nicht von Dauer sein musste – zumindest nicht von solcher Dauer, dass es spätere Generationen noch würden lesen sollen, so in der Schule, beim Militär, in Ladengeschäften, für kurze persönliche Mitteilungen. Und im römischen Götterkult: Die Beziehung der Römer zu ihren Göttern war eher pragmatischer Natur, nach dem Motto „Eine Hand wäscht die andere”. Dazu gehörte auch, dass man schriftlich festhielt, was man sich von einem bestimmten Gott als Gegenleistung beispielsweise für ein besonders aufwendiges Opfer erwartete – ganz so, wie es bei einer Geschäftsbeziehung eben üblich war. Die Einzelheiten dieses „Handels” notierte man auf einer Wachstafel, die man dann beim Altar aufbewahrte. War das Geschäft abgeschlossen, konnten die Details wieder gelöscht werden.
In seiner „Rede gegen Caecilius” erwähnt Cicero, wie auch die Richter solche Wachstafeln verwendeten, um beim Schiedsspruch ihre Stimme abzugeben (1.24): „Um dem guten Willen eine Drohung beizufügen, sagt er, es säßen unter den Richtern ein paar Vertrauensmänner, denen man hinterher die Stimmtäfelchen zeigen müsse. Der Vorgang der Kontrolle sei aber ganz einfach, da ja alle zugleich ihre Stimme abgäben und nicht jeder einzeln. Dazu erhalte jeder Richter ein Wachstäfelchen, das mit dem offiziellen Wachs bezogen sei und nicht mit jenem auf betrügerische Weise eingefärbten, das vor Kurzem für Aufregung gesorgt hatte.” Hier spielt Cicero darauf an, dass in einem Prozess gegen den berüchtigten Statthalter Verres dessen Verteidiger Hortensius allen bestochenen Richtern zur Abstimmung Täfelchen ausgehändigt hatte, die mit Wachs bezogen waren, das in einer besonderen Farbe eingefärbt war. Auf diese Art und Weise konnte Hortensius hinterher leicht nachprüfen, |30|ob sich die Bestochenen auch an die vorherige Verabredung gehalten hatten.
Auch die großen römischen Literaten arbeiteten mit solchen Wachstafeln, solange sich ein Text noch im Entwurfsstadium befand. Erst in der letzten Fassung wurde der Inhalt dieser Tafeln dann auf Papyrus übertragen. Das verrät uns auch der Dichter Horaz, wenn er schreibt: „Du wirst oft den Stilus umdrehen müssen, wenn du etwas schreibst, das es wert sein soll, gelesen zu werden” (Satiren 1.10.72f.). „Den Stilus umdrehen” heißt dabei nichts anderes, als dass man das, was man geschrieben hat, mit dem stumpfen Ende des Griffels wieder auslöscht und es noch einmal versucht.