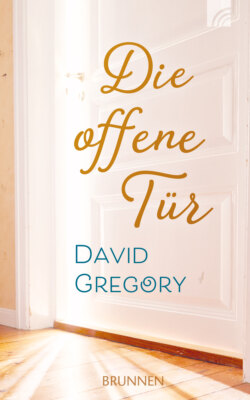Читать книгу Die offene Tür - David Gregory - Страница 7
Zwei
ОглавлениеPanisch schnappte ich nach Luft. Was …
Ich rieb mir die Augen. Zu spät. Die nächste Welle krachte mir in den Rücken und hob mich fast von meinem Sitz. Was zum …
Ich hörte Stimmen, Schreie, ängstliche Rufe. Meine Füße waren im Wasser. Nein, meine Knöchel auch. Was tue ich in einem Boot voller Wasser? Träume ich?
Schnell sah ich mich um. Ich saß auf einer Bank in einem Boot. Ungefähr zehn Männer, lumpig bekleidet, versuchten verzweifelt es über Wasser zu halten. Vier davon ruderten. Die anderen schöpften Wasser.
Das muss ein Traum sein. Ich träume. Ich würde mich niemals in so ein Boot setzen.
Die unerbittlichen Wellen ließen das Boot gefährlich schaukeln. Die Rufe der Männer waren kaum zu hören gegen den Wind, den Regen und die Wellen.
Traum oder Wirklichkeit, ich muss rausfinden, was hier los ist.
Obwohl es heller Tag war, konnte ich kaum über das Boot hinaussehen. Waren wir zehn Meter oder zehn Kilometer vor der Küste? Ich hatte keine Ahnung. Ich wusste nur zwei Dinge. Erstens: Wir waren nicht auf dem offenen Meer. Das Wasser, das mir ins Gesicht schoss, schmeckte nicht nach Salz. Zweitens: Die Rettungsversuche der Männer waren ein Witz. Das Wasser stand mir mittlerweile bis zu den Waden.
Ich krallte mich an die Bootswand. Einer der Männer neben mir drehte sich in Richtung Heck und fing an zu brüllen.
„Meister!“
Ich folgte seinem Blick. Wen meinte er?
„Meister!“
Die nächste Welle traf mich. Mit einer Hand strich ich mir die Haare aus dem Gesicht und rieb mir die Augen. Da sah ich ihn – anderthalb Meter entfernt schlief ein Mann unter einer Decke mit dem Kopf auf einem Kissen. Wie kann jemand bei diesen Bedingungen …
Der Brüllende taumelte an mir vorbei zu dem schlafenden Mann. Fällt ihm überhaupt nicht auf, dass plötzlich eine Frau auf dem Boot ist? Er rüttelte die schlafende Person und schrie: „Herr, wir gehen unter! Merkst du das nicht?“
Augenblick. Das kommt mir doch bekannt vor.
Und da schoss mir ein grotesker Gedanke durch den Kopf: Ist das vielleicht mein Abenteuer mit Jesus? Bin ich … bin ich etwa in diese biblische Begebenheit hineinteleportiert worden? Geht so was überhaupt?
Der schlafende Mann wachte auf, schlug die Decke beiseite und stand auf. Er hielt sich am Bootsrand fest. Ich schätzte ihn auf ungefähr dreißig, recht gut in Form, mittelgroß. Er war nass bis auf die Haut. Trotz des schaukelnden Boots ging er an mir vorüber und sah auf den See hinaus.
Dann öffnete er den Mund.
In diesem Augenblick traf mich die größte Welle. Sie krachte über meinem Kopf zusammen und schluckte mich vollständig. Ich wurde nach hinten geschleudert und versuchte mich mit aller Kraft am Boot festzuhalten.
Aber das Boot war verschwunden. Ich war mitten im tosenden Wasser.
Panisch ruderte ich mit den Armen und versuchte, an die Oberfläche zu kommen. Irgendwann hatte ich den Kopf endlich über Wasser. Ich ertrank nicht – jedenfalls nicht sofort. Aber ich wurde immer noch von den Wellen gebeutelt, die alle paar Sekunden über mich hinwegrauschten. Immer, wenn ich gerade über Wasser war, versuchte ich das Boot auszumachen. Aber bei dem starken Regen und dem trüben Licht konnte ich nichts sehen. Ich zwang mich nachzudenken.
Ganz ruhig, Emma. Jesus stillt gleich den Sturm. In wenigen Sekunden wird der See eine glasklare Oberfläche haben, und dann reicht er dir die Hand und zieht dich raus wie Petrus.
Aber die Sekunden verstrichen. Viele Sekunden. Eine Minute. Der Sturm ließ nicht nach. Genauso wenig wie die Panik.
Ich bin doch ganz allein. Und das hier ist kein Traum. Der Sturm ist echt und niemand da, der mir hilft.
Ich werde schwimmen müssen.
Die gute Nachricht war, dass ich zu Schulzeiten Schwimmen als Leistungssport betrieben hatte. Die schlechte Nachricht, dass ich längst nicht mehr so gut in Form war wie vor zwölf Jahren. Und die ganz schlechte, dass ich keine Ahnung hatte, in welcher Richtung das Festland war, und auch nicht, wie weit es bis dahin war.
Die Panik befahl mir, einfach so schnell wie möglich loszuschwimmen. Ich musste an Land. Und zwar sofort. Mein Verstand sagte das Gegenteil. Ich beförderte so schnell ich konnte meine Tennisschuhe von den Füßen. Dann machte ich mich gerade, legte mich auf den Rücken, atmete zwischen den Wellen und fing an zu kraulen. Egal, wie weit es bis ans Ufer war, Rückenkraulen war meine einzige Chance.
Ich schwamm. Verschluckte mich. Versuchte, den Kopf über Wasser zu halten. Minute um Minute. Es wurde immer dunkler. Irgendwann sah ich überhaupt nichts mehr. Ich wusste weder, was vor mir, noch was hinter mir war.
Ich schwamm weiter. Meine Arme und Beine taten weh. Nicht aufhören, Emma. Sie taten immer mehr weh. Nicht aufhören. Sie fingen an zu puckern. Weiter! Sie schrien mich an und wollten keinen Meter mehr voran. Ich kann nicht! Ich kann nicht! Aber ich schwamm weiter.
Mein linker Arm kratzte an irgendetwas. Ich tastete und bekam Boden unter die Füße. Auf wackligen Beinen versuchte ich zu stehen, fiel aber wieder ins Wasser. Schließlich gelang es mir, in der Dunkelheit voranzustolpern. Fünf Schritte später war ich an Land.
Wo ich war, wusste ich nicht. Ich hatte nie gedacht, dass Dunkelheit so dunkel sein konnte. Meinen Platz an Land wollte ich auf keinen Fall verlassen. Lauerte in dreißig Metern eine Klippe? Wer wusste das schon. Ich würde warten, bis es Tag wurde.
Erschöpft ließ ich mich am schlammigen Ufer nieder. Zwei Sekunden später ließ mich eine Stimme vor Schreck aufspringen.
„Hab keine Angst.“ Es war eine männliche Stimme.
Ich wusste nicht, ob ich erleichtert oder entsetzt sein sollte. Mit zusammengekniffenen Augen versuchte ich zu erkennen, wer da zu mir sprach, aber vergeblich. Ich sah die Hand vor Augen nicht.
„Wer sind Sie?“, fragte ich vorsichtig.
„Ich bin der Herr des Sturms.“
Ich hörte, wie er sich neben mir in den Schlamm setzte. Der Regen hatte nachgelassen. Alles, was ich vernahm, war mein Keuchen und die Wellen, die ans Ufer schlugen.
Tausend Dinge gingen mir durch den Kopf, aber auf eine Frage brauchte ich besonders dringend eine Antwort.
„Bin ich wirklich hier?“
„Ja.“
„Ich meine, das ist kein Traum?“
„Nein.“
Ich bekam Gänsehaut. Es war eine Mischung aus Aufregung und Angst.
„Aber wie bin ich hierhergekommen?“, fragte ich.
„Wir haben dich hergebracht.“
„Wir?“
„Der Vater, ich und der Heilige Geist.“
„Aber wie ist das möglich?“
„Mein Vater ist nicht an Raum und Zeit gebunden.“
Mein Gefühl sagte mir, dass es sich nicht lohnte, nachzubohren.
„Du hast den Sturm nicht gestillt“, sagte ich halb vorwurfsvoll. „Warum nicht?“
„Jetzt ist es doch still“, erwiderte er.
„Aber ich bin fast ertrunken!“
„Nein, bist du nicht.“
„Aber ich hätte ertrinken können.“
„Du hattest nicht genug Kraft, um zu schwimmen, aber ich habe dir die Kraft gegeben.“
Wir saßen schweigend nebeneinander. Hätte er nicht mehr tun können? Mich aus dem Wasser ziehen zum Beispiel?
„Ich habe getan, was du wolltest. Ich bin durch die offene Tür gegangen.“
„Ja.“
„Und dann war ich plötzlich mitten in einem Sturm.“
„Ja.“
„Warum hast du ihn nicht einfach gestillt?“
„Warum sollte ich das tun?“
„Weil die Geschichte nun mal so geht? Du stillst den Sturm.“
„Emma, ich habe den Sturm geschickt. Wieso sollte ich ihn stillen, bevor er seinen Zweck erfüllt hat?“
Ich musste nachdenken. Ich hatte getan, was Jesus von mir wollte, und wo war ich gelandet? Er hatte mich nicht nur in eine Situation gesteckt, die sich leider als schwierig herausstellte; nein, er hatte mich absichtlich in eine Umgebung gebracht, die feindlich sein sollte. Lebensbedrohlich. Was sagte das über Jesus aus?
„Ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen soll“, sagte ich schließlich.
„Kannst du aber“, antwortete er.
Mehr nicht. Kein Wort der Erklärung. Keine Verheißung. Nichts.
„Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich dir vertrauen will.“
„Das ist deine Entscheidung.“
Ich hörte, wie Jesus aufstand.
„Du gehst?“
„Ich werde woanders gebraucht.“
„Soll ich dir folgen?“
„Wir werden uns wiedersehen.“
„Wo?“
„Nicht wo. Sondern wann.“
„Aber wie finde ich dich?“
„Laufe den Hügel hinauf. Wenn du oben bist, wirst du sehen, wie über einem Dorf der Morgen anbricht. Geh dorthin und durch eine offene Tür.“
Seine Schritte entfernten sich. In wenigen Augenblicken würde ich ihm nicht mehr folgen können, selbst wenn ich wollte.
Ich stand auf. „Und was, wenn ich einfach wieder nach Hause will?“
Seine Stimme klang schon entfernt. „Dann sage ‚Ich will nach Hause.‘“
Ich zögerte. „Und was verpasse ich dann?“
Er war kaum noch zu verstehen. „Die Antwort auf deine Frage.“
Unwillkürlich runzelte ich die Stirn. „Welche Frage?“
Ich wartete auf eine Antwort, aber er war schon zu weit weg.
„Welche Frage?“, rief ich.
Ich lauschte. Alles, was ich hörte, waren die Wellen zu meinen Füßen.