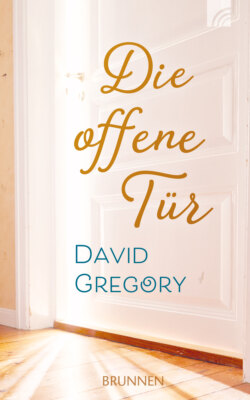Читать книгу Die offene Tür - David Gregory - Страница 8
Drei
ОглавлениеIch überquerte den Strand und machte mich daran, den Hügel zu erklimmen. „Au! Aua!“
Ein Dorn steckte mir im rechten Fuß. Als ich mich hinunterbeugte, um ihn herauszuziehen, zerkratzte ich mir den Arm. „Au!“ Ich hielt den Arm nah ans Gesicht, um die Wunde zu inspizieren. Keine Chance, zu dunkel.
Na toll. Ich klettere hier barfuß einen Hügel hoch, trete in Dornen und zerkratze mich an irgendwelchen Büschen. Die Worte Ich will nach Hause formten sich in meinem Kopf. Ich scheuchte sie weg. Was auch immer Jesus für einen Plan mit mir verfolgte – jedenfalls war ich davon ausgegangen, dass es Jesus war. Wer sonst? Vielleicht hätte ich ihn einfach mal fragen sollen? – Nun, was auch immer Jesus für einen Plan mit mir verfolgte, es war bestimmt ein paar Dornen wert. Wenigstens waren meine Beine durch die Jeans geschützt.
Fünf Minuten und nur zwei Dornen später erreichte ich die Hügelspitze. Das erste Licht des Tages erschien am Horizont. Unter mir, etwa zehn Minuten Fußmarsch entfernt, lag ein kleines Dorf. Ich wollte mich gerade auf den Weg machen, als mir ein Gedanke kam.
Wie werden die Leute aus dem ersten Jahrhundert reagieren, wenn auf einmal eine Frau in T-Shirt und Jeans in ihr Dorf spaziert, noch dazu nass bis auf die Haut? Gibt es nicht so etwas wie eine Kleiderordnung für Männer und Frauen?
Mir wurde heiß und kalt.
Wurden Frauen bei so etwas nicht gesteinigt?
Die letzten Anweisungen von Jesus hatten mir beinahe ein kaltes Grab am Boden des Sees beschert. Ich war mir gerade nicht sicher, ob ich seine nächsten befolgen sollte.
Ich sah an mir herunter und entdeckte etwas neben meinen Füßen, kaum zu erkennen in der Morgendämmerung.
Sandalen. Und so wie es aussah, genau in meiner Größe. Ich schlüpfte hinein. Sie passten wie angegossen.
Jesus hatte mir ein Paar Sandalen hingestellt. Würde er das tun, um mich danach steinigen zu lassen? Sicher nicht. Na gut, hoffentlich nicht. Ich beschloss, das Risiko einzugehen und stieg den Hügel hinab.
Ein paar Minuten später hatte ich den Dorfrand erreicht. Wie sollte ich es schaffen, hier nicht aufzufallen? Da fiel mir ein: Ich konnte ruhig auffallen. Alles, was ich brauchte, war eine offene Tür. Wenn man mich angriff, würde ich einfach zur nächsten offenen Tür sprinten.
Ich kam bis auf knapp fünfzig Meter an das erste Lehmsteinhaus heran.
In einigen Häusern Entfernung kam ein Mann um die Ecke und führte ein Maultier mit sich. Er kam genau auf mich zu.
Ich blieb stehen. Die Häuser waren noch zu weit weg. An ihm vorbeirennen konnte ich auch nicht. Ich drehte mich um. Bis zur Hügelspitze schaffte ich es nicht mehr. Ich war gefangen.
Also blieb ich stehen und wartete. Jesus, jetzt könnte ich hier wirklich deine Hilfe gebrauchen, mehr fiel mir nicht ein.
Der Mann und das Maultier kamen näher. Ich machte mich darauf gefasst zu fliehen. Plötzlich krähte ein Hahn. Der Schreck ging mir durch Mark und Bein, aber ich rührte mich nicht vom Fleck. Der Mann behielt seinen gemächlichen Gang bei. Jetzt war er keine fünfzehn Meter mehr entfernt. Meine Muskeln spannten sich an. Zehn Meter. Er sah nicht auf. Fünf. Nichts.
Er lief einfach an mir vorüber.
Ich stand da, sprachlos. Da fiel mir ein, dass die Männer auf dem Boot mich auch nicht wahrgenommen hatten. War ich etwa unsichtbar? Für alle außer Jesus? Und selbst er hatte mich nicht wirklich gesehen; als wir gesprochen hatten, war es stockfinster gewesen. Ich blickte wieder ins Dorf. Vielleicht war es doch nicht so schlimm, wie ich dachte.
Langsam tastete ich mich vorwärts. Es wurde heller und Leben kehrte ein. Ich hörte Stimmen und immer wieder den Hahn krähen. Eine Frau mit Kopftuch und Schleier trat aus einem Haus, gefolgt von einem kleinen Kind. Sie ließ die Tür offen und trat in ein kleines Nebengebäude. Ein Stall? Ich hörte Tiergeräusche – womöglich Ziegen. Die andere Tür stand offen. Wenn ich dort durchging, kam ich hoffentlich woanders hin. Wenn nicht, platzte ich ohne Grund in das Haus einer Hebräerin im ersten Jahrhundert.
Ich sah mich um. Zwei weitere Frauen mit Kopftuch und Schleier waren auf der Straße, aber sie sahen nicht in meine Richtung. Schnell lief ich auf das Haus zu und warf einen Blick hinein. Drei Kinder schliefen auf Strohmatten. Eine ältere Frau lag schnarchend daneben. Unsichtbar oder nicht, das hier war meine Chance. Ich holte tief Luft und lief durch die Tür.
Gleißendes Sonnenlicht ließ mich die Augen zusammenkneifen. Aus dem frühen Morgen war hellster Tag geworden. Der See und der Hügel waren einer braunen, staubigen Gegend gewichen. Ich konnte ein Dorf in der Ferne ausmachen, das größer aussah als das letzte. Hinter dem Dorf wurde es bergig. Zu meiner Linken waren kleinere Hügel mit einigen Höhlen darin. Der plötzliche Umgebungswechsel war nicht mehr so schockierend wie beim ersten Mal. Ich gewöhnte mich wohl an diese Art zu reisen.
Knapp fünfzig Meter vor mir lehnte ein Mann an einer kleinen Steinmauer und winkte mir zu. Ich sah mich um. Meint er etwa mich?
„Emma!“, hörte ich ihn rufen. Soweit ich wusste, gab es nur eine einzige Person in diesem Jahrhundert, die meinen Namen kannte.
Ich lief auf ihn zu. Gerade wollte ich „Welche Frage?“ rufen, da entdeckte ich eine zweite Person. Eine Frau mit einem großen Krug lief aus dem Dorf auf uns zu. Irgendetwas an ihr stimmte nicht, aber ich kam nicht darauf, was.
Ich blieb stehen, aber dann fiel mir wieder ein, dass sie mich genauso wenig sehen würde wie der Rest der Leute in diesem Jahrhundert. Jesus mal ausgenommen. Also ging ich näher heran.
Jetzt konnte ich endlich auch ihn genauer unter die Lupe nehmen. Leicht dunkle Haut mit olivbraunem Ton. Schwarze Haare. Dunkelbraune Augen. Mittelgroß. Anders als auf den Bildern, die ich als Kind gesehen hatte, sah er ziemlich … jüdisch aus. Ganz normal eben für die Leute in dieser Gegend.
Die Frau kam auf Jesus zu, dessen Steinmauer ich mittlerweile als Brunnen erkannt hatte. Die Frau am Jakobsbrunnen. Ich war drauf und dran, eins der bekanntesten Gespräche Jesu mitzuerleben.
Ohne ihn anzusehen, stellte die Frau ihren Krug ab und ließ einen Eimer hinab. Sie sah ziemlich fertig aus. Ihre Stirn war voller Falten, und sie wirkte extrem unsicher. Ihre Kleidung war rot und gelb gefärbt, ganz anders als die einfachen, sandfarbenen Sachen, die die Leute im letzten Dorf getragen hatten. Sie schien sich hübsch anziehen zu wollen, aber ihre Kleider waren an den Rändern ausgefranst, als hätte sie schon lange nicht mehr das Geld, um ihre Erscheinung zu pflegen.
Und da fiel mir auf, was bei ihr nicht stimmte: Sie trug weder Schleier noch Kopftuch. Diese Frau sah aus, als hätte sie aufgegeben, die kulturellen Regeln zu beachten.
„Gib mir bitte zu trinken“, sagte Jesus.
Die Frau hielt den Eimer fest und starrte ihn ungläubig an. „Wie bitte, Herr?“
„Würdest du mir etwas zu trinken geben?“, wiederholte er.
Sie zog den Eimer mit Wasser nach oben. „Wie kannst du, ein Jude, mich, eine Samariterin, nach etwas zu trinken fragen?“ Sie zögerte. „Willst du das wirklich?“
Es dauerte einen Augenblick, bis ich begriff, was hier vor sich ging. Sie war eine Frau und ganz allein hier draußen. Eine Frau mit Vergangenheit. Und er war ein Mann, ebenfalls allein. Männer gingen hier nicht auf diese Art auf Frauen zu. Glaubt sie etwa, er will sie anmachen?
Jesus überging ihre Frage. „Wenn du wüsstest, welches Geschenk Gott dir machen will und wer dich hier um etwas zu trinken bittet, würdest du stattdessen mich bitten, und ich würde dir frisches, lebendiges Wasser geben.“
Sie sah kurz zum Brunnen. „Der Brunnen ist ziemlich tief, und du hast nichts zum Schöpfen dabei. Woher willst du frisches Wasser holen? Jakob, unser Stammvater, hat uns diesen Brunnen gegeben. Er und seine Söhne haben daraus getrunken. Und ihr Vieh. Kannst du mehr als Jakob?“
Jesus stand auf und leerte den Wassereimer in den Krug der Frau. „Wenn du dieses Wasser trinkst, wann wirst du wieder Durst haben?“
„Ich verstehe nicht …“
„Wann musst du herkommen, um neues zu holen?“
„Morgen.“
Er nickte. „Das stimmt. Wenn du dieses Wasser trinkst, wirst du wieder Durst bekommen. Aber ich biete dir ein anderes Wasser. Wer von meinem Wasser trinkt, wird nie wieder durstig sein. Mein Wasser wird in dir zu einer sprudelnden Quelle. Es hört nie auf zu fließen.“
Die Frau hockte sich vor ihm hin. „Herr, gib mir von deinem Wasser. Dann bin ich nicht mehr durstig, und ich muss auch nicht jeden Tag hierherkommen und Wasser schöpfen.“
Jesus stellte den Eimer ab. „Warum holst du nicht deinen Mann? Dann können wir gemeinsam reden.“
Die Frau sah zu Boden. „Ich habe keinen Mann.“
Jesus setzte sich auf die Brunnenmauer. „Das stimmt. Du hattest schon fünf Männer, und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann.“
Die Frau sah Jesus erschrocken an. Sie war offensichtlich überrascht. „Du musst ein Prophet sein“, sagte sie und lenkte von sich ab. „Unsere Vorfahren haben hier Gott angebetet, dort auf diesem Berg.“ Sie zeigte auf den Berg hinter dem Dorf. „Aber ihr Juden sagt, man kann nur in Jerusalem anbeten. Was stimmt denn nun?“
Jesus beugte sich vor. „Ich verrate dir ein Geheimnis. Gott ist nicht an einen Ort gebunden. Es ist ihm egal, ob man ihn auf diesem Berg anbetet. Oder ob man dafür nach Jerusalem pilgert. Von jetzt an werden ihn die Menschen überall anbeten, wo auch immer sie sind. Sie werden von einem neuen Geist erfüllt sein, den er ihnen gibt. Sein Geist macht sie zu wahren Anbetern. Solche Menschen sucht der Vater. Gott ist Geist. Um ihn wirklich anzubeten, musst du im Geist mit ihm eins sein.“
Die Frau sah verwirrt aus und nahm ihren Krug.
„Ich weiß, dass der Messias kommt. Und wenn er da ist, wird er uns alles erklären.“
Jesus stand auf. „Du sprichst gerade mit ihm.“
Die Frau wollte gerade etwas erwidern, als wir hinter uns etwas hörten. Ich sah in die Richtung und entdeckte eine Gruppe von Männern, etwa ein Dutzend. Nein, genau ein Dutzend. Sie kamen auf uns zu und trugen einfache sandfarbene Kleidung. Die Jünger. Ich hatte sie bereits im Boot gesehen, aber dort war es viel zu dunkel gewesen. Im Augenblick schienen sie genauso baff zu sein wie die Frau, als Jesus sie angesprochen hatte. Dass er allein mit einer Frau sprach, empörte sie.
Die Frau stand auf, ließ ihren Krug stehen und rannte zurück ins Dorf.
Einer der Jünger hielt Jesus etwas Brot hin, das sie wahrscheinlich im Dorf gekauft hatten. „Meister“, sagte er, „hier, iss etwas.“
Jesus schüttelte den Kopf. „Ich habe zu essen. Ihr wisst nur nichts davon.“
Ich hörte, wie einige sich untereinander fragten. „Hast du ihm etwas gegeben? Woher hat er das Essen?“
Jesus lächelte. „Ich sage euch, was meine Nahrung ist: den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Sein Werk zu vollenden.“
Er kam auf mich zu und nickte in Richtung eines der Hügel. „Ich komme gleich wieder“, sagte er zu den Jüngern. Ich ging ihm nach.
„Welche Frage?“, wollte ich wissen, als wir außerhalb der Hörweite der Jünger waren.
„Erinnerst du dich nicht?“
Ich kramte in meinem Kopf. „Nein.“
„Es fällt dir sicher bald wieder ein.“
Wir erreichten den Fuß des Hügels und machten uns an den Aufstieg. „Und?“, fragte Jesus. „Was hältst du von der Frau?“
„Der Frau am Brunnen?“
„Ja.“
Die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen hatte ich schon oft gelesen – bestimmt ein Dutzend Mal. Ich beschloss, ehrlich zu antworten. „Ich kann mich nicht so richtig mit ihr identifizieren.“
Er warf mir einen Blick zu, marschierte aber weiter. „Wieso nicht?“
„Weil sie so anders ist.“
„Inwiefern?“
„Sie ist eine Dorfbewohnerin aus dem ersten Jahrhundert. Damit kann ich schon mal nicht viel anfangen. Dann war sie fünf Mal verheiratet, womit ich erst recht nichts anfangen kann. Und jetzt lebt sie einfach so mit einem anderen Mann zusammen. Damit will ich lieber erst gar nicht anfangen. Ich glaube, in dieser Gesellschaft kommt sie nicht so einfach damit davon.“
Jesus lächelte und stieg weiter den Hügel hinauf.
„Was ist?“, fragte ich.
Er sagte nichts.
„Warum lächelst du?“
„Weil ich etwas weiß, was du noch nicht weißt.“
Ich blieb stehen und verschränkte die Arme. „Und das wäre?“
Er sah sich um. „Du bist ganz genau wie diese Frau, Emma.“