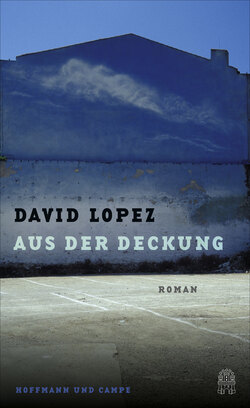Читать книгу Aus der Deckung - David Lopez - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Siebenundsechzig fünf
ОглавлениеZuerst sagt mir dieser säuerliche, beißende Geruch, wo ich bin. Diese Mischung aus Schweiß und Blut, zu der ich eine Menge beigetragen habe, wird hier von den Wänden aufgesaugt, die von der Freude am Schmerz durchtränkt sind. Ich trete ein, und schon rieche ich es nicht mehr. Ich sehe den Boxring, die Säcke und die Spiegel. Der kleine Victor springt bereits seil. Sucré ist auch gerade eingelaufen, er unterhält sich mit Farid, der sich neben dem Ring die Hände bandagiert. Farid wickelt seine Bandagen nicht auf, bevor er sie anlegt. Ich finde das unpraktisch.
Als ich zu ihnen gehe, um sie zu begrüßen, kommt Monsieur Pierrot aus der Umkleidekabine auf mich zu, du lässt dich jetzt schon hier blicken, wir müssen reden. Ich sage, guten Tag, Monsieur Pierrot, und er mustert mein Gesicht, fragt, geht’s mit dem Auge? Ja, antworte ich, und er sieht mich an, als sorgte er sich nur um mein Hämatom. Ich sei bereit, wieder zu trainieren, füge ich hinzu, und er sagt, darüber entscheide er. Dass ich einwende, es sei schon zwei Wochen her, überzeugt ihn nicht. Klein ist er, der Alte, er muss das Kinn heben, um mir in die Augen zu sehen. Zumal er direkt vor mir steht. Er hat ein zerfurchtes Gesicht, eine platte Nase und hervortretende Augen, und egal wie er guckt, man weiß nie so genau, was in seinem runden Kopf vor sich geht. Jedenfalls zeigt er nie eine Tendenz zur Gelassenheit. Er wirkt ziemlich panisch, als er mich fragt, wie es nun weitergehen soll. Wie, wie soll es nun weitergehen? Entscheiden das nicht Sie? Mit einem Mal spricht er leiser, kommt noch näher, so nah wie möglich, und sagt, Jonas, ich hatte Pläne mit dir, aber du machst mir das Leben nicht leicht. Ich sage nichts. Der Alte bildet seit vierzig Jahren Boxer aus. Schon seit einer Ewigkeit hat er keinen Profi mehr. Seit Paulo, der nur noch ab und zu die Boxhandschuhe überzieht. Das ist zehn Jahre her. Der Alte ist alt geworden. Er macht weiter, denn wenn er aufhört, stirbt er. Wir sehen uns an. Sein Blick ist ernst, was mir Unbehagen bereitet, was willst du eigentlich?, fragt er und klopft mir mit der geschlossenen Faust auf die Brust. Ich weiß, er würde gerne hören, dass ich mich am Riemen reißen werde, dass ich wieder auf das Niveau kommen will, das ich vor einem Jahr hatte, als sich die Gelegenheit bot, ins Profilager zu wechseln. Gerade als ich anfing, mich vom Boxring zu lösen. Er möchte hören, dass ich ernsthaft zurückkomme, dass ich aufhöre, den Kleinverdiener zu spielen. Er wiederholt seine Frage, drängt mich. Was willst du? Das Seil, sage ich schließlich. Ich will seilspringen.
In der Umkleide begrüße ich die anderen, die sich gerade fertig machen. Cyril und Virgil. Der Raum ist nicht sehr groß. Zwei mit Kunstleder gepolsterte Bänke links und rechts, darüber Garderobenhaken. Ein einziges Klo. Zwei schäbige Duschen, sodass man manchmal warten muss, bis man an der Reihe ist. Ganz hinten die Sauna, ein Holzkasten, in dem es üblicherweise promiskuitiv zugeht, und dann gegenüber die Umkleide der Mädchen, eine enge Nische, in der sie sich schon zu dritt auf die Füße treten. Zur Wahrung ihrer Privatsphäre hat man sich damit begnügt, das Dreieck mit einem Duschvorhang abzutrennen.
Ich setze mich auf meinen Platz, der so lange für mich frei gehalten wird, bis man sicher ist, dass ich nicht komme. Dort saß ich, als Monsieur Pierrot mir zum ersten Mal die Hände bandagiert hat. An dem Tag habe ich begriffen, dass er gar nicht wütend war, sondern sich nur nicht ausdrücken konnte, ohne genervt zu wirken. Als ich ihn darauf hinwies, hat er es mit einem Lächeln quittiert.
Wir benutzen eine alte Waage mit Laufgewichten an einem waagrechten Steg. Es macht tik-tik-tik, wenn man sie bewegt. Monsieur Pierrot sähe mich gerne im Mittelgewicht, er findet mich zu mager, er hätte gerne, dass ich Muskelmasse zulege. Ich seufze, während ich die Gewichte an der waagrechten Stange verschiebe, und Farid sagt, als er an mir vorbeigeht, kein Wunder, dass Jonas nicht zunimmt bei all den Tüten, die er raucht. Ich vergewissere mich, dass Monsieur Pierrot es nicht gehört hat. Farid stichelt gern, er hat eine große Klappe. Wäre er nicht so witzig, würde ich ihm eine verpassen. Von ihm habe ich meinen Spitznamen, Zweieinhalb Runden. Denn ich habe nie genug Power, um die letzte Runde gut durchzustehen. Die Kämpfe enden immer auf Biegen und Brechen. Wenn ich genügend Punkte gesammelt habe und in Führung liege, geht es, doch wenn es eng wird, kann ich einpacken. Als ich von der Waage steige, sage ich siebenundsechzig fünf, und Farid notiert es im Heft. Du musst fünf Kilo zulegen, sagt der Alte, der mich gehört hat. Ich sage, ich fühle mich mit meinem Gewicht wohl, es ist nicht so anstrengend, und er sagt, nein, dir fehlt Schlagkraft, und ich zucke mit den Schultern. Eigentlich habe ich sowieso nie wirklich die Absicht, richtig zuzuschlagen. Ich bin kein Schlägertyp. Ich kämpfe eher wie ein Fechter. Mit Ausweichmanövern. Zurück und vor. Da ist es ein Vorteil, leicht zu sein. Doch davon will er nichts hören. Seine Idee ist, kräftiger zu werden. Es muss einem gefallen zu leiden.
Ich hole meine Bandagen aus der Tasche, sie sind nicht aufgerollt, so wie ich sie nach meinem Kampf abgewickelt habe. Sie stinken nach Boxkampf. Ich nehme eine und lege das Ende auf meinen Schenkel, damit ich sie glätten und die Falten ausstreichen kann. Zuerst wickle ich sie wieder auf, damit sie nicht auf den Boden hängen, wenn ich die Hand umwickle, denn das ist unpraktisch und macht Falten. Dann schlinge ich sie fest um die Hand. Ich wickle mit der rechten Hand und halte die Bandage in der linken. Um Falten zu vermeiden. Ich wickle und wickle. Die Bandage ist vier Meter lang.
Sucré, der gerade die Umkleide betreten hat, ist schon fast fertig. Er zieht das übliche Gesicht, runzelt die Stirn. Was nicht unbedingt heißt, dass ihn etwas bedrückt. Sucré sieht immer aus, als würde ihn die Sonne blenden. Mit ihm habe ich zum ersten Mal diese Halle betreten. Wir sind zusammen aufgewachsen. Er wirkt beruhigend auf mich, weil er keine Ansprüche hat. Er findet es nicht beschämend, sich mit wenig zufriedenzugeben. Trotz seines Übergewichts ist er sehr beweglich, ein guter Boxer. Er hat vor zwei Jahren mit dem Boxen aufgehört, seit er arbeitet. Ab und zu schaut er vorbei, um in Form zu bleiben, zumal er Fett angesetzt hat. Er schleppt eine ziemliche Wampe mit sich herum. Das hindert ihn nicht daran, sich hier die Fresse polieren zu lassen und Bewunderung für seinen Aufwärtshaken aus der Deckung heraus oder für seine geschmeidige Oberkörperarbeit einzusacken. Er liebt das Boxen noch mehr als ich. Schläge einzustecken stört ihn nicht. Bei jedem Training steigt er in den Ring, während ich mich zuweilen mit einer Verletzung, meiner Erschöpfung oder einem wackelnden Zahn herausrede. Er trägt seine schwarz-grüne Shorts, wie bei jedem Training, dazu eine K-Way-Regenjacke. Ich habe dir doch gesagt, dass es nichts bringt, mit einem K-Way zu trainieren, Sucré. Das bringt mich ins Schwitzen, meint er. Ja, aber dabei verlierst du nur Wasser, und weil du dehydrierst, ist deine Leistung im Keller, kapiert? Pah, das sehen wir im Ring, ob ich dann weniger stark bin. Okay, sage ich, wenn ich dich ausknocke, trägst du zum Training nie mehr K-Way. Er seufzt und lächelt dazu, zieh die Bandagen an, Jonas, und halt die Klappe. Wir lachen. Bin gleich so weit, sage ich.
Ich nehme eine Bandage, lege ein Ende auf den Handballen und halte es mit dem Daumen fest. Ich umwickle die Hand zweimal, dann führe ich die Binde zum Handgelenk, das ich ebenfalls zweimal umwickle. Über den Handteller geht es wieder nach oben, ich umwickle den Daumen, wobei ich ihn nach außen abspreize. Ich höre, wie der Alte im Saal ungeduldig wird, aber das ist nicht mein Problem. Vom Handgelenk aus ziehe ich die Bandage zwischen meinem kleinen Finger und dem Ringfinger hindurch, umwickle einmal die ganze Hand, dann geht es zurück zum Handgelenkansatz, um die Bandage zwischen Ringfinger und Mittelfinger durchzuziehen, und so weiter, immer über Kreuz, um die Mittelhand, das Kahnbein und noch was zu schützen, glaube ich zumindest, aber eigentlich habe ich keine Ahnung und wiederhole nur, was der Alte immer sagt. Nachdem ich die Bandage zwischen Mittelfinger und Zeigefinger durchgeführt habe, umwickle ich nur noch die ganze Hand, und dann fühle ich, dass meine Faust eine kompakte harte Einheit bildet, dass sie nicht mehr eine Ansammlung von Fingern ist, die mit einer Hand verwachsen sind, mit einer Handfläche, unter der sich ein Gelenk befindet, sondern ein einziges und ungeteiltes Ganzes, nichts als eine Faust, bei der man die menschliche Hand nicht mehr ahnt. Nichts gibt mir so sehr das Gefühl, ein Boxer zu sein, wie meine bandagierten Hände.
Der Alte hält es nicht mehr aus, er kommt zeternd in die Umkleide, dabei muss ich nur noch meine Schuhe schnüren. Immer muss man auf mich warten. Ich soll das gemeinsame Aufwärmen und das Muskeltraining leiten. Das ist normalerweise mein Job, aber heute, gerade erst zum Training zurückgekehrt, bin ich nicht darauf vorbereitet. Wortlos gehe ich aus der Umkleide in die Trainingshalle. Sie ist rechteckig. Ganz hinten befindet sich der Boxring. Scheinbar weit entfernt. Der Boden ist aus Beton. Wir hätten gern ein rutschfestes Parkett, aber wenn wir darüber reden, reißen wir nur Witze. Auf dem Beton rutschen wir in unseren Schweißpfützen aus. Die Hallenmitte ist frei, als würde sich zwischen den Boxsäcken eine Lichtung auftun. Insgesamt sind es sechs. Ich gehe an meinem Lieblingssack vorbei, dem schwarzen mit den waagrechten grauen Streifen, und verpasse ihm beiläufig eine rechte Gerade, eine schnelle Klatsche. Lass den Sack, sagt Monsieur Pierrot. Tausend Mal habe ich das schon gehört. Aber es juckt mich, und ich versetze ihm trotzdem einen leichten Schlag. Für meinen Ungehorsam fange ich mir einen Klaps mit der flachen Hand auf den Hinterkopf ein. Ich erinnere Monsieur Pierrot daran, dass beim Boxen Schläge auf den Hinterkopf verboten sind. Das bringt ihn zum Lachen. Verrückt, wie liebevoll er rüberkommt, wenn er die Leute wie ein Stück Scheiße behandelt. Er gibt mir noch einen Klaps, aber ich weiche aus, und wir gehen mit einem Lächeln auseinander, als ich lostrabe, um mit dem Aufwärmen zu beginnen. Alle folgen mir.
Zuerst sind die Arme dran, wir schlagen beim Laufen Geraden, lassen die Schultern kreisen. An den Wänden hängen Spiegel, ich nutze sie für einen Blick hinter mich, um mich zu vergewissern, dass jeder meinen Anweisungen folgt. Der Boxer ist narzisstisch. Er verbringt Stunden vor dem Spiegel, mustert sich auf der Suche nach dem perfekten Bewegungsablauf, der dem Gegner keine Lücke lässt, die es ihm ermöglichen würde, einen Treffer zu setzen. Und je näher er diesem Bewegungsablauf kommt, desto mehr findet er Gefallen daran, an den Bögen, die ein linker Haken, gefolgt von einem Aufwärtshaken, beschreibt, er bewundert den Ausdruck, den diese Bewegung dem Körper gibt, die Schlagkraft, die dadurch freigesetzt wird, die Schönheit dieser fließenden explosiven Gewalt, wenn der endlos wiederholte Bewegungsablauf vollendet ist. Und er betrachtet sich, sieht zu, wie er jene Osmose aus geistiger Ruhe und körperlicher Gewalt erlangt. So gelingt es ihm, den Hass vom Willen zu trennen, dem anderen wehzutun. So wird der Schmerz annehmbar. Und die Niederlage.
Wir bewegen abwechselnd die rechte und die linke Schulter, dann beide zusammen. Monsieur Pierrot steht in der Mitte des Raums, betrachtet uns mit verschränkten Armen. Hier und da ahmt er uns nach, um uns zu zeigen, wie es richtig geht, dann erinnert er sich, dass er mehrere Operationen hinter sich und keine professionellen Boxer mehr unter seiner Obhut hat, und hört auf damit. Monsieur Pierrot ist im letzten Jahr um zehn Jahre gealtert. Vielleicht ist es seine letzte Saison, aber das sagen wir jedes Jahr. Keine Ahnung, was aus dem Boxclub wird, wenn er sich eines Tages zurückziehen muss. Man kann sich kaum vorstellen, dass er eines Tages aufhören könnte.
Wir machen Gleitschritte, fast wie Chassés beim Ballett, bei denen es auch darauf ankommt, den gleichen Abstand zwischen den Beinen beizubehalten. Es ist der Schritt des Boxers. Man muss das Gewicht gut verteilen. Das Gleichgewicht ist wichtig für einen Boxer. Sonst stürzt er.
Fersen an den Po, Knie hoch. Wir traben noch einige Runden, dann beugen wir auf mein Zeichen hin die Knie und springen so hoch, als wollten wir die Decke berühren. Wir wiederholen das ein Dutzend Mal. Eigentlich fordert Monsieur Pierrot uns gern heraus, etwa mit fünfzig Euro für den, der an die Decke kommt, die allerdings sehr hoch ist. Doch seit Virgil es zweimal geschafft hat, lässt er das lieber bleiben. Deshalb versuche ich es erst gar nicht, doch seit Virgil es geschafft hat, ist Monsieur Pierrot noch härter drauf. Ich vermute, Virgil hat die Kröten nie gesehen.
Vor dem Spiegel an der Wand zur Umkleide bleibe ich stehen und hüpfe auf der Stelle. Ich drehe mich zu den anderen um, sie machen es mir nach. Wir hüpfen so eine gute Minute lang, schütteln die Arme aus, entspannen die Schultern. Und dann beginnt das Schattenboxen. Das bedeutet, gegen die Luft zu boxen, gegen einen imaginären Gegner. In meiner Vorstellung ist er oft nicht besonders groß, denn aufgrund meines Körperbaus sind die Gegner in meiner Gewichtsklasse gewöhnlich kleiner als ich. Wenn der Gegner versucht, in meine Deckung einzudringen, halte ich ihn auf Distanz. Sobald er den geringsten Vorstoß unternimmt, lege ich los. Wenn man seine Reichweite richtig ausnutzt, kann man mit dem Kerl machen, was man will. Ich liebe es, einen Gegner zu zermürben, bis er aus purer Verzweiflung losstürmt. Dann muss er meine Aufwärtshaken einstecken. In dem Moment serviere ich ihm meinen Jab, die mit der Führhand geschlagene Gerade gegen den Kopf. Der Jab ist der wichtigste Schlag, er allein ist Beweis genug, dass Boxen kein Sport von Rowdys ist. Ein Jab ist zu allem nützlich, zur Verteidigung, zur Vorbereitung eines Angriffs, um sich zu schützen, um Raum zu gewinnen, als Finte, um die Deckung zu öffnen, längere Kombinationen aufzubauen, den Rhythmus des Gegners zu stören. Um auszusehen, als boxe man, wenn man mal keine Lust hat. Man kann einen Boxkampf allein mit seinem Jab gewinnen. Ich bin ein Distanzboxer, ich setze auf die lange Distanz und den Konter, deshalb benutze ich den Jab hauptsächlich, um den Gegner zurückzutreiben, ihn daran zu hindern, in seine Kombinationen zu finden. Beim Schattenboxen lege ich mich richtig ins Zeug, es steht mir ja niemand gegenüber. Ich schlage, tänzle, ich dopple, weiche aus, Rückzug, Konter. Ich heize dem Kerl ein. Ich spule alle Schlagfolgen ab. Alles sitzt. Jonas! Links, links, rechts, und kümmere dich nicht um den Rest! Monsieur Pierrot weiß, dass ich mir beim Schattenboxen vorstelle, Typen k.o. zu schlagen, dass ich sie mir einen nach dem anderen und manchmal sogar gleichzeitig vornehme und ihnen den Kopf abreiße. Man sieht es sofort. Seriös ist das nicht. Ein linker Leberhaken, dann mit derselben Faust ein Uppercut hinauf zum Kinn, dann eine rechte Gerade auf den Kiefer und zum Schluss ein linker Haken gegen die Stirn. Der Kerl wird sich sein ganzes Leben an diesen Kampf erinnern. Fehlte nur noch, dass ich die Arme hochreiße, um meinen Sieg zu feiern.
Links, links, rechts. Wenn man eine Gerade schlägt, müssen die Faust und die beiden Schultern eine Linie bilden. Das erfordert eine Drehung des Oberkörpers, die von den Beinen mit einer Drehung auf den Ballen begleitet wird, bei der die Hüfte mitgeht. Beim Schlagen ist der ganze Körper im Einsatz. Um eine Gerade mit dem anderen Arm anzuschließen, muss man die entgegengesetzte Drehung durchführen, und das zieht an den schrägen Bauchmuskeln, wenn man es richtig macht. Die Gerade muss frontal kommen, die Faust sofort an ihren Ausgangspunkt vor dem Gesicht zurückkehren. Wenn sie zur Schulter hin abfällt, lässt man eine Lücke und fängt sich einen Konter ein. Mein Fehler ist, dass ich die Linke zu tief halte. Auch wenn mein Jab dadurch unberechenbarer ist, bleibt eine Lücke für die Rechte. Man muss ein verdammt gutes Auge haben, um sich das Boxen mit offener Deckung erlauben zu können. Darauf setze ich, denn die Hände ständig oben zu halten ermüdet irgendwann. Aber weil Monsieur Pierrot mir zusieht, strenge ich mich an. Mein imaginärer Gegner ist jetzt ein wenig besser. Er teilt aus. Selbstverständlich nicht genug, um überlegen zu sein. Das ist das Gute am Schattenboxen. Man setzt sich gegen jeden Gegner durch.
Ich höre auf zu boxen, tänzle aber weiter auf der Stelle. Die anderen folgen mir und öffnen die Deckung. Ich beginne mit dem Muskeltraining. Es besteht aus einem Set von Dehn- und Streckübungen, die auf der Stelle ausgeführt werden. Dabei werden einzelne Muskelgruppen maximal belastet. Für dieses Trainingsprogramm braucht man nicht mehr Platz als für einen Hula-Hoop-Reifen. Ich übernehme gewissenhaft die Übungen von Monsieur Pierrot, der sie noch vormachen konnte, als ich anfing, und auch wenn wir uns darüber amüsierten, dass sein weniges Haar, das er sich als Strähne über die Stirn kämmte, bei den Pendelbewegungen von einer Schläfe zur anderen schwang und dabei über sein Gesicht wischte, beeindruckte uns schon damals, wie ein Mann in seinem Alter das durchhielt.
Ich atme geräuschvoll aus, um meinen Trainingspartnern vorzumachen, wie sie atmen sollen, und schon rinnen die ersten Schweißtropfen. Auf jede Übungsreihe folgt eine Minute Schattenboxen. Monsieur Pierrot kommt zu mir und fühlt meine Stirn. Ah, langsam kommst du ins Schwitzen. Ja, Monsieur Pierrot. Mein imaginärer Gegner ist wieder berechenbar geworden. Schlechte Deckung, langsam, Schwinger. Er bekommt von mir Konter von allen Seiten. Wenn ich der Ringrichter wäre, würde ich den Kampf beenden. Links, links, rechts, Jonas! Er macht es mir vor und untermalt seine Schläge mit rauen Kehllauten und krächzender Stimme, äh, äh, äh, und ich bemühe mich, ihn nachzuahmen, und er: Siehst du, Jonas, so geht das, in aller Ruhe. Aber Fäuste hoch, Jonas, Fäuste vors Gesicht! Bu-bu-bumm, und dann weichst du aus! Genau! Mach die Schultern breit! Dreh dich um dich selbst! Beweg dich! Zieh den Kopf ein!
Mit ausgestreckten Armen beginne ich die Scheibenwischer-Übung; dabei gehen die Hände in den Nacken und wieder zurück. Selbst wenn ich nicht in Form bin, schaffe ich sie damit alle. Wenn es bei mir zu brennen anfängt, müssen sie Höllenqualen ausstehen. Noch immer mit ausgebreiteten Armen stoppe ich und lasse die Arme oben. Man muss die Zähne zusammenbeißen. Ich kündige dreißig Sekunden an, für manche macht es das erträglich, andere sehen das Ende nicht. Fünfzehn Sekunden später verkünde ich noch einmal dreißig Sekunden, und Sucré vernichtet mich mit einem Lächeln. Zur Steigerung lasse ich die Hände noch kleine Kreise beschreiben. Farid konzentriert sich, der kleine Victor gibt auf, bevor die Übung zu Ende ist, Cyril ist hochrot, und Virgil tut so, als mache ihm das nichts aus.
Nach einer halben Drehung auf dem vorderen Bein stoße ich mit meiner Ferse gegen Cyrils. Er lächelt mir zu und nutzt die Rempelei, um einige Sekunden Atem zu schöpfen. Cyril ist schon knallrot, aber ich weiß, das ist sein Ding, den Schmerz aushalten. Brauchst du die Place de la Concorde, oder was, fragt er, und ich erwidere grinsend, dass sich diese Art von Kollisionen vermeiden ließe, wenn er nicht so ein Schrank wäre. Cyril ist Maurer. Folglich hat er Maurerhände. Und von diesen Händen möchte ich keinen Treffer kassieren. Er ist Superschwergewichtler, ein Fass von mehr als hundert Litern. Und er gehört zu jenem Typ Boxer, der das wenige, was er kann, sehr gut beherrscht. Er ist ein Jabber und nutzt seine Größe, um uns auf Distanz zu halten. Ich habe den Rhythmus seiner Jabs kapiert, ich kann ihn daher jagen und kontern. Er ist größer und stärker, aber ich bin zu schnell für ihn. Trotzdem, ein Spaziergang ist es nie. Sein Schlag ist ein Hammer, tut richtig weh. Manchmal ziehe ich ihn auf und sage, nur weil er eine Speckschwarte sei, habe er so viel Kraft, und er gibt zurück, ich hätte nur Angst vor ihm, sonst würde ich seine Einladungen zum Kampf nicht so oft ausschlagen. Und das stimmt.
Weiter geht es im Training mit Übungen zur Beweglichkeit des Oberkörpers. Das ist die Voraussetzung für gelungene Ausweichmanöver. Beine gespreizt, die Fersen gegen den Boden gestemmt und die Knie leicht gebeugt, kreisen wir mit dem Kopf und drehen den Oberkörper aus dem Becken heraus. Die Übung wechselt mit einer seitlichen Version, bei der man sich gerade hält und mit der Hand das Knie berührt. Dann steigert man das Tempo. Ich bin gut darin, ich höre erst auf, wenn ich merke, dass die anderen in Schwierigkeiten kommen. Trotzdem würde ich gerne einmal sehen, was passieren würde, wenn man die Übung so lange fortsetzte, bis man vor Schmerz nicht mehr kann. Wenngleich ich hier nicht zu denen gehöre, die besonders wild darauf sind zu leiden. Virgil zum Beispiel ist ein Tier, ein Monster an Ausdauer. Jetzt bin ich an meiner Grenze. Deshalb höre ich mit den Leibesübungen auf, bevor es zu ziehen beginnt.
Ich gehe auf und ab im Trainingsraum und atme tief durch. Mein weißes Achselshirt ist bis zum Zwerchfell grau vom Schweiß. Mein Ziel ist immer, dass kein Quadratzentimeter Stoff trocken bleibt. Manchmal wringen wir zum Scherz unsere Trainingsshirts aus und vergleichen, welches am meisten trieft. Farid kommt zu mir und beugt sich zu meinem Ohr. He, Jonas, ich hab gerade guten Stoff. Ich sage, Alter, ist aber nicht der richtige Zeitpunkt, und er, ’tschuldigung. Drei Sekunden vergehen, dann frage ich, was das für ein Stoff sei, und er meint, ich geb dir nachher ein Piece zum Probieren. Und ich, nur zu.
Farid ist vierundvierzig, sieht aus wie dreiunddreißig und führt sich auf, als wäre er siebzehn. Er schmiedet immer Pläne. Ich habe gehört, er sei zu seiner Zeit ein verdammtes Schlitzohr gewesen. Ich weiß nichts über ihn, aber ich weiß, dass er ein verfickter Linkshänder ist. Linkshänder sind megaanstrengend zu boxen, weil Rechtsausleger. Das verwirrt einen. Sie dagegen sind es gewohnt. In einem Boxclub kommt ein Linkshänder auf zehn Rechtshänder. Wahrscheinlich nervt es sie sogar selbst, wenn sie an einen anderen Linkshänder geraten. Farid ist nicht sehr groß, er boxt in gekrümmter Haltung, die Hände hoch vor dem Gesicht, mit kleinen Schritten. Wenn er angreift, ist es, als käme ein Einsiedlerkrebs aus seiner Muschel. Ich halte ihn auf Distanz, gelingt es mir, macht ihn das kirre. Doch wenn er durchkommt, schlägt er kurz und heftig. Er und ich, wir geben es uns richtig. Es fängt immer harmlos an, beinahe so, als wollten wir uns mit leichten Schlägen auf die Schulter aufwärmen. Er greift nur ab und zu an, deshalb boxe ich geruhsam gegen ihn. Doch er will, dass ich sofort Druck mache. Deshalb kassiert er früher oder später immer einen Treffer. Oft sage ich dann ’tschuldigung, obwohl ich das eigentlich nicht tun sollte. Sich bei einem Boxer für einen Treffer zu entschuldigen ist fast so, als würde man ihm absprechen, einer zu sein. Doch er stört sich nicht daran. Er sagt, der saß. Bei mir muss keiner sorry sagen, wenn er einen Treffer landet. Ich sage nicht, der saß. Ich sage vielmehr, okay, das reicht, jetzt pass mal auf, los, boxe. Einen Treffer zu kassieren tut nicht weh. Nicht so sehr. Mit dem großen Zeh an ein Tischbein zu stoßen, das ist schmerzhaft. Einen Haken gegen die Stirn, der Kopf wackelt, man verliert für den Bruchteil einer Sekunde die Orientierung, und dann ist man wieder in Kampfposition. Es spielt sich im Kopf ab, nicht am Kopf.
Monsieur Pierrot ist zur Rundenuhr gegangen, um sie anzustellen. Sie hängt an der Wand und klingelt abwechselnd einmal nach drei, dann nach einer Minute. Wir trainieren 3-Minuten-Runden und machen eine Minute Pause. Alle schnappen sich ein Springseil und verteilen sich im Raum. Ich stelle mich vor den größten Spiegel. Aber ich springe nicht besser, wenn ich mir dabei zuschaue. Ich lausche auf das Klatschen der Seile, wenn sie auf den Boden schlagen, was mir die jeweilige Schlagzahl verrät. Im Spiegel sehe ich dem kleinen Victor beim Seilhüpfen zu. Seine Zehenspitzen scheinen den Boden nur leicht anzutippen, wenn er über das Seil gesprungen ist. Mit Unterstützung der Schultern schwingt er das Seil aus den Handgelenken heraus völlig gleichmäßig. Er ist locker. Victor ist unser Kleinod. Er ist vierzehn, so alt wie ich, als ich mit dem Boxen angefangen habe. Er ist begabt, aber ein wenig zerbrechlich. Ich betreue ihn, wenn Monsieur Pierrot mit den anderen beschäftigt ist. Wenn ich ihn trainiere, weise ich ihn nur auf Fehler hin, sodass er dazu tendiert zu glauben, er mache alles falsch. Ich schone ihn nicht. Denn wenn man sich ausruht auf dem, was man gelernt hat, kann man die Sache vergessen. Er soll nicht meinem Vorbild folgen. Manchmal tue ich es nur, um zu sehen, wie er reagiert, ob er sich entrüstet, doch so weit kommt es nie. Dann schaut mich der Alte mit der Geringschätzung eines Mannes an, der sein Leben lang Boxer ausgebildet hat, und statt mir zu widersprechen, haut er mir eine aufs Kinn. Oft weiche ich aus, aber nicht immer. Er ist noch auf Zack, der Alte. Ich boxe nie gegen Victor, der Unterschied ist zu groß. Dagegen bittet mich Monsieur Pierrot manchmal, sein Sparringpartner zu sein. Die Aufgabe besteht dann mehr oder weniger darin, Victor auf mich einschlagen zu lassen. Dadurch soll er lernen, sich im Ring zu orientieren, sich richtig zu bewegen und Angriffe zu starten. Ich gebe ihm nur meinen Jab und vielleicht eine Gerade pro Runde. Ich mache das gerne, denn ich übe dabei die Beinarbeit, die Ausweichbewegungen. Sein leichtes Grinsen, wenn ihm ein Treffer gelingt, gefällt mir hingegen weniger. Es nervt mich, dass er sich einbilden könnte, er hätte mich wirklich getroffen, während ich ihm eigentlich freie Bahn gelassen habe. In diesem Fall gebe ich ihm eins auf den Helm, nicht mit voller Kraft, aber kurz und knackig, autoritär, das kapiert er dann. Damit er nicht anfängt, sich für stark zu halten. Wir trainieren, um weniger schwach zu sein. Was die Kraft angeht, so wird es immer einen geben, der uns in die Schranken weist. Häufig gehen Victor seine Mittel aus, und danach wagt er nicht mehr anzugreifen. Das ist kontraproduktiv, aber mir macht es die Sache leichter.
Monsieur Pierrot ist in die Pratzen geschlüpft, jene flachen Handschuhe, gegen die der Boxer mit voller Kraft schlägt, um Schlagfolgen und Kombinationen zu trainieren. Er ruft Victor, der sein Springseil fallen lässt und seine Boxhandschuhe anzieht. Während ich in gleichmäßigem Rhythmus und immer auf den Zehenspitzen weiterhüpfe, behalte ich die Szene im Blick. Ich sehe mich wieder an seiner Stelle, wie ich Monsieur Pierrot die Anweisungen von den Lippen saugte, der damals zwar erheblich dynamischer, aber ebenso kurz angebunden war. Die Rechte nach deiner Linken, nicht mit der Schulter nach vorn kommen! Streck dich, zum Teufel! Der kleine Victor gehorcht, und das so fleißig, dass seine Bewegungen schematisch werden, was Monsieur Pierrot ihm sofort unter die Nase reibt. Du bist doch kein Roboter, Victor! Boxe flüssiger, geschmeidiger, flieg! Bäng, bäng, bäng! Victor hat alle Mühe, den Anforderungen des Alten zu genügen. Er setzt sich unter Druck, der Kleine, das ist mir auch so gegangen. Er fängt sich eine leichte Ohrfeige. Schade, dass er nicht versteht, dass sie liebevoll gemeint ist.
Es klingelt. Sucré und Farid sind Typen, die sich zwischen den Runden unterhalten. Ich konzentriere mich lieber auf meine Atmung, sie geht schon kurz. Ich kann höchstens noch ja oder nein sagen, nicht mehr. Außerdem fragt Virgil, ob ich gleich mit ihm in den Ring steige, und ich sage, nein, ich fang gerade erst wieder an, verstehst du, und wenngleich er zuerst auf mich einredet, beharrt er nicht länger darauf, als er merkt, dass ich ihn nicht mehr beachte und mein Springseil nehme. Es hat geklingelt.
Virgil ist zwanzig, er ist mit Muskeln bepackt und ein super Boxer. Ich glaube, Monsieur Pierrot dürfte inzwischen klargeworden sein, dass er gegebenenfalls auf ihn setzen muss. Mit seinem Eifer stellt er uns alle hier in den Schatten. Man muss nur sehen, wie er trainiert. Außerdem lebt er gesund. Klar, in der Hinsicht bin ich ’ne fette Pleite. Und im Ring ist es auch nicht so weit her mit mir. Virgil ist ein Pressure-Fighter. Er hat nichts von einem Ästheten. Er klebt am liebsten an seinem Gegner, geht in dessen Deckung hinein und bearbeitet seinen Oberkörper. Dieser Boxertyp sagt mir in den ersten Runden am meisten zu, denn mit meinem Jab kann ich ihn auf Distanz halten. Nur hat der Kerl drei Lungen, und selbst wenn ich ihn zwei Runden in Schach halten kann, in der dritten bin ich oft überfordert, weil er immer noch da ist, Druck macht und mir den Weg im Ring abschneidet, weil er an mir klebt, es zermürbt einen, unterminiert einen, und die Schläge gegen den Körper hauen einen um. Wenn wir gegeneinander boxen, trage ich meinen Spitznamen zu Recht.
Ich springe noch zwei Runden mit dem Seil, dann gehe ich an den Sandsack. Seit Virgils Vorschlag habe ich kein Wort mehr gesprochen. Die schwarzen Boxhandschuhe mit dem Aufdruck Champ liegen bereit. Sie gehören nicht mir, aber ich habe sie seit langem für mich in Beschlag genommen. Sie sind ganz weich, deshalb spüre ich die Schläge gut. Ich habe dann das Gefühl, meine Fäuste im Ziel zu versenken.
Die Klingel kündigt die nächste Runde an. Als Erstes gebe ich dem Sandsack einen Stoß, sodass er in alle Richtungen schwingt. Das ist, als hätte man einen Gegner vor sich, der ständig den Platz wechselt, man sucht das richtige Timing, um in dem Moment zuzuschlagen, wenn der Sack auf einen zukommt. Als würde man einen Angreifer blocken, während er seinen Angriff vorbereitet. Jab, Jab, Jab, ich bleibe auf Distanz, ich umkreise ihn, die Hände hoch, weil Monsieur Pierrot mir zusieht. Jab, Jab, durchtauchen und bumm, die Rechte. Es knallt, als Leder auf Leder trifft. Als ich mir vorstelle, dass mir der Sack ein paar Geraden schickt, weiche ich mit dem Kopf aus und kontere, bumm, auf seine Schulter, bumm, auf den Bizeps. Ich schicke ein paar schnelle Schläge hinterher, vier Treffer, und hopp, weg bin ich. Nach einem Treffer muss man sich bewegen, man darf nicht zum reglosen Ziel werden. Am Sandsack lässt die Aufmerksamkeit schnell nach. Wie beim Schattenboxen muss man sich bemühen, einen Gegner vor Augen zu haben, sonst drischt man auf ihn ein wie ein Hornochse. Als ich anfing, verbot mir Monsieur Pierrot fast zwei Monate lang, gegen den Sack zu boxen. Es verleitet zu Fehlern, sagte er, weil man dazu neigt, nur reinzuhauen, und dann Schluss, aus. Und da ich mir einen starken Gegner vorstellen soll, fällt mir prompt einer ein. Kerbachi natürlich. Kerbachi, der mich vor vierzehn Tagen k.o. geschlagen hat. Er ist nicht der Erste, der mich besiegt hat, aber er ist der Erste, der mir haushoch überlegen war. Wie Flashs steigen Bilder aus dem Kampf in meiner Erinnerung auf. Ich schlage kraftvoller zu. Ich möchte, dass er für diese dritte Runde bezahlt, bei der ich zu Boden gegangen bin. Ich erinnere mich an diese Gerade mit der Linken, die ich mir viermal hintereinander einfing, viermal ohne Reaktion, als hätte ich Geschmack daran gefunden. Ich sehe den Aufwärtshaken, den er landete, als ich, die Fäuste schützend vor dem Kopf, in den Seilen hing, überzeugt, ich wäre wie eine Schildkröte, die den Kopf einzieht, hinter einem undurchdringlichen Panzer geschützt. Der Schlag warf meinen Kopf so brutal in die Höhe, dass der Ringrichter es für geboten hielt, mich stehend anzuzählen, ein Los, das Boxern vorbehalten ist, die in Not geraten sind und denen man einen kurzen Aufschub gönnt, bevor man sie ans Messer liefert. Mir fallen die letzten Sekunden des Kampfs ein, in denen ich alles tat, um einen Schlagabtausch zu vermeiden, meinen Gegner umschlang, ihn am Arm hielt oder auch meinen Zahnschutz ausspuckte, zwei Mal, was mir eine Verwarnung einbrachte. Und dann verschwimmt Kerbachis Gesicht, seine Silhouette zieht sich zusammen, wird schmaler, sein Haar wächst, das Gesicht bekommt feine Züge, und der ganze Körper nimmt eine Haltung an, die ich gut zu kennen glaube, mit dem Gewicht auf dem linken Bein, das rechte, leicht angewinkelt, auf den Zehenspitzen. Wanda hat Kerbachis Stelle eingenommen. Ich begrüße sie mit einer strammen Geraden, sodass ihre Nase anfängt zu bluten. Sie sieht noch nicht aus, als sei sie gebrochen, aber das kommt noch. Jetzt, da ich Wanda sehe, gibt es keinen Sandsack mehr, nur dieses Gesicht mit dem zwiespältigen Lächeln, dieses zarte, verführerisch geschnittene Gesicht, nur diesen Mund, in den ich gerne meinen Schwanz gesteckt hätte, den zermalme ich jetzt. Nimm das in deine hübsche Fresse, Wanda, ich will alles plattmachen, was aus diesem Sack herausragt, der dein Gesicht ist. Mit meinen Haken falte ich deine Ohren zusammen, ich hämmere auf sie ein, bis sie sich in deine Gehörgänge zurückziehen und darin verschwinden. Ohren nützen dir sowieso nichts, du hörst ja nicht. Mich hörst du nicht. Eigentlich bist du aalglatt, deshalb werde ich dich so behandeln, dass du deinem Bild gleichst. Jetzt ist deine Nase dran, die ich mit meinen Geraden einschlage wie einen Nagel, bumm, bumm, bumm, sie ist widerständig wie ein Reißnagel, der in einem Ziegel statt in Gips steckt, aber ein guter Hammer schafft das, und dieser Hammer ist meine Rechte, die zwei, drei Mal zuschlägt, die diesen Zipfel schließlich in dir versenkt, der übrigens sehr hübsch war. Es macht nicht richtig Spaß, aber ich habe auch keinerlei Skrupel. Irgendwie siehst du dir schon ähnlicher. Auch wenn es noch einen Rest zu tun gibt. Dieses vorspringende runde Bäckchen, auf das ich dich nicht küssen durfte, aber ich liebe diesen kleinen Hügel, der sich wölbt, wenn du lächelst. Ich werde diese Gesichtspartie plattmachen. Ein Bäckchen kann platzen. Ich gebe deinem Gesicht sein wahres Aussehen. Ich habe eine Art Wachskugel vor Augen, aus der nichts herausragt, nur ein von meinen Katapultschlägen blutiger Haarschopf. So bist du wirklich schön, mit deinen eingezogenen Ohren, deinen in den Lidern verschwundenen Augenbrauenbögen, deinen plattgemachten Bäckchen, deiner eingeschlagenen Nase. So sehe ich dich mit Wohlwollen. Ich habe das Trugbild ausgelöscht. Denn du bist viel zu schön, Wanda. Dir ist nur noch dieser Mund geblieben mit alle seinen Zähnen, manche sind schon ausgefallen, aber es sind noch ein paar übrig. Ich gehe über zu Aufwärtshaken, damit deine Zähne durch die Luft fliegen wie Reis bei einer Hochzeit. Sie klackern, wenn sie auf dem Boden aufprallen. Die Backenzähne sind nicht leicht zu knacken. Mir tun die Hände weh von den vielen Schlägen, aber das muss sein, Wanda, sonst kann ich dich nicht berühren. Ich habe nur das.
Es klingelt. Ich beende diese Runde mit einer Serie schwerer Schläge, in die ich alle Kraft hineinlege, die ich habe, mit total offener Deckung, ohne mich im Geringsten um die Technik zu kümmern. Ich schlage zu wie ein Tauber, im wörtlichen Sinn sogar, ich achte nicht auf die Rundenuhr, und nach einigen Sekunden hört man nur noch mich auf den Sandsack einschlagen, bis es in meiner linken Faust knackt. Ich höre auf zu schlagen, der Schmerz hat mich in die Realität zurückgeholt. Was ist passiert?, brüllt Monsieur Pierrot. Ich glaube, ich hab mir das Handgelenk kaputt geschlagen, sage ich. Ich ziehe den Handschuh aus, und Monsieur Pierrot nimmt meine Hand. So vorsichtig er dabei auch ist, es schmerzt. Ich verziehe das Gesicht, kaum dass er beginnt, mein Handgelenk zu drehen. Obwohl ich mich gehörig zusammenreiße, kann ich den Schmerz nicht verbergen. Ab in die Dusche, sagt er. Aber M’sieur Pierrot, ich …, ab in die Dusche!, und ich gehe mit gesenktem Kopf in die Umkleide zurück.
Die Klingel ertönt. Sucré ist in der Umkleide, er trinkt Wasser. Unsere Blicke begegnen sich, er zuckt mit den Schultern. Und dann runzelt er die Augenbrauen mehr als üblich, sieht mich noch einmal an. Ich lasse den Kopf hängen.
Geduscht und angezogen kehre ich in die Trainingshalle zurück, wo die anderen jetzt im Ring sind. Ich hau ab, Leute. Mach’s gut, Jonas, und leg Eis drauf, wenn du zu Hause bist, sagt Virgil, der nicht ahnen kann, wie sehr ich es hasse, wenn man mir mit Eis kommt. Monsieur Pierrot steht am Ring. Er ist konzentriert, beobachtet seine Boxer. Ich gehe trotzdem zu ihm, obwohl ich weiß, dass er mich anschnauzen wird, weil ich ihn ablenke, doch das ist das kleinere Übel, verglichen mit dem, was mich erwarten würde, wenn ich ohne Gruß verschwände. Er dreht sich zu mir und betrachtet mich mit einem Blick, der mir wie Mitleid vorkommt. Pass auf dich auf, Jonas. Dann streicht er mir mit der Hand durchs Nackenhaar. Das hat er erst zwei Mal getan: bei meinem ersten Kampf in der Juniorenklasse, als mich die Punktrichter um den Sieg gebracht hatten, und damals, als ich in der ersten Runde k.o. gegangen war. Ich begegne dem Blick von Sucré, der gerade eine Runde mit Farid zu Ende geboxt hat und für den jetzt Virgil in den Ring steigt. Okay, Sucré, wir sehen uns bei Ixe. Hau ab, sagt er. Und ich gehe.