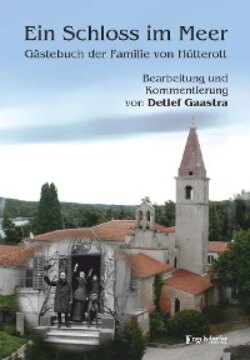Читать книгу Ein Schloss im Meer - Gästebuch der Familie von Hütterott - Detlef Gaastra - Страница 9
Auswertung des Gästebuches
ОглавлениеZur Vervollständigung der Geschichte der Familie Hütterott greife ich hier auf den bisher nur teilweise bearbeiteten Archivbestand zurück. Bisher wurden ca. 800 Briefe und Dokumente erfasst und übertragen. Größten Teils handelt es sich dabei um den handschriftlichen deutschen Schriftverkehr. Leider sind nur wenige italienische Schriftstücke in Übersetzung vorhanden. Dabei wäre gerade dieser Teil in Bezug auf die Bevölkerung in Rovinj aufschlussreich.
Obwohl nur wenige Zeugnisse aus dieser Zeit vorliegen, beginne ich mit den Jahren, bevor die Inseln von Georg Hütterott erworben wurden. Die Kenntnis der Familiengeschichte der Hütterotts erleichtert das Verständnis zu dem Leben auf S. Andrea. Ebenfalls eingeflossen sind die Informationen aus den drei Fotoalben mit Bildern aus den Jahren 1893 bis 1913, die von Hanna vermutlich in den zwanziger Jahren zusammengestellt wurden. Die ältesten Unterlagen (beginnend mit dem Jahre 1822) sind im Original nicht im Archiv in Rovinj erhalten, sondern wurden mir von der Bremer Linie zur Verfügung gestellt.
1822
Bei dem ältesten Dokument handelt es sich um einen Brief, den Rosalie Küchler am 13. Juni 1822 aus Hannoversch Münden an ihre Tochter Rosalie Noll schrieb. Bei ihr handelt es sich um Georgs Urgroßmutter der mütterlichen Seite. Der Großvater war nach dem Tode seiner Frau Amalie mit deren Schwester Charlotte Küchler in zweiter Ehe verheiratet. Nach den Schwestern Küchler wurden vermutlich Georgs Schwestern Amalie und Carlotta benannt. Mit seinem Vetter Küchler gründete Georgs Vater in Triest ein Handelshaus. Georg verkaufte den eigenen Anteil nach dem Tode seines Vaters an seinen Vetter Küchler, was vermutlich zum Streit mit seinen Schwestern führte. Die Familie Küchler ist noch heute in Triest nachweisbar.
1843
Einziges Dokument aus diesem Jahr ist eine Abschrift aus dem Taufbuch der Gemeinde zu Kassel aus dem Jahre 1793, in dem die Taufe des Georg Hütterott, erster Sohn des Kauf- und Handelsmannes George Hütterott und seiner Frau Marie, geborener Schaumberg am 8. September 1793 bestätigt wird. Zu welchem Zweck diese amtlich beglaubigte Abschrift 1843 ausgefertigt wurde, ist nicht bekannt. Sie könnte anlässlich des fünfzigsten Geburtstages des Täuflings entstanden sein. sein. Bei dem Täufling handelt es sich um Georgs Großvater (1793-1865). In der ebenfalls vorliegenden, gedruckten Todesanzeige wird Georg Hütterott als „Junior“ aufgeführt.
1845
Für dieses Jahr liegt von der Universität in Göttingen ein Zeugnis in naturwissenschaftlichen Fächern (besonders Chemie) für einen „Georg Hütterott aus Cassel“ für die Semester 1843 bis 1845 vor. Leider lässt sich wegen des fehlenden Geburtsjahres nicht feststellen, um welchen Hütterott es sich handelte, da alle drei Brüder den Vornamen „Georg“ trugen. Mit größter Wahrscheinlichkeit war es der Vater von Georg Hütterott, Georg Carl Hütterott (1821-1889) Interessant ist der Hinweis, dass sich der Student nicht an verbotenen studentischen Verbindungen beteiligt hat. Die Familie Hütterott hat sich demnach wohl schon immer von der Politik zurückgehalten.
1854
Für fast ein Jahrzehnt fehlen Unterlagen. Erst für dieses Jahr liegt ein Brief von Betty Küchler, der Stiefmutter von Georgs Vater vor. Für die Familiengeschichte ist der Briefinhalt belanglos, außer vielleicht der Hinweis, dass anlässlich der Geburt der Tochter Amalie „Tante Hannchen“ (von der sich aus späterer Zeit noch Briefe erhalten haben) der Wöchnerin beigestanden hat.
1856/1857
Im Archiv befinden sich für diese beiden Jahre wieder zwei Briefe zum Geburtstag von Theodor Hütterott in Bremen (dem jüngsten Bruder von Georgs Vater). Auch sie enthalten keine für den Triester Zweig interessanten Informationen und sind nur aus Gründen der Vollständigkeit dem Archiv beigefügt.
1860
Aus diesem Jahr existiert ein Dokument, das Marie Keyl, die spätere Frau von Georg Hütterott betrifft. Es handelt sich um einen vom Bürgermeister ausgestellten Auszug aus dem Geburts- oder Taufregister in Bordeaux. Es lässt sich nicht klären, ob diese Kopie für die Eheschließung von Marie und Georg in Frankfurt oder zur amtlichen Vorlage in Triest erstellt wurde.
1862
Die ältesten Dokumente, Georg Hütterott betreffend, sind Briefe Georgs vom 11. Juli und ein undatierter dieses Jahres an seinen Vater. Georg war 10 Jahre alt und schreibt aus Triest. Da der Inhalt des Briefes belanglos ist, wurde er sicherlich nur aus Sentimentalität und Erinnerung an die Kinderzeit aufbewahrt.
1863
Aus diesem Jahr hat sich ein Brief erhalten, den Georg Seybel aus Stuttgart an Georg schreibt. Da der Verfasser Georg das „Du“ anbietet, ist davon auszugehen, dass noch keine enge Freundschaft bestand. Der erwähnte Bruder Otto ist mehrfach mit seiner Ehefrau und Tochter auf S. Andrea gewesen. Da der Brief in Stuttgart verfasst wurde, Otto von seinem Vater nach Wien gebracht wurde, aber von Weihnachtsferien bei den Großeltern in Berlin gesprochen wird, dürfte es sich nicht um eine Familie aus Triest handeln. Soweit bekannt lebte die Familie Seybel vorwiegend in Wien. Aufschlussreich ist die Frage nach der schulischen Situation, ob Georg bereits in die Schule in Triest geht. Demnach ist Georg bis zum 10. Lebensjahr von Hauslehrern unterrichtet worden und erst mit 11 Jahren in eine öffentliche Schule, vermutlich Gymnasium, eingeschult worden. Es gibt auch einen ersten Hinweis auf Georgs Hobby des Briefmarkensammelns. Ein „Onkel Julius“ aus Hamburg verspricht ihm die Zusendung Hamburger Briefmarken. Zu diesem Onkel scheint aber kein Verwandschaftsverhältnis bestanden zu haben, da ein Familienmitglied dieses Namens aus der Chronik nicht bekannt ist.
1864
Das interessanteste Dokument dieses Jahres ist ein Brief von Otto Seybel aus Wien. Darin wird ein Brief erwähnt, den seine Mutter an Georgs Schwester Carlotta schreibt, vermutlich zu deren zehnten Geburtstag. Im Auftrage des Vaters bedankt sich Otto Seybel für die freundliche Bewirtung der Eheleute Siemens aus Berlin, die eine Reise nach Triest und Venedig unternommen hatten. Vielleicht lässt sich klären, ob es sich dabei um den Industriepionier Werner von Siemens handelte, der zwei Jahre vorher die Dynamomaschine erfunden hatte.
Von Georgs Mutter Rosalie sind aus diesem Jahr zwei Briefe erhalten, die sie von einer Reise über Mailand, Zürich, Baden-Baden nach Frankfurt schreibt. In Kassel werden die Großeltern besucht. Außer der Reisebeschreibung erfahren wir, dass Eva (vermutlich die Köchin) einen schönen Hummer kaufen und an Gustav Schoeller nach Wien senden soll. Dabei könnte es sich bereits um die Familie Schoeller handeln, zu der später ein reger Kontakt besteht und der Hanna noch bis in die Zeit des 2. Weltkrieges verbunden war. Eine Verbindung über drei Generationen!
1865
Am 11. Dezember dieses Jahres verstarb nach einem langen Leiden Georgs Mutter. Die gedruckte Grabrede des Pfarrers Dr. E. Buschbeck hat sich in einem gedruckten Exemplar in der Königlichen Bibliothek Berlin erhalten.
Georg hat den Brief eines Freundes erhalten, der in einer Kadettenanstalt in Marburg ausgebildet wird. Georg scheint sich für diese Ausbildung zu interessieren, da sein Freund ihn ausführlich über den Lehrplan informiert. In den Briefen von 1863 erfahren wir, dass Georg Briefmarken sammelt und mit dem Briefpartner tauscht. In diesem Brief erfahren wir, dass er eine Pflanzensammlung anlegt. Dies scheint der früheste Hinweis auf seine späteren Aktivitäten zu sein. Nach seiner Weltreise verfasst er ein Büchlein über den Tee- und Baumwollanbau. In Triest fördert er intensiv die Fischzucht und die Fischereiwirtschaft. In Rovinj legt er den Naturpark mit fremdländischen Gewächsen an, einen kleinen botanischen Garten, der sicherlich auch eine Attraktion in der geplanten Ferienanlage werden sollte.
Der größte Teil der aus diesem Jahr vorhandenen Briefe stammt aus der Zeit eines Kuraufenthaltes Georgs mit seiner Mutter in Bad Gleichenberg (Steiermark). Seine Mutter scheint an einer ernsthaften Lungenerkrankung (Tbc?) zu leiden, an der sie vermutlich im darauf folgenden Jahr auch verstirbt. Aber auch Georg selber scheint eine medizinische Betreuung benötigt zu haben, wie einigen Briefpassagen zu entnehmen ist.
Aus den Beständen des Familienarchivs der Bremer Linie wurde die Kopie der Todesanzeige von Georgs Großvater in Kassel dem Rovinjer Archiv beigefügt. In der gedruckten Anzeige werden nach der Witwe Georgs Eltern und Georg mit dem Zusatz „junior“ aufgeführt. Nicht genannt werden Georgs Schwestern Amalie und Carlotta. Es hat den Anschein, dass Georg bereits für die Rolle des Familienoberhauptes vorgesehen ist, die ihm aber auf dem Familientag in Berlin (1899) von der Kasseler Linie (vermutlich wegen des Fehlens männlicher Nachkommen) streitig gemacht wird.
Es liegt auch ein „Liebesbrief“ von einer Ellen Jones vor, die sich für Haare von Georg bedankt und auch gerne von ihm am Abend nach Hause gebracht werden möchte. Der Brief ist mit dem Nachsatz versehen „Zeige Niemanden diesen Brief u. zerreiße ihn sobald Du es gelesen hast“. Das ist aber nicht geschehen. Von fremder Hand wurde 21/Dec. 65. auf dem Brief notiert. Vermutlich wurde dieser Brief als eine Erinnerung an seine „erste Liebe“ von Georg aufbewahrt.
1866
In diesem Jahr starb nach langem Leiden Georgs Mutter. Die von dem Pfarrer der Helvetischen Gemeinde gehaltene Grabrede wurde in gedruckter Form veröffentlicht. Aus diesem auch für die deutschösterreichische Beziehung schicksalhaften Jahr berichtet Graf Kielmansegg. Der Graf scheint ein Freund des Vaters gewesen zu sein (sich vielleicht auch nach dem Tode der Mutter besonders um Georg gekümmert zu haben). Die Situation scheint für die Familie Hütterott zwiespältig gewesen zu sein, da sie aus Deutschland stammt, aber in Österreich lebt. Georg möchte, dass die Italiener tüchtig „verhauen“ werden sollen, obwohl gleichzeitig die Niederlage der Österreicher in der Schlacht von Königgrätz bejammert wird. Die Familie scheint aber immer mehr der deutschen Seite zugeneigt gewesen zu sein. Selbst Hanna, die mit einem österreichischen Ministerialbeamten verheiratet war, begrüßte den Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich. Zu der Familie des Grafen Kielmansegg hat mindestens bis 1911 Kontakt bestanden, da in den Alben Fotos von einem Besuch in der Villa Kielmansegg in Hohe Warte vorhanden sind.
1867
Am 3. November schreiben die beiden jüngeren Schwestern Amalia und Carlotta einen Brief an ihren Bruder. Georg hat sich in dieser Zeit in Braunschweig aufgehalten, wo er das „Günthersche Institut“ besuchte. Es hat den Anschein, dass es sich um ein „Pflichtschreiben“ an den Bruder handelte, denn die Briefe sind mit wenig Anteilnahme geschrieben. Sie enthalten auch keine Neuigkeiten, die für den abwesenden Bruder von besonderem Interesse gewesen wären. Vermutlich wurden sie von der Familie als ein Relikt aus der Jugendzeit des Vaters aufbewahrt. Amalie redet den Bruder mit „Süßes Görgchen“ an, eine Verniedlichung von Georg, während Carlotta ihn „Lieber Schneck“ tituliert, vermutlich ein kindlicher Spitzname. Über das Verhältnis Georgs zu seinen beiden Schwestern habe ich nichts in Erfahrung bringen können. Es scheint aber nicht ganz spannungsfrei gewesen zu sein.
Es scheint angebracht, hier einen Exkurs über die Schule in Braunschweig einzufügen, da sie eine Sonderstellung in der deutschen Schullandschaft einnahm.
Das 19. Jahrhundert kann als ein „Jahrhundert der Schulen“ bezeichnet werden, mit einer Abkehr von der alten „Lateinschule“ zur „neuhumanistischen Bildung“ mit besonderer Ausrichtung auf Mathematik und Fremdsprachen. Ziel war ein erreichbarer Abschluss, ähnlich der „mittleren Reife“ für etwa 16-jährige bis zur Hochschulreife.
Hermann Günther, Sohn eines Landpfarrers, der Gründer des „Instituts“ war schon als Schüler und Theologiestudent Anhänger der Revolutionspartei und floh 1833 vor den „Demagogen Verfolgungen“ in die Schweiz. Dort lernte er als Lehrer ein Schulwesen kennen, das in Europa einzigartig war und zum Pilgerziel vieler Pädagogen wurde. Seine politische Vergangenheit belegte ihn noch nach seiner Rückkehr nach Deutschland 1849 praktisch mit einem „Berufsverbot“. Ausgeschlossen von einer Anstellung im öffentlichen Schulwesen blieb ihm nur die Stellung als Privatlehrer. Seine schnell anwachsende Familie, er hatte inzwischen 6 Kinder, veranlasste ihn eine Privatschule zu gründen da die Bezahlung als Privatlehrer kein ausreichendes Einkommen ermöglichte.
In den Gymnasien waren in den ersten Schuljahren 20 von 35 Unterrichtsstunden dem Erlernen alter Sprachen (Latein und Griechisch) gewidmet. Von den Römern und Athenern sollten die Schüler „Bürgertugenden“ erlernen. Mathematik und Naturwissenschaften wurden vernachlässigt.
Hermann Günther gründete bereits in seiner Schulzeit in Wolfenbüttel die Turngemeinde, die nach den Regeln des Turnvaters Jahn die Körperertüchtigung, Freiheit und Gleichheit fördern sollte. Zu dieser Zeit wurden die Turnvereine in Preußen verboten, weil „das Turnen dem Körper mehr schade als nütze, und weil es ein wildes und aufrührerisches Geschlecht ausbilde“. 1830 begann Günter in Göttingen das Theologiestudium, in einer Zeit politischer Spannungen und Aufruhr. 1830 wurden die Bourbonen in Frankreich endgültig vom Thron vertrieben, 1831 wurde das konstitutionelle Königreich Belgien nach einem Aufstand in den südlichen Niederlanden errichte. Auch fing 1830 der große Freiheitskampf der Polen gegen den russischen Zaren an, der in ganz Europa mit lebhafter Anteilnahme verfolgt wurde. In seinem Heimatland Braunschweig wurde der regierende Herzog gestürzt. Ihm folgte der praktisch vom Volk gewählte Herzog Wilhelm, der mit seinen Untertanen eine für die damalige Zeit sehr liberale Verfassung vereinbarte. Auch Aufstände in Sachsen und Kurhessen führten in diesen Ländern 1830 zu Verfassungen. Eine nationale Revolution in Mittelitalien wurde in diesem Jahr von österreichischen Truppen niedergeschlagen. Politische Schwierigkeiten als Burschenschaftler und Anhänger des Turnvaters Jahn ließen Günther nach 2 Semestern an die Universität Jena wechseln, der Geburtsstätte der Burschenschaften. Weitere Stationen seines Theologiestudiums waren die Universitäten von Marburg und Heidelberg. An all diesen Universitäten war er Mitglied von Burschenschaften. Gegen ihn eingeleitete Untersuchungen veranlassten Günther 1833 in die Schweiz zu flüchten und dort um Asyl nachzusuchen, damals das beliebteste Asylland Europas. Er nahm das Theologiestudium zwar wieder auf, zweifelte aber, ob der Beruf des Pfarrers wohl der richtige für ihn sei. In der Züricher Universität traf er auf ein viel weiter gestecktes Studium als an den deutschen Universitäten. Er entschloss sich, sich der Pädagogik zuzuwenden. Nach Beendigung der Ausbildung fand er auch eine Anstellung als Lehrer.
1849 kehrte Günter nach Braunschweig zurück, um dort Lehrer zu werden, mit dem Wunsch, an der Verbesserung des bürgerlichen Bildungswesens mitzuarbeiten. Noch im Jahre seiner Rückkehr legte er das Examen als Gymnasiallehrer ab. Er erhielt wegen seiner politischen Vergangenheit aber nur eine befristete Anstellung, die Beförderungen ausschloss. Fast 10 Jahre dauerte dieser Lebensabschnitt als Gymnasiallehrer. 1861 promovierte er, was ihm aber keine finanziellen Vorteile brachte, derer er wegen seiner großen Familie so dringend bedurft hätte. Da er keine Verbesserung seiner wirtschaftlichen Lage sah, beschloss er die Gründung einer eigenen Schule.
Anfang des Jahres 1861 veröffentlichte Hermann Günther in den „Braunschweigischen Anzeigen“ seinen „Prospect seiner privaten Lehranstalt“, die zu Ostern eröffnet werden sollte. Als Lehrplan wurden aufgeführt: Deutsch, englische und französische Sprache, Rechnen, Mathematik, Physik, Naturgeschichte, Geographie, Geschichte, Buchführung, Kalligraphie, Hand- und Planzeichen. Die Besonderheit dieses Lehrangebotes war nicht nur die Vielfalt der Unterrichtsfächer, sondern die Möglichkeit für die Schüler, die Fächer nach Neigung frei zu wählen.
Es ist zwar nicht bekannt, für welche Fächer Georg sich entschieden hat, jedenfalls hatte er die Möglichkeit, eine Bildung zu erlangen, die weit über das seinerzeit Übliche hinausging. Heute würden wir sagen, dass er eine „internationale Managerschule“ besuchte. Die Wahl dieser außergewöhnlichen Schule zeigt die Weitsicht des Vaters, seinem Sohn das zu geben, was für die Weiterführung des väterlichen Geschäftes und dessen Ausbau zu einem internationalen Handelshaus, wie es derer einige in Triest gab, erforderlich war. An die Schulzeit in Braunschweig schloss sich eine kaufmännische Lehre in Antwerpen an, der sich dann bei einem kurzen Aufenthalt in Triest, bei dem er das Gelernte im väterlichen Geschäft in die Praxis umsetzen konnte, eine Weltreise anschloss. Als Georg 1876 endgültig nach Triest zurückkehrte, kann in ihm ein außergewöhnlich umfangreich ausgebildeter Kaufmann gesehen werden. Es zeigt sich dann aber, dass ihm das Geschäft des Vaters zu eng ist und er größere Aufgaben anstrebte, was er letztendlich nach dem Tode des Vaters auch tat, indem er das väterliche Handelshaus an seine Vettern Küchler verkaufte und in die Direktion des Stabilimento Tecnico eintrat, des damals größten Unternehmens in Triest, und es dort bis zum Vorsitzenden des Direktoriums brachte. Wie erfolgreich er letztendlich war, ist nicht bekannt. Dazu müsste die Geschichte der Werft unter der Leitung von Georg von Hütterott untersucht werden.
Es liegen mehrere Briefe von Freunden vor, bei denen sich leider nicht feststellen lässt, wohin sie an Georg adressiert wurden. Der Freundeskreis scheint sich zu diesem Zeitpunkt aufgelöst zu haben, denn die Verfasser schreiben aus verschiedenen Orten. Die wohl gleichaltrigen Freunde besuchten genau wie er auswärtige Schulen, wobei nicht geklärt ist, ob es sich dabei um eine Modeerscheinung handelte, oder ob das weiterführende Bildungsangebot in Triest so schlecht war, dass externen Schulen der Vorzug gegeben wurde Eine Möglichkeit wäre auch, dass er als Protestant vom katholischen Bildungsangebot in der der Stadt ausgeschlossen war und darum wie auch seine nichtkatholischen Freunde im Ausland seine Ausbildung fortsetzte. Im Januar hat Georg noch die „Realclasse“ in Triest besucht. Im September schreibt ihm seine Tante Amalie Coester aus Frankfurt, dass er sich melden soll, wenn er in Braunschweig eingetroffen ist. Aus den Briefen erfahren wir aber einiges über Georgs Beschäftigungen. So scheint er in einem Ruderclub gewesen zu sein, hat Käfer gesammelt und Cello gespielt. Das Musizieren scheint er später aber gänzlich eingestellt zu haben, denn es liegen keine Mitteilungen über ein musikalisches Interesse vor.
1872
Im März dieses Jahres schreibt ein „getreuer Johann“ an Georg. Leider lässt sich aus dem Brieftext aber nicht ersehen, wo sich Georg aufhielt. Der Familienchronik können wir entnehmen, dass Georg 1869 von seinem Vater zur weiteren Ausbildung zu einem Geschäftsfreund namens Schmidt nach Antwerpen geschickt wird. Von dort beobachtet er den deutsch-französischen Krieg. Wer sich hinter dem Namen „Johann“ verbirgt, kann nicht festgestellt werden. Dem Inhalt des Briefes nach muss es sich um einen Verwandten handeln, vielleicht einen Küchler, der Partner seines Vaters war und dessen Söhnen er das väterliche Geschäft überträgt. Jedenfalls erhält Georg genaue Anweisungen, wie er seine Rückreise nach Triest zu gestalten hat und welche Familienmitglieder er besuchen soll. Auch bekommt er Adressen, wo er sich Geld für die Weiterfahrt leihen kann. Zu einer Zeit, als die Kreditkarte das Reisen noch nicht vereinfachte, war das eine sehr wichtige Information. Es zeigt aber auch die Strukturen innerhalb der Familie. Hilfe wurde geboten und es gab Möglichkeiten der Verrechnung. Erinnern wir uns, dass es zu dieser Zeit in Deutschland noch keine einheitliche Währung gab. Diese Rückreise wird aber auch zur Festigung bestehender Geschäftsverbindungen genutzt. So soll Georg Herrn Eichhoff in Essen besuchen, der Direktor bei Krupp ist. Vielleicht wurde bei dieser Gelegenheit die Verbindung zu Arthur Krupp geknüpft, dem Leiter der österreichischen Kruppniederlassungen. Am 1. Februar erhält er durch Vermittlung einer Frau E. Königs eine Einladung zum Ball bei den „Eheleuten Lynen“. Da Begleitschreiben ist von Frau Königs mit dem Zusatz „geb. Günther“ versehen. Es könnte sich somit um eine Tochter seines Schuldirektors handeln, womit auch belegt wäre, dass die Ausbildung in Braunschweig auch Türen im Ausland öffnete.
Von den nachfolgenden Jahren sind bisher noch keine Dokumente aufgefunden worden. Besonders Unterlagen über die Weltreise Georg Hütterotts würden sicherlich eine Menge Informationen zu seinem späteren Lebensweg und seiner beruflichen Entwicklung geben.
1879/1880
Aus diesem Jahr liegen uns die ältesten Dokumente des Ehepaares Marie und Georg Hütterott vor, nämlich zwei Rechnungen, die die Ausstattung des jungen Hausstandes betreffen. Das Ehepaar heiratete im September 1879 in Frankfurt/M. Am 20. November dieses Jahres wurde von der Hof- und Kunsttischlerei Alexander Albert in Wien eine Rechnung über die Lieferung eines Speisezimmers, das u.a. aus einem Tisch, ausziehbar für 18 Personen und 12 Speisesesseln bestand, ausgestellt. Die Firma Anton Fix aus Wien stellte im Januar 1880 eine Rechnung für die Lieferung des Schlafzimmers, Ergänzungen zum Speisezimmer, Wohnzimmer, Salon und Fremdenzimmer aus. Wie aus der Familienchronik bekannt ist, bezog das junge Paar kein eigenes Haus in Triest, sondern zog zum verwitweten Vater in die „Villa Adele“. Es ist erstaunlich, dass die neuen Möbel in Wien gekauft werden, und nicht in Triest, obwohl die Stadt zu dieser Zeit schon zu den größten und vornehmsten Städten der Donaumonarchie gehörte und sicherlich auch über entsprechende Handwerksbetriebe verfügte.
Marie von Hütterott hat diese Rechnungen wahrscheinlich aus Sentimentalität aufgehoben.
Das bedeutendste Ereignis für die Familie Hütterott war sicherlich die Ernennung Georgs zum ersten (und auch jüngsten) Konsul Japans in Europa. Auf seiner Weltreise hatte er sich auch längere Zeit in Japan aufgehalten und dort in Kontakt zu Wirtschafts- und Regierungskreisen gestanden. Georgs Vater war in Triest Konsul von Peru.
1882
Für dieses Jahr liegt ein von Hanna kopierter Brief ihres Großvaters Albert Keyl vor. Er hat Tochter und Schwiegersohn in Triest besucht und das neue Heim (gemeint sind wohl die Wohnräume des Ehepaares in der „Villa Adele“) inspiziert und nach der Enkeltochter Hanna gesehen. Auf der Rückreise über Wien (nicht ungewöhnlich, denn es gab eine direkte und sehr bequeme Eisenbahnverbindung Triest-Wien) besucht er Baron von Sigmundt und Otto und Paul Seybel. Diese Namen tauchen später auch im Gästebuch auf. Seybels scheinen Freunde gewesen zu sein, während Georgs Schwester Amalie mit Eduard von Sigmundt verheiratet war. Da Eduard als Kaufmann in Triest genannt wird, könnte der im Brief erwähnte Baron Sigmundt dessen Vater sein. Auch Vater Keyl scheint auf die Verbindungen der Hütterotts in Triest zurückgegriffen zu haben. Da er ein international tätiger Kaufmann war, sah er in solchen Verbindungen sicherlich auch geschäftliche Vorteile.
Hochzeit Georgs Schwester Amalia mit Edmund von Sigmundt
1885
Ein größeres Konvolut an Briefen liegt für dieses Jahr vor, die Monate Januar bis September umfassend. Von den drei fehlenden Jahren verbrachte das Ehepaar zwei Jahre auf einer Fernostreise. Aus Gesundheitsgründen hatte ein Schweizer Spezialist Georg eine längere Reise in südlichere Gefilde empfohlen. Ich bezweifele den medizinischen Sinn dieser Reise, sondern vermute eher, dass Georg einen Grund suchte, noch einmal eine große Reise nach China und Japan zu unternehmen, Länder, die schon bei der Weltreise sein besonderes Interesse fanden.
Er konnte sicher sein, dass der Vater für den Fortgang der Geschäfte sorgen würde, die er später immer noch übernehmen könnte. Es verwundert allerdings, dass die Eltern ihre erst zwei Jahre alte Tochter in der Obhut des Großvaters zurücklassen. Sicherlich war der Großvater im Umgang mit Kindern nicht ungeübt, hatte er doch seine Frau verloren, als Georg erst 12 Jahre und die jüngste Tochter 7 Jahre alt waren.
Einige Korrespondenz stammt von Freunden, die auf der Reise in Japan und Hong Kong gewonnen wurden. Diese Briefe sind sowohl in Deutsch wie auch in Englisch verfasst. Die Bekanntschaften haben sich demnach nicht nur auf die Deutsche Kolonie beschränkt. Mit Ausnahme von Curt Netto wurden diese Kontakte aber nicht über einen längeren Zeitraum fortgesetzt. Diese Briefe sind aber informativ, was das Leben der Deutschen im Fernen Osten betrifft.
Den Briefen der Familienangehörigen ist zu entnehmen, dass besonders Marie wohl einen sehr intensiven Briefwechsel geführt hat. Neben viel Familienklatsch erfahren wir aber auch, dass Hanna bereits 1885 von ihrer Mutter Klavierunterricht erteilt bekam. Besonderes musisches Interesse scheint dabei aber wohl nicht geweckt worden zu sein, denn spätere Beschäftigung mit Musik lässt sich den Briefen nicht entnehmen. Die Großmutter in Frankfurt, wie auch die dort wohnenden Carlotta und Clara berichten ausführlich über Opern- und Konzertbesuche. Bei einigen Briefen handelt es sich auch um Glückwünsche zu Maries Geburtstag. Auffallend ist, dass sehr viele Briefe zu den Geburtstagen Marie Hütterotts am 5. Juni erhalten geblieben sind. In diesem Jahr ist das Hauptthema natürlich die Rückkehr nach Triest und die gemeinsame Feier mit der inzwischen fünfjährigen Hanna. Aus dem Mai dieses Jahres liegt auch der erste Brief von Elsie Metzler, der späteren Frau von Wendland vor, die die interessantesten Briefe schreibt und eine sehr genaue Beobachterin der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse in Europa ist. Leider haben sich von ihr nur wenige Schreiben erhalten. 1895 heiratet auch die Schwester Emma, von der sich im Archiv eine große Zahl von Briefen erhalten hat.
1886
Die ersten Briefe dieses Jahres stammen aus Hong Kong von verschiedenen Absendern. Aber alle bedanken sich für Weihnachtsgeschenke. Demnach haben Hütterotts ihre Freunde dort mit ausgefallenen Gaben bedacht. Nur in einem Brief wird das Geschenk erwähnt, nämlich ein Kissen für das Sofa. Die anderen Beschenkten hüllen sich in Schweigen. Diese Dankesbriefe bieten dann für die Verfasser die Gelegenheit, über das Leben in der Kronkolonie zu berichten. Wir erhalten dadurch einen Einblick, womit sich die deutsche Kolonie beschäftigte und die Zeit vertrieb. Der letzte Brief aus dem Fernen Osten datiert aus dem Oktober 1886. Die Kontakte scheinen eingeschlafen zu sein. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass viele Briefe aus dieser Zeit zu den Verlusten zählen. Jedenfalls ist keiner der Briefpartner im Gästebuch vermerkt. Im Januar 1888 meldet sich ein Herr Schönberger noch einmal, allerdings aus Wien, um den Hütterotts seine Rückkehr nach Europa mitzuteilen.
Die Briefe der Familienmitglieder, hauptsächlich von der Mutter in Frankfurt, sowie den Schwestern Emma und Clara, befassen sich mit den häuslichen Problemen, dem Nachwuchs, Krankheiten und dem Ärger mit dem Personal. Clara lebte in Frankfurt, wo ihr Mann Teilhaber des Bankhauses Metzler & Cie. war. Emma war mit ihrem Mann nach Trieb bei Lichtenfels in Oberfranken gezogen, wo vom ihm das Gut „Berghof“ bewirtschaftet wurde. Walter Benecke, der Schwager, hatte Landwirtschaft studiert und übernahm dieses Gut von seinem Vater, einem in England tätigen Kaufmann, der es schon Jahre vorher erworben hatte. In den Briefen der Mutter wurde dieses Anwesen immer als „Schloss“ bezeichnet, eine vielleicht nicht ganz zutreffende Bezeichnung, wenn mit Schloss der Sitz eines Herrschers gemeint ist. Es handelte sich aber um ein sehr stattliches Gebäude, das auch über entsprechende Gesellschaftsräume verfügte. Louise Keyl war jedenfalls sehr beeindruckt und verhehlt in den Briefen auch nicht ihren Stolz über diesen Besitz ihrer jüngsten Tochter. Vielleicht war Berghof ein Ansporn für Georg Hütterott, sich mit dem Erwerb von Obersontheim und S. Andrea ein entsprechendes Ansehen in der Familie zu erkaufen. Die Nobilitierung des Triester Familienzweiges scheint die engeren Familienmitglieder aber nicht besonders beeindruckt zu haben. Immer wieder wird auf Georgs Gesundheit Bezug genommen, der sich wohl ein chronisches Lungenleiden zugezogen hat. In den Wintermonaten war er vermutlich längere Zeit an das Haus gefesselt. Da Triest mit seiner Buchtlage und den umgebenden Bergen, die das feuchte Klima regelrecht speichern, für eine Erkrankung der Atemwege ein ungünstiger Platz ist, könnte der Kauf der Cissa-Inseln und die Pläne des Baues einer mondänen Ferienanlage mit den gesundheitlichen Problemen in Verbindung stehen.
Mit den Briefen scheinen auch immer Fotos der Kinder ausgetauscht worden zu sein, denn immer wieder wird darauf Bezug genommen. Alle vier (Marie und ihre beiden Schwestern Clara und Emma, sowie auch Georgs in Frankfurt lebende Schwester Carlotta) hatten inzwischen Kinder in annähernd gleichem Alter. Dadurch nehmen die Berichte über das Gedeihen der Sprösslinge, wie auch die Widrigkeiten des Zahnens und der üblichen Kinderkrankheiten einen breiten Raum ein. Unter den Geburtstagsgrüßen für Marie befindet sich auch einer von Röschen Hütterott. Bei ihr handelt es sich um eine Cousine Georgs, die mit ihren Eltern in Kassel lebt. Marie hat demnach auch Kontakte zu der übrigen Familie ihres Mannes gehalten. Aus späteren Jahren sind keine Briefe mehr vorhanden. Entweder handelt es sich wieder um Kriegsverluste, oder die Verbindungen wurden abgebrochen. Ich vermute Letzteres.
Besonders interessant sind die Briefe, die über die Hochzeit Elsie Metzlers berichten. Sie zeigen uns heute, wie die Frankfurter Gesellschaft zu dieser Zeit lebte und ihre Feste feierte. Marie konnte an diesem Fest nicht teilnehmen, was von der Braut sehr bedauert wurde. Leider können wir nicht feststellen, was diesmal einer Reise nach Frankfurt im Wege stand, da häufiger Besuche bei der Familie in Deutschland unternommen wurden.
In diesem Jahr ist auch Curt Netto nach Deutschland zurückgekehrt und meldet sich von nun an regelmäßig mit Briefen aus den verschiedensten Orten. Er scheint einer der langjährigen Freunde zu sein und besucht S. Andrea jedes Jahr bis 1907, zwei Jahre vor seinem Tode.
1887
Aus diesem Jahr liegen 25 Briefe vor. Nach dem Aufenthalt in Japan hat sich die Familie Hütterott wieder in Triest eingelebt. Der Kontakt (mit Ausnahme von Curt Netto und Richard Schönberger) zu den Freunden aus der Zeit des Fernostaufenthaltes scheint abgebrochen zu sein. Bei den vorhandenen Briefen handelt es sich um Nachrichten der Familie, die aber wenige Informationen über das Leben der Hütterotts in Triest verraten. In Bezug auf das Gästebuch ist ein Brief von Röschen Hütterott aus Bremen interessant. Sie besucht, vermutlich in Verbindung mit der Familie Vietor, Bekannte, Freunde oder vielleicht auch entfernte Familienmitglieder in England. Dabei wird von ihr auch Capt. Drury und seine Frau erwähnt. Der Captain wird später Admiral der britischen Mittelmeerflotte und besucht S. Andrea zusammen mit seiner Frau 1908. Es handelte sich bei diesem Besuch nicht um einen Zufall, sondern es war die Fortsetzung einer bereits über zwanzig Jahre vorher begonnenen Verbindung. Vielleicht war auch Hanna bei ihrem Aufenthalt in Bedford bei Drurys zu Gast gewesen.
Hervorzuheben ist ein in Englisch verfasster Brief. Vermutlich wurde er von der Tochter des Tiermalers Friedrich Wilhelm Keyl (1823 Kassel – 1871 London) an Marie geschrieben. Sie ist eine Cousine. Die beiden Frauen haben einander vielleicht bei dem Aufenthalt in London persönlich kennen gelernt. Die Familie Keyl war von Bordeaux nach London gezogen, vielleicht auf Vermittlung des genannten Tiermalers. Das Bürgerregister von Frankfurt vermerkt für Keyls „zugezogen aus London“. Spätere Treffen der beiden Cousinen sind nicht belegt. Auch scheint Hanna sie bei ihrem Aufenthalt in Bedford (1899) nicht besucht zu haben, da sonst sicherlich Fotos in den Alben vorhanden wären.
1888
Auch aus dem so genannten „Dreikaiserjahr“ haben sich viele Briefe erhalten, wobei der größte Teil auf die Korrespondenz mit der Familie entfällt. Der erste Brief stammt vom 6. Januar, und der letzte wurde am 29. Dezember geschrieben. Georgs Cousine „Röschen“ aus Bremen bedankt sich bei Marie für eine Geschenksendung von Wild, das sie mit weiteren Familienmitgliedern gegessen hat. Georg Hütterott sen. hat demnach seinen Bruder zu Weihnachten bedacht. Leider lässt sich nicht klären, ob es sich um erlegte Tiere aus der eigenen Jagd, oder um in Bremen gekauftes Wild handelte. Marie von Schwerzenbach schreibt einen Brief aus Algier, wo sie mit ihrem Mann die Wintermonate verbracht hat. Sie erwähnt dabei, dass Georg und ihr Mann so gute Korrespondenten seien und sie darum nicht so viel schreiben müsste. Das ist insofern erstaunlich, da sich im Archiv keine Briefe von Georg, oder ganz wenige an Georg erhalten haben. Es liegt die Vermutung nahe, dass die Ehepaare ihren Schriftverkehr trennten und die Briefe des Hausherrn nicht mit nach S. Andrea genommen wurden. Durch die Bilder von der „Villa Adele“ wissen wir, dass Marie dort über ein „Schreibzimmer“ verfügte. Georg könnte seinen Schriftverkehr in seinem Büro abgewickelt haben. Dafür spricht z.B., dass die Samariterstiftung in Stuttgart einen mit Schreibmaschine geschriebenen Brief anlässlich der Verleihung des „Olga-Ordens“ erhalten hat. Vielleicht war, wie bei vielen, auch bei Georg Tradition, am Jahresende die Korrespondenz noch einmal zu sichten und dann zu vernichten. Das würde das Fehlen erklären.
Die Briefe scheinen innerhalb der Familie rege ausgetauscht worden zu sein, denn die Mutter Keyl, Emma, Clara, Carlotta und die Großmutter Hoffmann (die Mutter von Louise Keyl) nehmen regelmäßig Bezug auf die Schreiben aus Triest an die anderen Familienmitglieder.
Zwei Briefe haben sich erhalten, die in Italienisch verfasst und an Georgs Vater gerichtet sind. Inhaltlich geht es um sein Ausscheiden aus der Parlamentsarbeit. Demnach war auch er, wie später sein Sohn politisch im Wiener Parlament tätig und vertrat dort die Provinz Triest. Georg scheint einige dieser Ämter „geerbt“ zu haben. Sicherlich hat Georg Hütterott sen. viele Türen für seinen Sohn geöffnet.
Clara erwähnt in ihrem Brief vom 9. Juni 1888 eine kleine Bootsfahrt, die Hütterotts mit ihrem Segelboot unternommen haben. Dabei dürfte es sich um den Kutter „Nippone“ handeln, den Georg nach seiner Rückkehr aus Japan erworben hatte (daher sicherlich auch der Name). Marie berichtet nie über Reisen mit dem eigenen Boot. Im Gästebuch wird später die „Suzume“ erwähnt, meistens mit An- und Abreise von der Insel. Der Name „Suzume“ ist japanisch und bedeutet „Spatz“. Georg scheint seinen Booten immer japanische Namen gegeben zu haben, womit er vielleicht seine Bedeutung als Konsul dieses Landes unterstreichen wollte. Überhaupt wird selten von Reisen berichtet. Durch die zwei aufgetauchten Fotoalben sind wir aber über eine rege Reisetätigkeit in den Jahren von 1893 bis 1914 unterrichtet.
Im Privatbereich erfahren wir, dass Hanna keine öffentliche Schule besucht, sondern von ihrer Mutter privat unterrichtet wird. Sicherlich hätten Hütterotts sich einen Hauslehrer leisten können. Es hat aber den Anschein, dass Hanna nicht besonders „helle“ war. Auffallend ist, dass das Thema „Ausbildung“ in den Briefen vermieden wird. Wenn Hanna Erwähnung findet, dann meistens wegen ihres netten Aussehens, wie sie wieder gewachsen ist und dass sie vortrefflich mit ihren Vettern spielen könnte. In einem Brief vom 22. Dezember dieses Jahres erwähnt Emma Benecke, eine Schwester von Marie Hütterott, die Erkrankung des Vaters von Georg, der vier Wochen später verstarb.
Ronald Keyl, der später die Weinhandlung von Maries Vater in Bordeaux übernahm, besuchte das Ehepaar Hütterott in Triest. Es scheint sich aber keine engere Beziehung gebildet zu haben, denn spätere Kontakte sind nicht bekannt. Das ist erstaunlich, denn der Vetter hat die Mutter, Luise Keyl, regelmäßig in Frankfurt besucht und auch Emma Benecke auf Berghof. Es hat den Anschein, dass familiäre Kontakte nicht gepflegt wurden. Vielleicht weil Teile der Familie nicht als nicht mehr „ebenbürtig“ angesehen wurden
1889
Für dieses Jahr liegen nur fünf Briefe vor. Den interessantesten hat Curt Netto aus London geschrieben. Dort hatte er sich schon im Vorjahr, aus Essen kommend, wo er Kontakt zur Firma Krupp aufgenommen hatte, niedergelassen, um eine Unternehmung im Bereich der Aluminiumherstellung oder -veredlung zu gründen. Aus dem Bestand des Bremer Archivs wurde die gedruckte Trauerrede auf Carl Hütterott, vom evangelischen Pfarrer in Triest am 26. Januar am Sarge des Verstorben gehalten, dem Bestand in Rovinj beigefügt. Aus dem Inhalt können wir einige Informationen über den Lebensweg und Charakter des Verstorbenen erfahren. Da es sich aber um eine Trauerrede handelt, ist eine gewisse Skepsis angebracht. Interessant ist, dass diese Trauerrede vom Österr.-ungar. Lloyd herausgegeben und auch in dessen Druckerei hergestellt wurde. Damit ist belegt, dass bereits der Vater von Georg starke Verbindungen zur Seefahrt in der Adria hatte und diese nicht erst durch seinen Sohn aufgenommen wurden. Die Verbindung zum Freiherrn von Lutteroth, einem der Gründer des Lloyd, stammte sicherlich von Carl Hütterott. Der Tod des Vaters hat Georgs Leben einschneidend verändert. Er behält zwar das Haus in Triest bei, die „Villa Adele“, trennt sich aber vom Handelsgeschäft seines Vaters und überträgt es an seinen Vetter Küchler, um sich vorwiegend seiner Tätigkeit im Stabilimento Tecnico zuzuwenden. In der Phase dieser Neuorientierung scheint es auch zum Zerwürfnis mit seinen Schwestern gekommen zu sein. Nicht auszuschließen ist eine Auseinandersetzung um das Erbe.
1890
Aus diesem Jahr hat sich nur eine Unterlage erhalten. Dabei handelt es sich um einen Brief vom 10. August, verfasst von Alfred Escher, dem Verkäufer der Inseln. Es handelt sich um ein sehr kurzes und distanziertes Schreiben, in dem es um die Räumung von Produktionsanlagen geht. Im August hatte Georg die „Cissa-Inseln“ von Escher erworben und vermutlich sofort mit der Wiederherstellung der Klosteranlage begonnen. Wie weit er in den Baubestand eingegriffen hat, ist nicht bekannt. Die Struktur der Klosteranlage ist in der Anordnung der Gebäude noch zu erkennen. Die Veränderungen im Inneren sind nicht nachvollziehbar.
1891
Ab jetzt wird das Gästebuch von S. Andrea der „Rote Faden“ sein, die Unterlagen des Hütterott-Archivs werden erklärend hinzugezogen.
Der Titel -„CISSA INSEL“- in verblasster Goldprägung auf dem Buchdeckel, von Arabesken umgeben, ist irreführend und auch ungebräuchlich, denn es handelt sich nicht um eine Insel, sondern um eine Inselgruppe, die zum Archipel von Rovinj gehört. Eine dieser Inseln ist „Sankt Andrea“, die ihren Namen von einem Benediktiner-Kloster erhielt, welches dort seit dem 9. Jahrhundert bestanden hat. „Cissa“ war der Name einer sagenhaften Stadt des Altertums, die vom Meer verschlungen wurde und deren Hügel nun als Inseln aus dem Wasser herausragen. Angeblich sollten auf dem Meeresgrunde noch die Überreste der Stadt zu erkennen sein. 1890, also im Jahre des Erwerbs durch Hütterott, stieg im Auftrage der Marine der „Staatstaucher“ in die Tiefe hinab und berichtete von Mauerresten. Leider behinderte ihn seine altmodische Ausrüstung an großflächigen Erkundungen und daran, in größere Tiefen hinab zu steigen. Dieser „amtliche“ Bericht führte sicherlich zu der Beschriftung des Buches.
Im Juli 1955 wurde unter Leitung eines Zagreber Instituts erneut eine Untersuchung durch inzwischen besser ausgestattete Taucher durchgeführt. Das Ergebnis lautete: „Es gibt in diesem Gebiet auf dem Meeresboden beeindruckende Felsformationen, aber keine Spuren von durch Menschen errichtete Bauwerke“. Eindeutig handelt es sich bei „Cissa“ um die adriatische Version der Atlantislegende.
Dass dieser Name den Umschlag des Gästebuches ziert, ist vermutlich eine literarische Rangerhöhung. Hütterotts verwenden diesen Namen im Gästebuch nie, sondern schreiben immer nur von „S.Andrea“. Unter dieser Bezeichnung ist die Insel auch auf den österreichischen Seekarten des vorigen Jahrhunderts eingezeichnet. Über der Eingangstür des Schlosses befindet sich in einer Bleiverglasung die Bezeichnung „S. Andrea di Rovigno“ in Verbindung mit einem reifen Granatapfel, unter anderem eines der Wappenbilder von Rovinj. Der Granatapfel ist aber auch in der christlichen Ikonographie von großer Bedeutung. Als Schmuck der Priester des Alten Testaments könnte er auch auf S. Andrea Verwendung gefunden haben.
Aus 1891 haben sich diverse Schreiben der Firma „Kärntner Holzindustrie Villach“ erhalten. Hauptsächlicher Inhalt ist die Herstellung von Fenstern, aber auch anderer Holzarbeiten, wie z.B. die Renovierung der Fußböden. Da allein über 70 (!) Fenster angefertigt wurden, lässt sich vermuten, dass es sich bei dem Klostergebäude nur noch um eine Ruine handelte, die aus den steinernen Wänden und einem Dach bestanden hat. Die Schriftstücke umfassen den Zeitraum vom 15. Januar bis zum 30. Mai und belegen eine zügige Instandsetzung. Es liegen auch eine Vielzahl von Rechnungen einheimischer Handwerker vor, die aber alle in Italienisch verfasst sind und sich daher für mich noch einer Bearbeitung entziehen. Ein Ritter Alfred von Purschkay, der im Gästebuch mit zwei Eintragungen vertreten ist, reicht eine Rechnung für diverse Besuche und Leistungen ein. Aufgeführt werden unter anderem Sprengungen und unterseeische Sprengungen auf S. Giovanni. Was gesprengt wurde, ist leider nicht vermerkt und heute lassen sich keine Spuren mehr feststellen. Es ist möglich, dass es sich um die Verbreiterung der Fahrrinne und der Anlage des kleinen Hafens auf S. Giovanni handelte. Aus den Unterlagen geht nicht hervor, dass die Insel durch Hütterott regelmäßig genutzt wurde. In Briefen aus dem Jahre 1907 wird ein Besuch auf der Insel genannt. Belegt sind unter Einbeziehung des kleinen Klosters gelesene Messen für die Sardellenfischer. Für diese kirchlichen Handlungen hat sich Georg aber seine ausdrückliche Genehmigung vorbehalten.
Im Archiv befinden sich auch zwei Zeitungsausschnitte von Anzeigen aus „deutschen landwirtschaftlichen Blättern“ vom August 1891. Darin wird für S. Andrea ein Aufseher gesucht. Die Insel wird beschrieben mit „kleine Besitzung in südlicher Gegend mit italienischer Landessprache“. Gesucht wir in dauernder Stellung ein junger, möglichst verheirateter Mann, dem seine Frau den Haushalt führen soll. Italienische Sprachkenntnisse werden nicht verlangt. Diesem Stellengesuch ist zu entnehmen, dass Georg von vorne herein die landwirtschaftliche Nutzung seiner neuen Besitzung im Auge hatte. Sicherlich trug er sich auch schon zu diesem Zeitpunkt mit dem Ankauf größerer Flächen auf dem Festland. In dem Fotoalbum von 1904 befindet sich eine Panoramaansicht der Insel, aufgenommen durch Hanna vom Turm auf dem Belvedere, die einige landwirtschaftlich genutzte Flächen erkennen lässt. Letztendlich wurde aber wohl kein deutscher Verwalter gefunden, sondern der aus Piran stammende Giacomo Fonda übernimmt diese Aufgabe für über dreißig Jahre. Bei einer Bremer Handelsgärtnerei werden im November diverse Pflanzen bestellt, die einen Rückschluss auf die ursprüngliche Gestaltung des Gartens zulassen. Es handelte sich unter anderem um verschiedene Arten von Koniferen, Azaleen, Kamelien, Oleander, Zitronen, Orangen und Magnolien.
Georg Hütterott kaufte im August 1890 die Inseln „S. Andrea“ und „Mascin“, die zum Archipel von Rovinj gehören. Seinen Besitz markierte er mit einem Stein, der sich noch heute direkt an der Treppe zum Säulenhof des Schlosses befindet und in den „H 1890“ eingemeißelt ist. Über die genauen Umstände des Kaufes ist mir nichts bekannt, auch nicht über den Zustand der Gebäude. Es heißt, dass die Klostergebäude sich in einem schlechten Zustand befanden und eine Zeitlang als Zementfabrik gedient haben. Der Turm der Kirche, die in wesentlichen Teilen dem 9. Jahrhundert entstammen soll, wurde als Schornstein zweckentfremdet.
Als einzige Eintragung befindet sich auf dem Blatt 1 die Signatur des Erzherzogs Karl Stefan (in den Kommentaren immer mit „C“ geschrieben; laut Habsburger-Lexikon ist aber die Schreibweise mit „K“ richtig und wird darum von mir benutzt). Neben seinem Rang (L. Capit.) vermerkt er auch seine Yacht „Christa“.
In den Jahren bis zum 1. Weltkrieg wechselt er die Schiffe laufend und führt sie Hütterott in S. Andrea vor, der die Namen der Yachten im Gästebuch erwähnt.
Hinsichtlich des hervorgehobenen Eintrags vermute ich, dass es sich bei dem vorliegenden Buch um ein Geschenk des Erzherzogs an Hütterott zur Erwerbung der Inseln handelt. Es scheint bei der Einweihung aber noch kein Gebäude vorhanden gewesen zu sein, welches zur Unterkunft hochrangiger Gäste geeignet gewesen wäre. Auch war der Januar nicht die Zeit, um auf der Insel Ferientage zu verbringen.
Blatt 2 verzeichnet zu Anfang neben dem Erzherzog auch noch den Konteradmiral Hermann Freiherr von Spaun, der an dem Aufbau der k.u.k.-Flotte maßgeblich beteiligt war. Außerdem war noch L.S.Capt. Oscar Cassini dabei, der bis in die zwanziger Jahre die Insel regelmäßig besucht.
Es folgen dann in regelmäßigen Abständen Besuche des Erzherzogs von März bis Oktober 1891. Es ist anzunehmen, dass bei seinen Fahrten in der Adria, die sicherlich auch den Charakter von Inspektionsreisen haben, S. Andrea als Zwischenstation diente. Bei den Besuchen ergab sich für ihn auch die Gelegenheit, mit Hütterott wirtschaftliche und technische Belange der Flottenaufrüstung zu besprechen.
Am 20. Juli kommt eine Gruppe Besucher mit dem Dampfer „Pelagosa“, die sich aus Deutschen und Italienern zusammenzusetzen scheint. Neben Adligen fallen auch einige Professoren auf.
Am 17. September 1891 bezieht die Familie die Insel und scheint dort nun über geeignete Räumlichkeiten verfügt zu haben. Alle drei Familienmitglieder unterschreiben mit der Eintragung: Georg, Marie und Hanna.
Erst am 1. Dezember findet die Rückreise nach Triest statt. Es ist auffallend, dass die Insel immer recht spät im Jahr bezogen wird. Wie weit das mit gesellschaftlichen und geschäftlichen Verpflichtungen in Triest verbunden ist, muss noch geklärt werden.
1892
Blatt 3–6
Die Eintragungen beginnen im Juni mit dem Bezug der Insel durch die Familie. Neben den Besuchen des Erzherzogs scheinen die Gäste Verwandte und Freunde zu sein, die aber meistens nur einen Tag bleiben. Auffallend ist die große Zahl der Adligen unter den Besuchern. Hervorzuheben ist der Besuch des Direktors des Berliner Aquariums (das alte „Unter den Linden“ gelegene, nicht das heute noch vorhandene im Berliner Zoo). Es belegt, dass Georg Hütterott Verbindung zu der entsprechenden Einrichtung in Berlin und deren Ableger in Rovinj hatte.
Auch ein japanischer Marineleutnant hat sich eingetragen. Vermutlich ist das mit dem Amt des Hausherrn als japanischer Konsul in Triest in Verbindung zu bringen. Für die Entschlüsselung der japanischen Eintragungen habe ich die Botschaften in Wien und Berlin bemüht. Leider verfügt das Archiv der Botschaft in Wien nicht mehr über Unterlagen aus der Vorkriegszeit. Biographische Angaben über die japanischen Besucher sind vermutlich nur über das Archiv des Außenministeriums in Tokio zu erhalten. Ein anderes Problem, mit dem ich die Japanische Botschaft in Berlin bemüht habe, ist, die Schriftzeichen zu entziffern. Genau wie bei uns sind die Eintragungen in einer Form verfasst, die in der heutigen Zeit schwer verständlich ist und nur unzureichend in unsere Umgangssprache übertragen werden kann. Die Eintragungen beziehen sich aber nur auf den Namen und den Rang des Gastes, wobei die Nennung des Ranges schon wieder viele Möglichkeiten offen lässt, wie z.B. bei zwei Personen „Direktor des kaiserlichen Hofes“ angegeben ist. Rangmäßig ist das für japanische Verhältnisse ein sehr hoher Rang, kann aber in der Hierarchie des Diplomatischen Corps auch wenig bedeuten. Aber nur einer der vier genannten Japaner ist im Marinewesen tätig.
Im Archiv haben sich 4 Briefe erhalten, die von dem Notar Alvise Rismondo und Dr. Benussi-Moro stammen. Dabei geht es um Kreditangelegenheiten. Der Notar hat wohl erhebliche Außenstände und bittet Georg um einen Kredit zu Überbrückung. Dr. Benussi-Moro (der in späteren Jahren auch Bürgermeister von Rovinj ist) wird als Vermittler eingeschaltet. Aus den ersten Jahren in Rovinj liegen einige Briefe in Italienisch vor, die aber noch nicht übersetzt sind. Georg hat sich aber bereits ein hohes Ansehen in der Stadt erworben und wird von den Behörden um Ratschläge gebeten.
Am 20. Mai wurde auf Schloss Pöls ein Brief an Georg Hütterott geschrieben (angeredet wurde er mit „Herr Consul“), dessen Absender leider nicht ermittelt werden konnte. Der Verfasser bedankt sich für eine Körbchen mit „Produkten von den Cissa Inseln“. Dabei handelte es sich um Artischocken. Er bedankt sich aber auch für einen „Erlaubnisschein“ und die Bemühungen zum Bezug von „Seewasser“. Vermutlich litt der Herr unter Schuppenflechte und durfte von der Insel aus Seebäder nehmen. Unter Umständen wurde für ihn mit Georgs Hilfe auch Wasser in Fässer abgefüllt und nach Schloss Pöls transportiert. Das wäre ein erster Hinweis auf Georgs Plan, Rovinj zum Kurort umzuwandeln. Auch heute noch ist die Wasserqualität an den Stränden der Inseln eine Hauptattraktion für die Touristen und vielen Festlandorten überlegen.
Von Professor J. Bolle von der k.k. Landwirtschaftlich-Chemischen Versuchsstation in Görz liegt ein Schreiben vor, das sich hauptsächlich mit der Beschaffung einer landwirtschaftlichen Fachkraft befasst. Demnach war die Suche per Zeitungsanzeige nicht erfolgreich. Beigefügt ist dem Brief der Entwurf eines Arbeitsvertrages eines Italieners. Es hat sich also auch kein Deutscher für diesen Job gefunden. Der Brief belegt aber auch, dass Georg staatliche Institute in die Kultivierung seiner neuen Besitzung einbezieht. Ich vermute, es ging Georg bei seinen Bemühungen um eine landwirtschaftliche Nutzung auch darum, seinem Schwager Walter Benecke, der auf Berghof eine erfolgreiche Landwirtschaft betrieb, zu beweisen, dass einem Georg Hütterott alles möglich war. Bei der geringen Ackerfläche und dem kargen Boden dürfte es aber nur zur Selbstversorgung gereicht haben. Barbelis hat in späteren Jahren eine Kaninchenzucht betrieben und darüber in Verona auch einen Vortrag gehalten. Ob diese aber wirtschaftlich und erfolgreich war, ist nicht überliefert.
Aus Rovinj liegt ein Bettelbrief der Franziskanermönche vor, deren Kirchturmglocke beschädigt ist und der dringenden Reparatur bedarf. Der Klostervorsteher redet Georg von Hütterott auch mit seinem Konsultitel an und bittet devot um Unterstützung. Pater Paolo bedauert, ihn nicht persönlich zu kennen, hat aber von seiner Großzügigkeit gehört. Die bei solchen Bettelbriefen üblichen Floskeln beiseite lassend, ist interessant, dass die Hütterotts sich wohl nicht bei allen Organisationen des Ortes vorgestellt, oder deren Repräsentanten auf der Insel empfangen haben. Das Franziskanerkloster ist im Stadtbild der Neustadt von Rovinj unübersehbar und dürfte auch in der gesellschaftlichen Struktur der Stadt eine entsprechende Rolle gespielt haben. Dass dazu auch zwei Jahre nach der Besitznahme der Insel noch kein Kontakt gesucht wurde, erstaunt.
1893
Blatt 7–9
Das Jahr 1893 beginnt auf der Insel im April mit dem sicherlich ranghöchsten Besuch während der Ära Hütterott, nämlich der Witwe des Kronprinzen Rudolf, Stephanie von Belgien. Begleitet wurde Stephanie u.a. von der Erzherzogin Caroline Marie, der Schwester von Karl Stefans Frau Marie Therese. Dieser Besuch war kein Zufall, sondern ist demnach durch die Vermittlung des Erzherzogs zustande gekommen.
Diesem Besuch wurde der größte Gedenkstein der Insel errichtet (er befindet sich jetzt an den Tennisplätzen). Ich vermute aber, dass dies nicht der ursprüngliche Platz des Steines ist; er müsste sich an einer auffälligeren Stelle befunden haben, um alle Besucher sofort zu beeindrucken. Es wäre aber auch eine Erklärung, dass der Stein auf dem höchsten Punkt der Insel aufgestellt wurde und sich somit fast noch an seinem ursprünglichen Ort befände.
Kleinere Gedenksteine dieser Art finden sich an mehreren Stellen auf der Insel, tragen aber meistens nur Titel, Namen und Jahreszahl; teilweise auch in Verbindung mit einem vermutlich vom oder für den Gast gepflanzten Baum. Alle Steine stammen aus den ersten Jahren der Insel, Der letzte wurde 1904 errichtet. Eine von mir erstellte Bestandsaufnahme der Gedenksteine ist nach Jahreszahlen geordnet dem Personenregister angefügt.
Es ist anzunehmen, dass in diesem Jahr das Schloss vollständig eingerichtet und somit auch repräsentativ bewohnbar war. Leider ist aus den Eintragungen nicht ersichtlich, ob die Gäste auch über Nacht blieben oder ob es sich nur um Tagesbesuche handelte. Jedenfalls dürften An- und Abreise, Aufenthalt und Essen mit entsprechendem Aufwand durchgeführt worden sein. Auch für die Sicherheit so hoher Persönlichkeiten müssten entsprechenden Vorkehrungen getroffen worden sein. Ich persönlich erinnere mich daran, welch „hohe Wellen“ es jedes Mal schlug, wenn Marschall Tito mit seiner Yacht und entsprechender Begleitung zwischen Mascin und Sturago entlang fuhr.
Es wäre interessant, zu überprüfen, ob bei solchen Besuchen auch ein offizieller Besuch in der Stadt Rovinj gemacht wurde, oder ob es sich nur um „private Besuche“ bei Hütterotts handelte.
Wegen einer Reise nach Deutschland, über deren Zweck wir nichts erfahren, kann die Insel erst im September bezogen werden, einem Zeitpunkt, zu welchem sich in heutiger Zeit die Tourismussaison bereits dem Ende zuneigt. Erst Mitte November kehrt die Familie nach Triest zurück.
Neben diversen Gästen, die uns auch in den nächsten Jahren begegnen werden, fällt eine Persönlichkeit auf, der auch ein Gedenkstein gewidmet wurde (den ich aber leider nicht mehr gefunden habe): Prof. Dr. Virchow aus Berlin (biographische Angaben zu ihm im Personenregister). Es gibt verschiedene Gründe, die Virchow nach Rovinj geführt haben könnten. Er war befreundet mit Prof. Dr. Theodor Billroth aus Wien, der den Sommer regelmäßig in Opatija verbrachte und vermutlich auch mit dem Krankenhaus in Rovinj in Verbindung stand. Außerdem war Virchow naturwissenschaftlich interessiert und hatte sicher auch Kontakt zum Aquarium (vielleicht gibt dort noch vorhandenes Archivmaterial entsprechende Auskunft), und letztlich war er auch ein Experte der frühgeschichtlichen Forschung und Archäologie, womit auch die zu dieser Zeit einsetzenden Ausgrabungen sein Interesse an den Illyrern erregt haben dürfte. Ein zusätzlicher gesellschaftlicher Gewinn dürfte gewesen sein (genau wie es Kupelwieser auf Brioni tat), sich mit einem bedeutenden Wissenschaftler zu schmücken. In dem kleinen Museum in der Kirche auf S. Andrea befand sich eine Gipsbüste von Virchow, die durch Feuchtigkeit allerdings stark beschädigt war. Zwischenzeitlich ist sie aber durch eine Neuanfertigung der Staatlichen Gipsformerei Berlin ersetzt worden.
Erstmalig tauchen im Gästebuch Bürger aus Rovinj auf, nämlich Matteo Guiseppe Campitelli, der Gründer der Tabakfabrik des Ortes und Dr. Benussi-Moro, ein Mitglied des Gemeinderates und späterer Bürgermeister.
Am 2. Dezember beschließt Erzherzog Karl Stefan den Reigen der Gäste für 1893.
1894
Blatt 10–13
Am 27. Januar ist der Erzherzog wieder der erste Gast auf der Insel. Eine Zeit, die nicht unbedingt als die günstigste zu bezeichnen ist. Hier stellt sich die Frage, ob das Schloss immer bewohnt wurde, also ob Personal, Verwalter, Gärtner etc. immer anwesend waren und einen so hohen Gast entsprechend bedienen konnten oder ob ein Familienmitglied extra aus Triest anreiste. Vielleicht gibt der noch zu erforschende Schriftwechsel darauf eine Antwort.
Von geschichtlichem Interesse sind die den Erzherzog begleitenden Personen, nämlich K. Banfield, Gustav Ritter von Brosch und Maximilian von Sterneck. Diese drei hatten alle an der Seeschlacht von Lissa teilgenommen. Die beiden letztgenannten waren sogar in den Admiralsrang aufgestiegen und maßgeblich am Aufbau der k.u.k. Kriegsmarine beteiligt. Banfield war sicherlich der älteste und wegen seiner Abstammung (er kam aus Irland und war bereits als Kapitän in den österreichischen Dienst getreten) nicht in höhere Ränge aufgestiegen. Er war der Vater von Gottfried Banfield, dem „Adler von Triest“. Es hat den Anschein, dass die „Seehelden von Lissa“ einen Betriebsausflug nach S. Andrea unternehmen. Für Georg Hütterott war in der Phase der Aufrüstung, an der Admiral Sterneck maßgeblichen Anteil hatte, der Kontakt zu dieser Gruppe von höchstem Interesse. Beflügelte doch der Sieg von Lissa wesentlich das Interesse an der Marine, die für den Binnenstaat Österreich bis zu diesem Zeitpunkt nur eine untergeordnete Rolle gespielt hatte.
Im April, vermutlich zu Ostern, kommt wieder japanischer Besuch aus Wien. Am 8. Oktober trägt sich eine Gruppe Akademiker ein, die aus verschiedenen deutschen Universitätsstädten kommen. Bei diesen Gästen könnte es sich auch wieder um eine Verbindung zum Aquarium handeln.
Erstmalig wird hier eines der Schiffe Hütterotts genannt, die Dampfyacht „Suzume“. Nach den zugänglichen Unterlagen hat er zwei Schiffe besessen, die „Tornado“ und die „Suzume“. Die „Tornado“ taucht in dem Gästebuch nicht auf und es scheint sich um ein kleineres Schiff gehandelt zu haben. Die „Suzume“ muss erheblich größer und luxuriöser gewesen sein. Der Name kommt aus dem Japanischen und bedeutet in der Übersetzung „Spatz“. Eine Bezeichnung, die für ein größeres Seeschiff ungewöhnlich ist.
Im Oktober-November ist ein 10-tägiger Besuch der Emma Freifrau von Lutteroth vermerkt. Diese Dame muss für die österreichische Marine von Bedeutung gewesen sein, denn der Seeheld Admiral v. Tegetthoff hat mit ihr einen umfangreichen Schriftwechsel unterhalten. Ich hoffe, nähere Angaben vom Marinearchiv zu erhalten. Frau von Lutteroth macht in den nachfolgenden Jahren regelmäßige Besuche auf S. Andrea.
Im November kommt der Erzherzog mit einem Teil seiner Familie, nämlich der Erzherzogin Marie Therese und seinen Kindern Eleonora, Renata und Carl. Außerdem befindet sich in seiner Begleitung das Prinzenpaar von Sachsen-Coburg, verwandtschaftlich verbunden mit dem englischen Königshaus.
Bei den letzten Gästen der Insel handelt es sich um eine 10-köpfige Delegation aus Rovinj. Ab diesem Jahr bis 1907 bildet eine solche Delegation aus den Honoratioren der Stadt die letzten Besucher auf der Insel.
Da nach 1910 keine solchen Besuche mehr verzeichnet sind, ist anzunehmen, dass sie ausschließlich dem Hausherrn gegolten haben, obwohl belegt ist, dass Marie von Hütterott als Wohltäterin in der Stadt auch weiterhin höchstes Ansehen genossen hat.
Erst kurz vor Weihnachten kehrt die Familie nach Triest zurück. Georg Hütterott war in dieser Zeit erkrankt. Leider ist über die Art des Leidens nicht bekannt. In den folgenden Jahren werden aber Krankheiten und Kuren erwähnt, aber auch dann nicht genau benannt.
1895
Blatt 14–16
Auf Einladung des Erzherzogs darf Georg an der Einweihung des „Nord-Ostsee-Kanals“ teilnehmen. Dort vertritt sein Gastgeber Erzherzog Karl Stefan Kaiser Franz Joseph persönlich. Für das Deutsche Kaiserreich war diese Kanaleröffnung von großer nationaler Bedeutung und entsprechend ist auch die Teilnahme Hütterotts zu bewerten. In dem Bremer Familienarchiv hat sich ein Brief erhalten, den Georg an seine Tante (Hannchen) geschrieben hat. Unter Umständen wurde dieser Brief als eine „Familienreliquie“ betrachtet, belegte er doch, dass ein Mitglied der Familie Hütterott Seiner Majestät, Kaiser Wilhelm II. einmal ganz nahe gewesen ist. Da Briefe von der Hand Georgs sehr selten sind, dieser Brief aber einen sehr interessanten und auch amüsanten Inhalt hat, soll er hier vollständig wiedergegeben werden:
An Bord S. M. S. „Kaiserin Königin Maria Theresia“
Nordsee, 25 Juni 1895
Meine liebe, liebe Tante!
Längst schon war es mein Wunsch Dir mal wieder zu schreiben und dennoch bin ich schon lange nicht mehr dazu gekommen und musste, mit allerlei Angelegenheiten überhäuft, die ganze Privat – Correspondenz meiner lieben Marie überlassen. Von ihr weißt Du denn auch, wie es uns ergangen ist. Aber jetzt, wo ich die Nordsee durchkreuze u. so nah u. doch so weit an Euch vorüberfahre, benutze ich gerne ein freies Stündchen, um Dir, liebste Tante u. Euch lieben Bremern Allen recht herzliche Grüße zu senden u. bitte nur gleich ob meiner schlechten Schrift um Entschuldigung. Aber bei eiskaltem Nordwind u. hoher See, rollen wir ganz gehörig u. bei dem fortwährenden Balanciren geht das Schreiben schlecht.
Noch habe ich Dir nicht selbst gesagt, welch innige Freude Du auch mir mit des lieben Onkels, des Unvergeßlichen, Photos gemacht hast. Georg's Aufnahme ganz besonders ist so lieb u. lebenswahr, (2) dass ich sie immer wieder ansehen muß. Es scheint mir immer noch kaum wahr dass wir den geliebten Mann verloren haben, der mir ein zweiter Vater gewesen ist. Und wie schwer mußt erst Du, geliebte Tante, seinen Verlust alltäglich empfinden. Mein Gedanken u. treuen Wünsche weilen gar oft bei Dir und ich habe mich sehr gefreut, dass Du mit dem glücklichen jungen Paar schöne Wochen im Süden zubringen konntest, wie es uns ebenso eine große Freude gewesen ist, von der Besserung in Léon's Gesundheit zu hören.
Uns ist es seit letztem Herbst, mit Ausnahme einiger leichter Influenza, immer recht gut gegangen. Das Frühjahr brachte uns mancherlei Unruhe u. die Regatta Woche in Pola, welcher ich mit Marie auf unserer „Suzume“ beiwohnte. Dann waren wir 10 Tage in Venedig, auch auf der „Suzume“ u. augenblicklich befinde ich mich als Gast Sr. Kais. Hoheit des Erzherzogs Karl Stefan, der als Admiral die oesterr. Escadre commandirt, auf seinem Flaggschiff auf der Rückreise von Kiel nach Pola. Se. Kais. Hoheit ist so gütig gewesen mich (3) einzuladen die Feste zur Eröffnung des Nordostseecanals mit ihm mitzumachen u. mit größter Freude habe ich dies gethan, denn Ähnliches wird man so bald wohl nicht wieder erleben. Se. Kais. Hoheit hat mich aber nicht nur eingeladen, sondern war so lieb mir auch alle offiziellen Einladungen von Berlin zu verschaffen, sodaß ich überall mit dabei sein konnte.
Am 12 Juni bin ich von Triest abgereist, hatte 2 Tage in Wien zu thun, begrüßte dann meine Schwiegereltern in Marienbad, war 2 Tage in Berlin u. traf am Abend des 18ten in Hamburg ein, wo ich am 19ten Rendezvous mit Sr. Kais. Hoheit hatte. Gerne hätte ich in Hamburg Frau Rittershausen besucht; aber es war ein solches Menschengewühl dort, dass ich mit einigen nothwendigen Besorgungen am Morgen des 19ten nicht rechtzeitig dazu fertig geworden bin u. zu Mittag mußte ich auf dem Bahnhof sein, wo Se. Kais. Hoheit mit Prinz Heinrich u. dem Herzog von Sachsen Coburg u. Gotha mittelst Sonderzuge eintraf u. offiziell empfangen wurde. Von da an, bin ich mit wenig Ausnahmen stets bei Sr. Kais. Hoheit gewesen u. habe all die ganz unbeschreiblich großartigen Feste (4) in Hamburg u. Kiel mit gemacht u. höchst Interessantes gesehen u. erlebt.
Des Kaisers Einzug in Hamburg sah ich mit Sr. Kais. Hoheit aus dessen Fenstern in der Wohnung mit an, die ihm vom Senat zur Verfügung gestellt worden war. Es war ein schöner, feierlicher Moment.
Nachmittags gabs leider Regen, welcher das Fest auf der Alster zum Theil störte. Dennoch verlief es großartig. Tausende u. Abertausende von Menschen besetzten die Straßen, die Fenster, die Dächer der Häuser, die schwimmenden Tribünen, welche rings auf dem Alsterbassin errichtet waren. Die Illumination war unbeschreiblich schön. Ich war auf der neu geschaffenen Alsterinsel, wohin der Kaiser mit allen Fürstlichkeiten vom Rathhaus kam u. da verhältnismäßig nur wenig Einladungen für die Insel ausgegeben worden waren, gabs dort kein Gedränge u. ich konnte – nach reichlicher Bewirthung – mir sehr behaglich u. eingehend all die vielen Fürstlichkeiten betrachten, die im Fürstenpavillon versammelt waren. Nach des Kaisers Fortgang fuhr ich mit meinem Erzherzog u. dem Herzog von Coburg-Gotha nach dem „Trabant“ unserem zur Canaldurchfahrt bestimmten oesterr. Kriegsschiff, u. diese Fahrt durch die (5) illuminirten Straßen, in welchen eine unzählbare Menschenmenge ununterbrochenes Spalier bis zum Hafen bildete u. den Wagen mit Hurrarufen u. Tücher- u. Mützenschwenken zujubelte, wird mir unvergeßlich bleiben.
Um Mitternacht liefen wir auf dem „Trabant“ von Hamburg aus u. konnten uns vom Anblick der ganz herrlich illuminirten Elbeufer nicht trennen. Von 2–4 Uhr gönnten wir uns Ruhe. Um 5 Uhr begann für uns die Canaldurchfahrt. Und diese Durchfahrt – an u. für sich sehr interessant – gestaltete sich, durch den Jubel der Bevölkerung, welche sich in unzähligen Massen an den Ufern versammelt hatte, zu einer erhebenden Feier; eine festlich mit Flaggen, Ghuirlanden (Schreibweise des Originals), Inschriften geschmückte Stelle folgte der anderen, zu beiden Seiten des Canals; alle Schüler der nächstliegenden Orte, Knaben u. Mädchen, festlich gekleidet, mit tausenden von kleinen Fähnchen, waren in Reihen aufgestellt; überall Musiken, die uns stets mit unsrer Volkshymne empfingen – zum Theil schauerliche Dorfmusikanten, aber schon der gute Wille war rührend. Und all diese vieltausendköpfige Menge empfing die vorbeifahrenden Schiffe, und unseres ganz besonders begeistert, mit nicht enden(6)wollendem Jubel, den wir von Bord aus eifrigst erwiderten – und dies durch 12 Stunden hindurch, denn so lange dauerte die Durchfahrt. Etwas Ähnliches kann man wohl nie wieder erleben. Es war eine ganz unbeschreiblich großartige Freudenkundgebung, u. eine spontane, keine bestellte, das fühlte man durch, die mich tief ergriffen hat.
In Kiel war auch alles sehr großartig – ich finde kein anderes Wort dafür – allein schon der Anblick der schönen Bucht, mit ihren bis ans Meeresufer reichenden Buchenwäldern, voller prächtiger Kriegsschiffe aller Flaggen, Yachten u. Dampfern. Und auch dort habe ich alles mitgemacht, den Ball in der Marine-Akademie mit allen Majestäten, die Schlußsteinlegung, die Flottenrevue, das Kaiseressen u. was es sonst noch alles gegeben hat. – Das Kaiseressen war ein herrliches Fest, das Lokal dazu ein gebautes Linienschiff an Land, imposant, sehr schön decorirt, die Speisen u. besonders die Weine ausgezeichnet. Mich hat es wieder sehr interessiert all die Fürstlichkeiten aus nächster Nähe, die vielerlei hohen Uniformen zu beobachten, ganz besonders aber die Rede des Kaisers mit (7) anzuhören; Wort für Wort habe ich verstanden; Se. Majestät spricht hinreißend – das war wieder ein schöner, erhebender Moment u. die Denkmünze, welche jeder der 1000 Eingeladenen bekommen hat u. welche sonst nicht erhältlich sein wird, wird mir ein interessantes Andenken bleiben.
Ein Erlebnis aber unter all dem Schönen was ich mit gemacht, ist mir eine speziell liebe Erinnerung u. ich muß es Dir auch erzählen:
Nach der Kanaldurchfahrt am Abend des 20ten hatten wir uns in Kiel von dem „Trabant“ auf die „Maria Theresia“ überschifft, dann schleunigst Toilette für den Ball in der Marineakademie gemacht u. als wir spät davon an Bord zurückkehrten, war meine Unterkunft noch nicht bereit u. ich wurde deshalb für diese Nacht im Eßzimmer des Admirales, also Sr. Kaiserl. Hoheit untergebracht, durch welches, aus dem Empfangszimmer kommend, der Zutritt zu seinem Schlafzimmer führt. Weil wir die Nacht vorher wegen der Canaldurchfahrt kaum geschlafen hatten, u. müde waren, gab Se. K. Hoheit Auftrag, uns am nächsten Morgen nicht vor 9 Uhr zu wecken. Ich war aber schon gegen 8 Uhr wach, stand auf, packte meine Siebensachen aus dem (8) Koffer u. stand am Waschtisch, nur mit Hose u. Unterhemd bekleidet, mir die Hände waschend, da klopft es – auf geht die Thüre u. herein tritt ganz allein, in Gala-Uniform eines Admirales – der Kaiser! Die Thüre schließt sich wieder hinter ihm u. da stehe ich mit eingeseiften Händen vor Sr. Majestät! Wir haben uns beide jedenfalls sehr erstaunt angeschaut. „Wo ist mein Vetter, der Erzherzog?“ fragte mich – übrigens sehr freundlich, der Kaiser. Ich weise auf die nächste Thüre, der Kaiser spaziert hinein, weckt Se. Kais. Hoheit, der natürlich gleich aus dem Bette springt, u. weil es bei ihm im Zimmer noch dunkel ist, führt er den Kaiser wieder ins Eßzimmer zurück, wo ich gerade nur Zeit gehabt hatte, mir den Seifenschaum von den Händen zu wischen, stellt – er im Nachthemd – mich – im Unterhemd – dem Kaiser vor, verschwindet wieder in seiner Cabine, um sich anzuziehen u. ich stehe wieder mit dem Kaiser allein. Davonlaufen konnte u. mochte ich nicht; mich in Gegenwart des Kaisers anziehen ging auch nicht; so pflanzte ich mich denn direkt vor ihm auf u. sagte ihm: „Majestät, ich möchte lieber in den Boden versinken, als in diesem Aufzug vor Euer Majestät zu stehen, aber (9) es öffnet sich keine Fallthüre“. „Oh, es schadet auch gar nichts“, antwortete der Kaiser, sichtlich belustigt über die Situation u. unterhielt sich nun außerordentlich liebenswürdig u. gnädig, ganz ungezwungen mit mir, bis Se. Kais. Hoheit angezogen aus seiner Cabine kam! – ist das nicht köstlich!? – Um 8 Uhr war der Kaiser ohne Standarte am Boot, unangemeldet zu uns an Bord gefahren, nicht gleich erkannt u. deshalb auch nicht offiziell empfangen worden; er wollte den Erzherzog besuchen u. als er gehört, dass dieser noch schlafe, erklärt, er selber wolle ihn wecken u. ließ sich den Weg zu seiner Cabine zeigen, welcher durch mein provisorisches Nachtquartier führte. Ich freue mich natürlich sehr über dies merkwürdige Erlebniß, welches mir zeitlebens eine sehr interessante Erinnerung sein wird.
So ist in Kiel denn Alles herrlich verlaufen.
Am Morgen des 23ten sind wir dort ausgelaufen, treffen am 27ten in Plymouth ein, wo dieser Brief zur Post soll u. berühren dann nur noch Gibraltar, ehe wir am 16ten Juli in Triest eintreffen. Ein Besuch des spanischen Hofes in Gibraltar San Sebastian (10) muß wegen Erkrankung der einen Prinzessin in Madrid leider unterbleiben.
Gleich nach meiner Ankunft in Triest werden Marie u. Hanna auf 4 Wochen zu den Schwiegereltern nach Frankfurt fahren u. ich unterdessen eine Cur in Marienbad gebrauchen, welche mir die Aerzte wegen meines Blinddarmes verordnet haben. Nur mit Schrecken denke ich daran, denn solche Badecur, besonders wenn man ganz allein sie durchmachen soll, ist recht unerfreulich. Ende August treffe ich dann die Meinen wieder u. dann soll schleunigst unsere liebe Insel bezogen werden, worauf wir alle Drei uns schon jetzt sehr freuen. Wie gerne möchte ich auch Dich liebe Tante wiedersehen – ich sehne mich sehr danach; aber in diesem Sommer wird es sich kaum machen lassen. Hoffentlich also recht bald später einmal.
Wahrscheinlich seid Ihr noch in Badenweiler; da ich es aber nicht sicher weiß, auch Deine Adresse dort nicht kenne, schicke ich diesen Brief nach Bremen, von wo aus er Dir gewiß (11) nachgeschickt wird. Hoffentlich langweilt es Dich nicht, dass ich Dir so viel von Kiel erzählt habe, aber ich bin noch ganz erfüllt davon u. denke auch dass es Dich u. Röschen u. Léon vielleicht auch andere, interessiren wird, von mir als Augenzeugen, diese kleine Schilderung der großartigen Feste zu bekommen.
Von Carl (Carl Theodor Hütterott, 1867–1933) hatten wir kürzlich einen lieben Brief aus Iquique u. freuen uns dass es ihm gut geht. Grüße den lieben Menschen von mir vielmals, wenn Du ihm schreibst. Auch an Georg (Georg Theodor Hütterott, 1861–1917) viele Grüße. Roeschen u. Léon grüße ich ebenso innigst und Dich liebe, liebe Tante umarme ich ganz von Herzen als Dein
Dich sehr liebender,
stets getreuer Neffe Georg
Wenn Du mein Gekritzel nur lesen kannst; bei der bewegten See gings nicht besser. –
Die Empfängerin dieses Briefes ist Johanna Susanne Emilie Hütterott (1833–1914). Mit dem „lieben Onkel, dem unvergeßlichen“ ist ihr am 10.01.1895 verstorbener Mann Theodor Georg Balthasar Hütterott gemeint, *1825. Das glückliche junge Paar sind ihre Tochter Rosalie Johanna (1863–1944 „Röschen“) und ihr Mann Léon Adolph Mathias Petry (1859–1915). Die beiden heirateten 1894.
Briefe des Georg von Hütterott sind im Archiv äußerst wenige vorhanden. Dieser Brief wurde uns von Herrn Carl Th. Hütterott in Gütersloh zur Verfügung gestellt. Vermutlich wegen der geschilderten Begegnung mit Kaiser Wilhelm II. hat er sich in den Unterlagen der Familie erhalten. Sicherlich war er der einzige Hütterott, dem es vergönnt war, Seiner Majestät, wenn auch in unziemlicher Kleidung, gegenüber gestanden zu haben. Ich könnte mir denken, dass er diese Anekdote gerne im Kreis seiner maritimen Freunde erzählt hat. Soweit sich aus den vorhandenen Unterlagen seine Charakteristik herauslesen lässt, war er der typische Parvenü, der es genoss, die „Allerhöchsten Herrschaften“ aus der Nähe sehen zu können. Dieser Brief an seine Tante ist ein beredtes Zeugnis. Die Königin von Spanien, mit der leider kein Treffen zustande kam, war die Schwester des Erzherzogs Karl Stefan. Bei dem erwähnten Herzog von Sachsen, Coburg und Gotha handelte es sich um den österreichischen (katholischen) Zweig dieses Fürstenhauses. Es handelt sich um den Schwager von Karl Stefan, der in der österreichischen Marine den Rang eines Linienschiffskapitäns bekleidete. Der Herzog vertrat Karl Stefan 1910 bei der Beerdigung Georgs. Zur Familie Coburg unterhielt Marie bis in die dreißiger Jahre Kontakt.
Der kaiserliche „Überfall“ auf ein Kriegsschiff einer fremden, wenn auch befreundete Macht wirft ein bezeichnendes Licht auf die Aufmerksamkeit der österreichischen Matrosen und Seeoffiziere, aber auch auf deren Organisationsgeschick bei der Unterbringung kaiserlicher Gäste im „Esszimmer“, also der „Pantry“. Dass eine Barkasse der kaiserlichen Marine mit dem Kaiser selbst an Bord ohne Admiralsstander fuhr, war in dieser Marine schlicht undenkbar! Im Übrigen war Wilhelm II. durch solche Eskapaden berüchtigt. Die Komik der Situation wirkt allerdings belustigend. Die Begeisterung Georg Hütterotts für die kaiserliche Rede in Kiel dürfte dem Zeitgeist entsprechen; Zeitgenossen schildern Wilhelms Ansprachen als hochfahrend, bramarbasierend und oberflächlich.
Es hat sich für dieses Jahr aber auch noch ein anderes Schriftstück von Georg erhalten, ein Briefentwurf an den Hafenkapitän von Rovinj. In diesem Schreiben vom 9. November verlangt er von der Obrigkeit die Bestrafung von zwei Fischern, die mit ihren Booten in die zu seinem Besitz gehörenden Gewässer ihre Netze ausgelegt hatten. Die Fischereirechte, auf die Georg sich beruft, sind vermutlich erst durch den Kauf der Inseln durch eine Privatperson zum Tragen gekommen. Es ist vorstellbar, dass in der Zeit der industriellen Nutzung als Ölmühle und Zementfabrik niemand auf die Einhaltung entsprechender Rechte geachtet hat und die Gewässer in Inselnähe als Gemeingut angesehen wurden. Vermutlich hatte das Kloster entsprechende Rechte besessen, die von den Mönchen (sofern sie den Fischfang nicht selber ausübten) gegen Naturalienlieferung (einen Teil des Fanges) an die Fischer abgetreten haben. Diese Rechte dürften aber mit der Errichtung der „Illyrischen Republik“ (1805-1817) erloschen sein. Nach drei Generationen waren solche zurückliegenden Beschränkungen bei der Bevölkerung in Vergessenheit geraten. Georg Hütterotts Auftreten in dieser Angelegenheit lässt ihn als Feudalherren erscheinen. Anderseits fühlte er sich den Fischern durchaus verbunden, denn in seiner Zeit als Abgeordneter in Wien setzte er sich für die sozialen Belange dieser Berufsgruppe ein und bemühte sich um die Errichtung einer Kranken- und Altersversicherung.
Unter den Inselgästen sind besonders zu erwähnen der Erzherzog Ludwig Salvator mit seiner Yacht „Nixe“ (Näheres zu ihm im Personenregister) sowie die Familie Minutillo. Franz Freiherr von Minutillo war der Hafenadmiral und Kriegshafenkommandant von Pula und somit auch geschäftlich für Hütterott interessant.
Erstmalig taucht auch ein Fritz Küchler auf, dessen persönliche Entwicklung im Gäste-Buch zu verfolgen ist: vom Theologie- und Philosophiestudenten zum Kandidaten der Theologie. Nachdem er sein Studium, vermutlich 1898, beendet hat, kommt er nicht mehr nach Rovinj. Als einer der wenigen Besucher bleibt er meistens ein bis zwei Wochen auf der Insel.
In diesem Jahr wird auch zum ersten Male erwähnt, dass die Familie in der See badet. Ein Vergnügen, das zu dieser Zeit nicht unbedingt als „gesellschaftsfähig“ bezeichnet werden kann. Hinsichtlich der Bauten auf der Insel wäre zu überprüfen, ob die steinernen Kabinen an dem Steg zu Mascin zu dieser Zeit errichtet wurden und somit schon ein richtiges „Seebad“ vorhanden war. Mit diesen Bauten könnten auch die Pläne Hütterotts, Rovinj zu einem Seebad auszubauen, ihren Anfang genommen haben.
Die noch heute vorhanden Badekabinen
Zu den erwähnenswerten Archivalien gehört ein Brief von Carla Attems, der „Oberhofmeisterin der k.u k Hoheit Durchlauchtigster Frau Erzherzogin Maria Josepha“, der Mutter des letzten österreichischen Kaisers. Da sie Marie Hütterott duzt, ist ein freundschaftliches Verhältnis der beiden Damen anzunehmen. Da es der einzige erhaltene Brief der Verfasserin ist, lässt sich die spätere Entwicklung dieser Verbindung leider nicht verfolgen. Gandussi-Giardo bedankt sich äußerst devot für eine Einladung zum Essen in der „Villa Adele“ in Triest. 1906 wird er als Bürgermeister von Rovinj genannt. Die christliche Vereinigung „Töchter Marias“ bittet Georg um eine Spende für die Erneuerung ihrer Versammlungsräume. Leider wissen wir nicht, ob er dieser Anfrage nachgekommen ist, aber er wird sich solchen Anfragen wohl nicht haben entziehen können und entsprechende Großzügigkeit an den Tag gelegt haben. Durch entsprechende Zuwendungen soll sich die Familie Hütterott in Rovinj aber ein hohes Ansehen erworben haben.
1896
Blatt 16
Nur eine Texteintragung, die von Georgs Kur in Marienbad und einer Reise nach Salzburg berichtet. Und als einziger Gast Erzherzog Ludwig Salvator. Nicht einmal der „Dauergast“ Karl Stefan scheint der Insel einen Besuch abgestattet zu haben. Das kann mit der Krankheit und Kur von Georg Hütterott in Verbindung stehen. Aber die Ereignisse sind eigenartig, und es drängt sich ein Verdacht auf, den ich hier kurz wiedergeben möchte. Ich bin mir aber auch bewusst, einer Spekulation Tür und Tor zu öffnen.
Hütterott bringt seine Tochter Hanna in ein „Institut“ nach Dresden. Es handelt sich um das Institut des Frl. von Rabenhorst, sicherlich um ein „Institut für höhere Töchter“. Die Schulakten der Stadt Dresden geben uns die Auskunft, dass Frl. von Rabenhorst nicht die Befähigung zur Leitung einer Ausbildungsstätte besaß. Sie musste darum eine befähigte Lehrerin einstellen. Aus diesen Informationen können wir schließen, dass es sich nicht um ein besonders renommiertes Institut handelte. Vermutlich war es sich eine mittellose Adelige, die ihr ererbtes Haus in dieser Weise für ihren Lebensunterhalt nutzte. Sie dürfte nicht mehr ganz jung gewesen sein, da sie sonst keine Genehmigung erhalten hätte. Aber dass sie im Adressbuch von Marie v. Hütterott als „Fräulein“ tituliert wird, ist wohl aussagekräftig genug. Aber warum nach Dresden? Neben einer Ausbildung zur Dame dienten solche Internate auch dem Aufbau von Beziehungen für das spätere Leben. Im Falle der Hütterotts wäre es sicherlich vorteilhafter gewesen, die Tochter nach Wien, in die Nähe des Hofes, zu bringen, oder aber nach Frankfurt, wo die Großeltern lebten und um somit noch einen Familienkontakt zu halten. Dresden war zu dieser Zeit zwar eine nicht unbedeutende Kunst- und Kulturstadt, Leipzig und Weimar waren aber sicher bedeutungsvoller. Es hat den Anschein, als ob Hanna dem Blickfeld der Triestiner Gesellschaft in der Zeit der Schwangerschaft der Mutter entzogen werden sollte.
1897
Blatt 17
Es ist wieder eine Kur, diesmal mit Frau und Tochter, in Marienbad erwähnt. Hanna wird danach wieder nach Dresden gebracht, sicherlich um die Ausbildung zu beenden, aber vielleicht auch, um den Schein gegenüber der Triestiner Gesellschaft zu wahren. Georg Hütterott fährt vermutlich von Dresden nach Saybusch (Polen) weiter, wohin der Erzherzog ihn eingeladen hat.
Mittels eines „X“ im Gästebuch wird erstmals die Anwesenheit der jüngsten Tochter Barbara Elisabeth auf der Insel dokumentiert. Im familiären Sprachgebrauch wird sie „Barbelis“ genannt, sie selber nennt sich nur Barbara. Zu dieser Geburt hat sich auch ein Brief an Tante Hannchen in Bremen erhalten, der wegen seiner wichtigen Informationen hier in voller Länge wiedergegeben werden soll:
Villa Adele,
31 Jan. 1897.
Meine geliebte Tante Hannchen!
Längst schon wollte ich Dir mal wieder schreiben, aber ich habe so arg viel zu thun, dass ich zu Privatbriefen fast gar nicht mehr komme. Verzeihe deshalb gütigst, dass ich Dir noch nicht für Deine lieben Glückwünsche zu meinem Geburtstag; für Deine lieben Weihnachts u. Neujahrsgrüße, für Deine Wünsche zur Geburt unseres 2ten Töchterchens gedankt habe. Sei aber überzeugt, dass uns all diese Zeichen Deiner Liebe herzlich gefreut haben. Auch für Deinen gestern an Marie eingetroffenen lieben Brief danken wir Dir vielmals u. freuen uns, dass er uns gute Nachrichten von Dir bringt u. Du uns auch von Deinen fernen (2) Lieben nur Gutes schreiben kannst.
Bei uns geht alles ganz nach Wunsch. Die Kleine gedeiht prächtig u. Marie, welche selbst stillt, erholt sich schnell. Hanna war 8 Tage hier um das Schwesterchen zu sehen u. ist mit uns glücklich über das kleine Geschöpf. Vor 8 Tagen aber mußte sie nach Dresden zurück, weil sie ihre Schule nicht zu lange versäumen durfte; ich brachte sie nach Wien u. von dort nach Dresden reiste sie allein u. hat nun rechtes Heimweh nach uns, wie wir nach ihr. Sie ist ein großes, sehr liebes Mädchen geworden. Zu Ostern soll sie confirmirt werden u. Marie u. ich werden hierzu nach Dresden fahren.
Am Tag vor Hanna's Abreise tauften wir hier das Schwesterchen, bei welchem Hanna Pathin war und nannten es Barbara Elisabeth (3) nach meiner Ur-Ur-Ur Großmutter, geborene Schellmann (Barbara Elisabeth Schellmann, * 1685, † 1751, Ehefrau von Antonius Hütterott, * 1676, † 1753). Vorerst wird die Kleine noch mit beiden Namen genannt (nach der Ahnentafel Blatt 4 in der Familienchronik trug sie die Namen Clara Ida Emilie Hanna Barbara Elisabeth); ob es dabei bleibt, wird sich zeigen; die beiden Namen sind ja so kurz, dass eine Abkürzung nicht weiter nöthig ist! – (Aus den beiden „so kurzen“ Namen wurde der noch kürzere „Barbelis“) Ich hoffe, dass wir Dir die kleine Barbara Elisabeth auch einmal vorstellen können u. dass Du sie als Dein Großnichtchen lieb gewinnen wirst, wie sie auch Dich liebe Tante, immer lieb haben soll.
Ich bin in letzter Zeit hier sehr in Anspruch genommen, freue mich aber meiner angenehmen u. erfolgreichen Thätigkeit. Vor 3 Jahren habe ich mich hier mit an die Spitze bei Gründung einer großen Reisschälmühle gestellt u. arbeite hier seitdem mit, und das Unternehmen geht ausgezeichnet. Im Vorjahre wurde ich zum Mit-Direktor (4) einer großen Schiffsbauwerft hier, erwählt, wo wir große Kriegsschiffe etc. bauen u. das interessirt mich sehr. Oft denke ich mit einigem Kummer daran, dass ich meinem lieben Vater (er starb 1889) nicht mehr hiervon erzählen, dem lieben Onkel Theodor (Ehemann der Empfängerin dieses Briefes, † 1895) nicht mehr darüber schreiben kann. Die letzten Wochen brachten uns traurige Gedenktage an Beide.
Nach unseren lieben Inseln komme ich nur selten, doch wächst u. gedeiht dort Alles herrlich.
Doch nun liebste Tante zur Hauptsache: mein heutiger Brief soll Dir Mariens u. meine herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag bringen! Möge das neue Lebensjahr Dir nur Glück u. Freude bringen! Wir werden am 2 Febr. Deiner in treuer Liebe gedenken u. hoffen recht sehr, dass uns bald auch mal wieder ein Wiedersehen mit Dir beschieden sei! Marie grüßt vielmals u. ich umarme Dich von Herzen als Dein stets getreuer
Neffe Georg.
Der lieben Mutter Vietor lasse ich herzlich für ihren lieben Brief danken. Grüße sie und Smidt's vielmals von uns!
Die Empfängerin dieses Briefes ist Johanna Susanne Emilie Hütterott in Bremen (1833-1914), an die auch der Bericht über die Begegnung mit dem Kaiser gerichtet war. Auch dieser Brief wurde aus den in Gütersloh vorhandenen Unterlagen zur Verfügung gestellt.
In zwei Punkten ist dieser Brief sehr interessant, erstens der Bericht über seine berufliche Entwicklung. Dass er von geschäftlichen Angelegenheiten schreibt, die drei Jahre, bzw. ein Jahr zurückliegen, belegt, dass es keinen regelmäßigen Briefverkehr zwischen Triest und Bremen gab. Zweitens der Grund dieses Schreibens, die Familie über die Geburt von Barbelis zu informieren. Dabei nimmt dieses, für einen stolzen Vater doch sicherlich besonders wichtigem Thema, wenig Platz ein. Zur Zeit der Geburt war Marie Hütterott 37 Jahre alt. Ihr erstes Kind bekam sie mit 20 Jahren, ob es in der Zwischenzeit zu Fehl- oder Totgeburten kam, ist nicht bekannt. Nach dieser langen Pause hätte es sich bei einer älteren Frau, und um 1900 handelte es sich bei einer fast Vierzigjährigen durchaus darum, um eine Problemschwangerschaft handeln können. Hanna war 16 1/2 Jahre alt und hielt sich zur Zeit der Schwangerschaft ihrer Mutter in Dresden auf. Über das Institut, das sie zur schulischen Ausbildung besuchte, ist nur wenig bekannt. Es handelte sich um eine kleine Lehranstalt, die von einem verarmten adligen Fräulein geführt wurde, das dazu nicht einmal die Befähigung besaß, sondern eine ausgebildete Lehrerin einstellen musste um das Institut überhaupt führen zu dürfen. Befremdlich ist auch, dass Dresden gewählt wurde und nicht Wien oder die damals schon durch weltweiten Ruf geschätzten Schweizer Internate. Vermutlich wurde diese Lehranstalt durch den intimen Freund der Familie, Curt Netto, dessen Familie in Dresden lebte, vermittelt. Besonders misstrauisch macht die in Dresden stattfindende Konfirmation von Hanna. Einmal ist es ein sehr später Termin, da normalerweise die Konfirmationen mit 14 Jahren stattfinden. Barbelis wurde mit 15 Jahren in Frankfurt konfirmiert. Georg nahm, wie schon sein Vater und seine Frau eine geachtete Stellung in der calvinistischen Gemeinde von Triest ein. Lange Jahre waren beide Presbyter gewesen. Eine Einführung in die christliche Gemeinschaft hätte eigentlich dort stattfinden müssen, wenn nicht außerordentliche Gründe dagegen sprachen. Mit der Konfirmation erfolgte traditionsgemäß auch die Einführung in die Gesellschaft und die Töchter rückten in die Gruppe der Heiratskandidatinnen ein.
Dass die Konfirmation von Barbelis 1913 in Frankfurt stattfand, könnte mit dem hohen Alter der Großmutter entschuldigt werden. Aber auch in diesem Fall hätte sie in Triest stattfinden müssen, wenn noch starke Bindungen an die Gemeinde bestanden hätten. Marie scheint der Stadt Triest aber den Rücken gekehrt zu haben und ist nach 1914 auch nicht mehr dorthin zurückgekehrt. Sie hat dort keine Wohnung mehr unterhalten, sondern wohnte bei ihren häufigen geschäftlichen Aufenthalten in Triest immer im Hotel.
Auch die späte Heirat von Hanna (mit 36 Jahren) lässt vermuten, dass sie mit einem gesellschaftlichen Makel behaftet war. Aus finanzieller Sicht wäre sie sicherlich eine sehr begehrte Partie gewesen. Ihr Ehemann war jedenfalls keine „gute Partie“, denn er konnte seiner Frau kein standesgemäßes Leben bieten und war immer auf die Unterstützung seiner Schwiegermutter angewiesen.
Die Inselbesucher dieses Jahres sind nicht weiter erwähnenswert. Aber in den Texten tauchen jetzt regelmäßig Berichte über das Wetter und das Verhalten der Schwalben auf. Aus den Unterlagen des Museums ist mir bekannt, dass Marie von Hütterott in den zwanziger Jahren in Berlin einige Geräte zur Wetterbeobachtung bestellt hat. Es scheint also ein entsprechendes naturwissenschaftliches Interesse vorhanden gewesen zu sein.
1898
Blatt 18–20
Marie bringt Hanna nach Bedford (England) wo sie ca. ½ Jahr bleibt, während Georg mit dem Erzherzog eine Mittelmeerkreuzfahrt unternimmt. Im Mai macht er einen Krankenbesuch beim Erzherzog, der in Berlin operiert wurde. Es hat den Anschein, dass sich zwischen den beiden eine engere Freundschaft entwickelt hat. Georg Hütterott wird sogar zu der Trauerfeier für die ermordete Kaiserin Elisabeth (Sisi) eingeladen!
Unter den Besuchern taucht erstmalig Carla Attems auf, in Begleitung des Erzherzogs. Es ist möglich, dass es sich bei ihr um eine Gouvernante der Kinder gehandelt hat. Wie ich aus einem Brief weiß, der im Heimatmuseum vorliegt, ist sie später Oberhofmeisterin der Erzherzogin Maria Josepha (Mutter des letzten Kaisers von Österreich) und eine vertraute Freundin Marie Hütterotts geworden. 1913 macht sie sogar einen Besuch mit mehreren Familienangehörigen auf der Insel.
Auch ein neuer Name taucht im Gästebuch auf, der sich bis zu den letzten Eintragungen fortsetzt, Grabmayr! Dieser Name wird sich fast bis zu den letzten Seiten durch das Gästebuch ziehen, denn es ist der des späteren Ehemannes von Hanna. Bei diesem Gast handelte es sich allerdings nicht um den späteren Schwiegersohn, sondern vermutlich um dessen Vetter Moritz Grabmayr (nähere Angaben im Personenregister).
Voller Freude vermerkt Hütterott in seinem Protokoll, dass der Erzherzog die Insel S. Katarina gekauft habe, welches für die Cissa-Inseln und die istrianische Küste ein großer Gewinn sein könnte.
Bereits am 5. November siedelt die Familie nach Triest um. Es erscheint dann noch eine schwer zu lesende Unterschrift, die von Erzherzog Salvator stammen könnte. Darüber die Ortsbezeichnung „Rovigno“ vielleicht von der gleichen Hand.
Ab diesem Jahr können wir noch auf eine andere Informationsquelle zurückgreifen, nämlich auf zwei Photoalben, die von Hanna vermutlich in den zwanziger Jahren zusammengestellt wurden. Sie umfassen die Jahre 1898 bis 1913 und beinhalten ausschließlich Bilder von Reisen, die von der Familie Hütterott unternommen wurden. Die Fotos zeigen uns eine Vielzahl von Personen, die uns aus dem Gästebuch oder dem Archiv bekannt sind. Die Aufnahmen scheinen alle von Hanna mit einer Plattenkamera gemacht worden zu sein. Sie zeigen einer erstaunlichen Qualität, was die Schärfe der Aufnahmen betrifft. Aber auch die Bildgestaltung übertrifft die Werke eines Hobbyfotografen, wenngleich es sicherlich nicht beabsichtigt war, „Kunstfotos“ herzustellen. Aus einem Brief der Großmutter wissen wir, dass Hanna „einen Kodak“ zum Geburtstag bekommen sollte. Da das veranschlagte Geld aber nicht ausreichte, wollte die Großmutter den fehlenden Betrag mit der nächsten Überweisung senden. Wir können davon ausgehen, dass es sich nicht um eine Box, sondern um eine etwas teurere Fotokamera handelte. Aus der Korrespondenz wissen wir, dass es sich um die Marke „Goertz“ handelte, mit einer ausgesprochen hochwertigen Optik.
Diese beiden Fotoalben wurden mir von Herrn Walter Benecke aus Trieb zur Verfügung gestellt. Sicherlich wurden sie für seine Großmutter Emma Benecke von Hanna zusammengestellt. Ein weiteres Album in gleicher Ausstattung erhielt ich von Herrn Hütterott aus Gütersloh. Es beinhaltet aber nur Bilder von der „Villa Adele“ und zeigt kaum Personen, umfasst aber denselben Zeitraum. Für wen Hanna dieses Album angefertigt hat, lässt sich leider nicht mehr ermitteln.
Am Ende des jeweiligen Jahreskommentars werde ich die Angaben aus den Alben wiedergeben und die abgebildeten Personen kursiv nennen. Auf Erläuterungen werde ich verzichten.
Ostende + Berghof, September, Ernest, Fred, Arthur (Benecke), Barbara
1899
Blatt 20
Für dieses Jahr liegen wenige Eintragungen vor, dabei hat sich für die Familie in den letzten Dezemberwochen einiges verändert. Georg Hütterott war von Kaiser Franz Joseph I. in den erblichen Ritterstand erhoben worden! Leider konnte ich nicht feststellen, für welche Leistung er geehrt wurde. Die vollständige Akte „von Hütterott“ des Wiener Staatsarchivs habe ich in Kopie dem Heimatmuseum von Rovinj übergeben. Sie ist aber nicht sehr aussagefähig, was die Leistungen des Geadelten betrifft. Hütterott wird mit dem Titel eines „Ritters“ sozusagen nur in die „III. Klasse“ des österreichischen Adels aufgenommen. Die Standeserhöhung könnte auf seinen geschäftlichen Erfolgen, aber auch auf seiner Tätigkeit als Parlamentarier beruhen. Auch eine Fürsprache seines Freundes Erzherzog Karl Stefan wäre denkbar. Er selber bittet um eine besondere Ausfertigung des Adelswappens, die auch mit einer Extragebühr belegt ist. Auf dieses Wappen ist noch zu einem späteren Zeitpunkt einzugehen, da noch Einsichtnahmen in die Wappenarchive vorgenommen werden müssen. Ein Teil der Akte betrifft den Schwiegersohn Fritz von Grabmayr, aber auch davon später.
Georg von Hütterott (ab jetzt werde ich die Familie in ihrer Adelsbezeichnung erwähnen) beginnt den Jahresbericht mit einer Schreckensnachricht, indem er vermeldet, dass der Erzherzog S. Katarina wieder verkauft hat. Den Käufer nennt er nicht, obwohl es sich um den bekannten polnisch/litauischen Grafen Ignaz Karol von Korvin-Milewski handelt. Dieser taucht auch im Gästebuch nach meinen bisherigen Forschungen nicht auf. Es kann sein, dass er als Einwohner von Rovinj betrachtet wird und somit nicht zu den Gästen gezählt wird. Hütterott konkurriert mit dem Grafen um die Aufforstung der Inseln und der Anlage von Parkanlagen. Die (recht abenteuerliche) Lebensgeschichte des Grafen ist in dem Buch „Die Geschichte des Tourismus von Rovinj“ von Prof. Josip Folo festgehalten und soll darum hier nicht wiederholt werden. Beachtung finden sollte aber die Beziehung des Grafen zu Erzherzog Karl Stefan, sofern sie sich aus den recht spärlichen Nachrichten rekonstruieren lässt. Der Erzherzog soll den Grafen auf einer Reise nach Ägypten und Palästina kennen gelernt haben. Er verkauft die Insel, die nur wenige Monate in seinem Besitz war für den fast vierfachen Preis an Milewski. Merkwürdig bei diesem Handel sind aber die Zahlungsmodalitäten, denn der Kaufpreis wird erst 1905 bezahlt. Finanzielle Schwierigkeiten des Grafen dürften keine Rolle gespielt haben, denn er soll über erhebliche Bankguthaben (in Millionenhöhe) verfügt haben. Dieses Vermögen stammte außer ererbtem Reichtum vorwiegend aus dem Besitz an Bergwerken im Kaukasus. Wie in dem genannten Buch nachzulesen ist, wurden von ihm auch umfangreiche Bauten auf S. Katarina errichtet, die nur zu Wohnzwecken für den Grafen und seine Gäste dienten und nicht wie bei Hütterott auch zur landwirtschaftlichen Nutzung. Angeblich war Milewski auch Taufpate der Prinzessin Renata (1888 geboren). Diese Angabe erscheint mir aber fraglich, weil es sich bei dem Grafen Milewski um einen litauischen Protestanten handelte. Da die katholische Kirche auch heute noch keine Protestanten als Paten zuläßt, ist nicht anzunehmen, dass 1888 eine Ausnahme gemacht wurde. Im katholischen Umfeld von Rovinj wäre zu vermuten, dass sich die Protestanten Milewski und Hütterott annäherten und als Nachbarn einen zumindest respektvollen Umgang miteinander pflegten, der im Archiv Spuren hinterlassen hätte. Graf Milewski stirbt 1926 im Krankenhaus von Pula. Aus dieser Zeit stammt der einzige Beleg im Archiv, nämlich ein in Italienisch verfasster Entschuldigungsbrief des Verwalters, der einen fehlgeleiteten Brief weitergibt und sich für dessen Öffnung bei Marie von Hütterott entschuldigt.
1896 erbte Erzherzog Karl Stefan von seinem Onkel neben einem beträchtlichen Vermögen auch größere Anwesen in Polen. Er quittiert den Dienst in der Marine und widmet sich seinen polnischen Besitzungen. Auch erlernt er die polnische Sprache, und hat sogar Aussichten auf den polnischen Königsthron. Hier sollte erwähnt werden, dass der Erzherzog sehr sprachbegabt war und ein großes Interesse an den slawischen Sprachen zeigte. So war er z.B. der einzige Habsburger, der Kroatisch sprach und sich dadurch großen Respekt in der einheimischen Bevölkerung erwarb, war doch Italienisch im Küstenstreifen Verkehrssprache. Diese Verbindung könnte dazu geführt haben, die Insel an den Grafen Milewski zu verkaufen, der sich in einer gesellschaftlich prekären Lage befand, da er im Bahnhof der Wiener Südbahn den Mann seiner Geliebten angeschossen hatte. Louise Keyl berichtet ihrer Tochter in einem Brief vom 4. August 1904, dass sie in der Frankfurter Zeitung von der „unliebsamen Affäre Eures gräflichen Nachbars“ gelesen hätte. Nähere Angaben macht sie leider nicht. Die Art, in der Milewski von Maries Mutter erwähnt wird, lässt vermuten dass es sich beim Grafen um eine „unerwünschte Person“ handelt.
Wegen eines Todesfalles in Frankfurt (Großvater Keyl) und einer größeren Deutschlandreise wird die Insel erst am 10. September bezogen. Das Wetter scheint nicht sehr gut gewesen zu sein, denn nur 3 Wochen war es der Familie vergönnt, im Meer zu baden. Vierzehn Tage vor der Rückkehr nach Triest wird wieder eine Delegation aus Rovinj auf der Insel empfangen.
Bedford, bis 26. Juni 1899, Mrs. Hawkins, Cecilia Hawkins, Edith Hawkins, Ella Klotz Ethel, Amy, Harold Taylor, Frances Taylor, Mr. & Mrs. Kirby
Helgoland, 25. August
Marienbad, August, Clara und Lilia von Österreich
Venedig, 4. November, Josefine Swoboda
Berndorf, Dezember, Engelbert Faber, Frau von Krupp
Wien, Dezember, Otto Seybels Esszimmer, Lulu Seybels Wohnzimmer
1900
Blatt 22
Die Eintragungen beginnen am 11. September mit einem Bericht über einen Ausflug entlang der istrianischen Küste nach Lussin, wo sich die Sommerresidenz des Erzherzogs Karl Stefan befand. Äußerst devot wird der Besuch dort erwähnt. Das größte Ereignis des neuen Jahrhunderts wird natürlich auch besucht, die Weltausstellung in Paris, wohin die ganze Familie fährt, nur die erst dreijährige Barbara bleibt vermutlich in Triest. Für einen technisch Interessierten wie Georg von Hütterott war die Weltausstellung natürlich ein Pflichtbesuch. Aber Paris bot den Damen sicherlich auch genügend Abwechslung. In den nachfolgenden Jahren besucht der Vater häufig mit seiner Tochter entsprechende Veranstaltungen und Kongresse. Es hat den Anschein, dass er sie in entsprechenden Kreisen vorführt und nach einem standesgemäßen Ehemann Ausschau hält.
Im September findet der Besuch von Arthur und Margarete Krupp statt. Krupp war ein Neffe von Alfred Krupp in Essen und an mehreren Fabriken (Eisenwaren und Munition) beteiligt. Von 1905 bis 1915 war er Vizepräsident der „Stabilimento Tecnico Triestino“ und somit 2. Mann nach Hütterott. Er besucht die Familie häufiger auf S. Andrea, Frau Krupp später auch allein, aber ein regelmäßiger oder freundschaftlicher Kontakt ist mittels des Gästebuches nicht nachzuweisen.
Am 8. und 9. September fand der Stapellauf der „Habsburg“ statt. Von diesem großen gesellschaftlichen Ereignis ließ Hütterott von dem österreichischen Marinemaler Alexander Kircher ein großes Ölgemälde anfertigen, welches bis vor wenigen Jahren noch in der Eingangshalle des Schlosses hing, sich jetzt leider, aber aus verständlichen konservatorischen Gründen, im Depot des Museums in Rovinj befindet.
Alexander Kircher (1867–1939) Stapellauf der SMS Habsburg
Georg von Hütterott darf den Erzherzog auf seiner neuen Luxusyacht „Waturus“ auf einer Mittelmeerkreuzfahrt begleiten. In San Sebastian trifft der Erzherzog seine Schwester Marie Christine, die Königin von Spanien. Die Schwester sorgt 1918/1919 dafür, dass er die vom neuen polnischen Staat beschlagnahmten Güter zurückerhält. Am 17. Oktober kehrt die Reisegesellschaft nach Rovinj zurück. Neben der Signatur von Don Antonio Petrina (der sich auch noch ein zweites Mal im Gästebuch eingetragen hat) und den der Erzherzog vermutlich auch als „Bordkaplan“ mit auf seine Seereisen nimmt, ist auch vermerkt, dass Don Antonio eine Messe in der Kapelle auf dem Belvedere gelesen hat. Das bedeutet für die Insel, dass die Kapelle inzwischen wieder hergestellt wurde und vermutlich sogar geweiht und somit für religiöse Veranstaltungen benutzt werden konnte. Das ist insofern erstaunlich, da die Familie protestantisch war und der calvinistischen Gemeinde in Triest angehörte. Soweit den Berichten der Trauerfeier für Georg von Hütterott zu entnehmen ist, hat die Familie auch am Gemeindeleben der Triester Kirchengemeinde teilgenommen und ehrenvolle Ämter in der Kirchengemeinde sowie ihren Einrichtungen übernommen. Ich vermute, dass die Kirche auf der Insel wegen des katholischen (italienisch/kroatischen) Personals wieder entsprechend hergerichtet wurde.
Von besonderem Interesse dürften auch zwei Briefe sein, die belegen, dass aus dem Revier Edlitz in Niederösterreich zwei Rehe und ein Bock zu Zuchtzwecken gekauft wurden. Vermutlich sollte auf dem Festland ein Jagdrevier angelegt werden. Soweit bekannt ist, frönte Georg, im Gegensatz zu seinem späteren Schwiegersohn Fritz Grabmayr, nicht der Jagdleidenschaft. Die Wildhege wäre somit ein Angebot an hochrangige Gäste gewesen.
Ein Brief von Dr. Hermes, dem wissenschaftlichen Leiter des Aquariums in Rovinj, an Georg Hütterott belegt Kontakt und Interesse an dieser Einrichtung. Er hat sich in seiner Zeit als Parlamentsabgeordneter intensiv um die Belange der Fischer und ihre soziale Sicherheit (Krankenkasse und Altersversorgung) gekümmert und angeblich auch ein kleines Buch über den Fischfang als Wirtschaftszweig verfasst. Dr. Hermes bedankt sich für ein Grußtelegramm und bedauert, dass Georg nicht an dem Kongress teilnehmen konnte. Ein weiterer Brief enthält den merkwürdigerweise sehr kurzen Dank des Dr. Kien (Leiter des Seehospizes) für eine Spende, deren Höhe leider nicht genannt wurde. Es ist zu vermuten, dass Hütterotts alle sozialen Einrichtungen entsprechend mit Spenden bedachten. Ein karitatives Engagement wurde aber auch erwartet und war Grundlage für entsprechende Ehrungen durch das Kaiserhaus. Die Verleihung des „Elisabeth-Ordens“ 1908 an Marie von Hütterott war wohl mehr ein „Kauf“ als eine wirkliche Auszeichnung für Leistungen.
Der interessanteste Brief den Jahres 1900 ist wohl ein Rundschreiben an die Teilnehmer des 1899 in Berlin abgehalten Familientages. Dabei geht es noch einmal um die „Wappenfrage“. Das heißt, Georg drängt der Familie „sein“ Wappen auf, indem er jede einzelne Familie mit einer gemalten Wappenscheibe als Fensterschmuck beglückt und den Damen ein Petschaft verspricht, das er aber noch nicht liefern kann, da ihm die bisherigen Modelle nicht gefallen haben. Außerdem möchte er die Siegelringe der Männer mit Änderungen versehen, wie sie auf dem Familientag besprochen wurden. Aus der Familienchronik der Hütterotts geht allerdings eindeutig hervor, dass keine Einigung über eine Veränderung des Wappens zustande kam, sondern sich besonders das eigentliche Familienoberhaupt, Dr. jur. Carl Hütterott in Kassel für die Beibehaltung des überlieferten Wappens einsetzte. Außerdem lässt Georg von einem Künstler in Wien einen silbernen Einbanddeckel für die Urkunde zur Familienstiftung anfertigen. Von den erwähnten Glasscheiben befindet sich zumindest eine im Besitz der Familie Hütterott in Gütersloh. Ob die Petschafte angefertigt und die Siegelringe verändert wurden, ist nicht bekannt. Herr Carl Theodor Hütterott in Gütersloh ist im Besitz eines Petschafts und Siegelrings mit Wappen. Ob es sich dabei um die in diesem Brief genannten Stücke handelt, ist nicht überliefert. Auch die Stiftungsurkunde befindet sich in Gütersloh.
Semmering, Juli, Johanna u. Fritz von Hofstädtner, Herr von Bamberger, Lulu Seybel, Onkel Otto Seybel, Lili von Hofstädtner
1901
Blatt 23–24
Die Eintragungen beginnen mit dem schon üblichen Rückblick auf den Winter in Triest sowie den Besuch in Frankfurt zu dem Familienfest anlässlich des 90. Geburtstages der Großmutter Hoffmann (Mutter von Frau Keyl und Großmutter von Marie, bzw. Urgroßmutter von Hanna und Barbara). In diesem Jahr wird die Insel bereits im Mai bezogen und erst im November wieder verlassen. Es ist der erste längere Aufenthalt auf S. Andrea. Unterbrochen wird der Aufenthalt allerdings durch einige Reisen per „Suzume“ in der Adria und zu Familienbesuchen in Deutschland. Auch Baden-Baden wird besucht, der seinerzeit luxuriöseste Kurort in Deutschland, womit wieder mein Verdacht genährt wird, dass die Familie Ausschau nach einem Ehemann für Hanna hält.
Besonders erwähnenswerte Gäste sind für 1901 nicht mehr eingetragen. Auch der Erzherzog fehlt in diesem Jahre. Interessant ist der Brief eines Emil von Mayersbach aus Opatija, der Georg überreden will, auf seinen Inseln eine Gärtnerei zu errichten, die neue Obstsorten und Blumen züchten soll, um Wirtschaft und Kultur in Rovinj zu heben. Er hat viele Ideen, aber leider kein Geld zur Ausführung. Georg dürfte über diesen Brief schallend gelacht haben, denn in diesem Wirtschaftszweig war sein Vater schon erfolgreich tätig gewesen. Außerdem verfügte er selber über ausreichende Ideen, wie der Plan zur Errichtung einer mondänen Ferienkolonie bezeugt.
Heidelberg, August, Urgroßmutter Clara Hoffmann, Tante Pauline Rasor
Rippoldsau, Juli–August, Baronin Wechmar, Herr und Frau von Bohlen, Alex Kessler, Frau Kessler, Fred Babcock, Ida von Heyder, Frau von Gossler, Herr Österreich, Großmama Keyl
1902
Blatt 27–28
Hier ist die Eintragung etwas durcheinander geraten, denn auf das Jahr 1901 folgt in der fortlaufenden Nummerierung 1904 und 1905. Vermutlich klebten die Seiten zusammen und Georg von Hütterott hat seinen Jahresbericht an der falschen Stelle begonnen.
Vom 14. bis 17. Februar erlebt Triest unruhige Tage. Ausgelöst durch einen Streik der Heizer des Österreichischen Lloyd entwickelt sich ein Aufstand, in dem auch der Nationalitätenstreit unter den Bewohnern eine Rolle spielt. Tausende von Demonstranten veranlassen die Obrigkeit, mit Waffengewalt dagegen vorzugehen und es wird in die Menge geschossen, wobei 4 Menschen sterben.
Anfang Mai findet ein kurzer Besuch auf der Insel statt. Während des Sommers finden wir die Familie auf Reisen in ganz Europa. Man besucht verschiedene maritime Kongresse und Ausstellungen.
Ab September ist die Insel dann wieder Sommerresidenz. Neben den Freunden besucht wieder eine Gruppe deutscher Akademiker die Insel. Es könnte sich wieder um eine Delegation handeln, die wegen des Aquariums Rovinj besucht.
Mutter Keyl berichtet gleich zum Neuen Jahr über Ereignisse in Frankfurter Gesellschaftskreisen. Beim Vergleich ihrer Briefe lässt sich feststellen, wie sie sich immer mehr höheren Kreisen, besonders dem Adel zuwendet. Auch die kaiserliche Familie und Bad Homburg wird erwähnt. Es ist nicht auszuschließen, dass hier bereits die Weichen für Barbaras Verbindung zu Prinz Adalbert von Preußen gestellt wurden. Gleich zu Beginn des neuen Jahres war Maries Großmutter (Luise Hoffmann aus Karlsruhe) hochbetagt verstorben. In diesem Zusammenhang liegen Kondolenzbriefe von entfernten Familienmitgliedern vor, so zum Beispiel von dem deutschen Botschaftsrat in Lima, der in seiner Dienstzeit als Generalkonsul in Triest Nachbar der Villa Adele war. Wenn diese Personen auch nie als Gast auf der Insel weilten, so ist durch die Briefe doch belegt, dass Marie bemüht war, den Kontakt zu wichtigen und hochrangigen Personen zu halten.
Im Dezember unternahm Georg mit mehreren Herren der Triester Gesellschaft eine Reise nach Istanbul, die wohl dem Ausbau von Handelsbeziehungen der Stadt Triest im allgemeinen und nicht nur der Werft gegolten hat da Georg auch Mitglied der Handelskammer war. Namentlich genannt werden Ecomono und Graf Mülinen, von denen nur Letzterer einmal Gast auf der Insel war (1903).
Dänemark, Juli, Hilda Bunge
Antwerpen, Juli, Schloss Calixberghe bei Antwerpen, Herr und Frau Bunge, Dora Bunge, Eva und Sophie
Berghof, Juli, Herr von Neupaur, Ulrich Strahlendorff, Albert Benecke
Obersontheim, Juli–August
Venedig, Oktober, Max Goeschen, Clara Goeschen, Baron Curt Gablenz, Alex Kessler
1903
Blatt 28–29
Im Jahresrückblick wird erstmalig eine Krankheit namentlich erwähnt. Die Familie erkrankt in Triest an der Grippe, einer Krankheit, die um die Jahrhundertwende entschieden gefährlicher war als heute. Der Mai bringt wieder einen Ausflug mit der erzherzoglichen Familie, diesmal nach Venedig. Die „Suzume“ nimmt als Besucherin an der Regatta von Pula teil und der Erzherzog kommt mit seinen Kindern, aber ohne die Erzherzogin, zu Besuch. Bei den sonstigen Gästen handelt es sich um Familienmitglieder bzw. Freunde.
In diesem Jahr wird Barbara 6 Jahre alt und aus einem Brief der Bremer Verwandtschaft erfahren wir, dass sie nun die Schule besucht. Im Gegensatz zu Hanna wird sie also nicht zuhause von der Mutter unterrichtet. Sie soll auch Klavierunterricht erhalten, wobei aber nicht erwähnt wird, ob von ihrer Mutter (wie bei Hanna) oder von einer externen Lehrerin. Großen Erfolg scheint die Musikerziehung aber nicht gehabt zu haben, denn der Flügel wurde in Meran bei einem Spediteur eingelagert und später verkauft. Das in dem Inventar von 1945 aufgeführte Grammophon dürfte auch wohl eher Marie von Hütterott zur Unterhaltung gedient haben. Ein interessanter Hinweis ist das Geburtstagsgeschenk der Großmutter für Hanna, ein „Kodak“. Die drei aufgetauchten Fotoalben sind eindeutig von Hanna zusammengestellt und sie scheint auch die überwiegende Zahl der Fotos gemacht zu haben.
Die Mutter von Marie Hütterott, Louise Keyl, verbringt einen Urlaub mit einigen Familienmitgliedern in Adelboden. Sie schreibt wöchentlich einen Brief an ihre Tochter nach Triest, die an diesem Treffen nicht teilnehmen konnte. Ob diese Briefe eine Ausnahme sind, oder ob die Mutter wöchentlich einen Brief geschrieben hat, lässt sich nicht feststellen, es hat aber den Anschein.
Zu Weihnachten hatte Georg Freunden und Verwandten Kisten mit Orangen übersenden lassen. Die Dankesbriefe für dieses damals sehr aufwändige und kostbare Geschenk liegen uns vor. Unter anderem auch von der Gräfin Pückler-Limpurg, von der er 1901 das Schloss Obersontheim gekauft hatte. Zu Ostern verteilt Mutter Keyl an ihre drei Töchter Geldgeschenke, die Marie Hütterott vom Bankhaus Metzler nach Wien überwiesen bekommt. Sicherlich war das kein kleiner Betrag und ich vermute, so wie er brieflich angekündigt wird, dass es sich um einen Vorschuss aus dem väterlichen Erbe handelt, denn zwei Jahre vorher war der Vater verstorben. Erstaunlich ist, dass Hütterotts nicht zum 70. Geburtstag der Mutter in Frankfurt sein konnten. Wir erfahren das aus einem Brief von Elsie Wendland, die an diesem Fest teilnahm.
Schönbach/Bregenz, August, Automobiltour, Beneckes und Baron Wendland, Graf Szoldrsky, Hanna von Schwerzenbach, Onkel Carl von Schwerzenbach
Schloss Saybusch, September, Erzhg. Karl-Stefan, Maria Theresia, Prinzessinnen Renata, Eleonore, Mechthildis
1904
Blatt 25, 30–32
Der Winter in Triest war gut und fröhlich, und einige Tage verbringt die Familie in Wien. Merkwürdigerweise sind die Daten offen gelassen, als ob der Schreiber, vermutlich Georg von Hütterott, sich nicht genau erinnern kann und diese zu einem späteren Zeitpunkt einsetzen will. Dazu ist es dann wohl nie gekommen, denn es gibt im Gästebuch mehrere Eintragungen, in denen die Daten freigelassen wurden.
Die Ostertage verbringt die Familie auf ihrer Yacht „Suzume“ vor der Insel S. Andrea. Bei der Yacht „Suzume“ handelt es sich um eine sehr luxuriöse Dampf-Segelyacht, die so groß ist, dass der Eigner sie im Kriegsfalle dem Kaiser zur Verfügung stellen muss. Das Heimatmuseum in Rovinj besitzt ein Modell dieses Schiffes. Das Schiff scheint aber so komfortabel zu sein, dass die Familie nicht ins Schloss zieht, sondern die Feiertage auf dem Boot verbringt. Das heißt aber auch, dass die Räume nicht soweit hergerichtet sind, dass ein Bezug jederzeit möglich ist. Die Winter können in der nördlichen Adria sehr rau und ungemütlich sein, mit starken Stürmen, die es notwendig machen, ein Haus auf einer Insel richtig zu verbarrikadieren, weshalb das Schloss vielleicht nicht sofort bewohnbar ist, wenn die Familie aus Triest anreist. Das würde aber auch heißen, dass auf der Insel kein Bewachungs- und Dienstpersonal zurückbleibt.
Die verhältnismäßig große „Suzume“ wird, nach den Eintragungen im Gästebuch zu urteilen, aber nie für größere Reisen benutzt, sondern scheint ausschließlich im Raum der istrianischen Küste verkehrt zu haben. Es ist auch noch nicht geklärt, wie die Familie die Insel erreichte, wenn sie nicht mit ihrer eigenen Yacht kam. Soweit mir bekannt ist, verkehrte regelmäßig ein Dampfer des „Lloyd Adriatico“ ab Triest, und es gab auch die militärisch wichtige Eisenbahnverbindung Triest-Pula, die in Kanfanar eine eingleisige Abzweigung nach Rovinj besaß. Ob diese Strecke aber im Personenverkehr befahren wurde, ist mir unbekannt.
Mit Beginn des Jahres kommen die üblichen Gäste, Verwandte, Freunde, einige Akademiker und mit der „S.M.S. Habsburg“ auch Marinemilitär. Ein gesellschaftlicher Höhepunkt ist der 11. September, als Maria Theresia, Prinzessin von Bayern, mit ihren Töchtern eintrifft. Sie vergisst nicht bei ihrer Eintragung darauf hinzuweisen, dass sie eine geborene Erzherzogin ist. Sie ist in Begleitung des Erzherzogs Karl Stefan unterwegs als Gast auf dessen neuen Luxusyacht „Rovenska“. Nähere Angaben über die Prinzessin sind dem Personenregister zu entnehmen.
Erstaunlich ist, dass ein besonderes Familienfest nicht gefeiert wurde, nämlich die Silberhochzeit des Ehepaares Hütterott. Am 16. September 1904 sind drei Gäste eingetragen, zwei sind schon häufiger auf der Insel gewesen, der dritte, Walter E.T. Benecke, kommt anlässlich dieser Gelegenheit erstmalig und trägt dieses auch entsprechend in das Gästebuch ein.
Hannas Foto vom Besuch in Saybusch
Warum wurde nicht gefeiert, obwohl Hütterotts oder wenigstens ein Ehepartner an diesem Tage auf der Insel waren? Die Mutter schreibt ihrer Tochter einen vorwurfsvollen Brief, in dem sie bemängelt, dass keine entsprechende Feier stattfindet, es für die Hütterotts aber wichtiger ist, einer Einladung des Erzherzogs nach Saybusch zu folgen. Es hat den Anschein, dass die Familie sogar ausgeladen wurde und sich die Schwester Clara und ihr Sohn Alexander und der Schwager Walter Benecke den Besuch ertrotzten.
Aus dem Jahre 1904 liegen verhältnismäßig viele Briefe vor. Die meisten wurden von der Mutter Marie Hütterotts geschrieben und lassen vermuten, dass mindestens einmal pro Woche ein Brief gewechselt wurde. Zu manchen Zeiten, wie z. B. in den Sommerferien, wird an jedem zweiten Tag ein Brief verfasst. Über die Insel und das Leben der Familie Hütterott erfahren wir leider so gut wie nichts. Die einzige Information in dieser Richtung ist die Mitteilung, dass Barbelis das Schwimmen gelernt hat und dass die Umkleidekabinen errichtet wurden. Bis zu diesem Zeitpunkt nutzte die Familie eine andere Badestelle. Es wird auch kurz erwähnt, dass Georg die „Arbeiten beim Hafenbau überwacht“. Demnach wurde der kleine Hafen mit dem Löwen (wobei strittig ist, ob es sich um einen chinesischen oder venezianischen Löwen handelt) und der eingelassenen Windrose im Jahre 1904 angelegt. Interessante Einblicke gewähren die Briefe aus Frankfurt in das dortige gesellschaftliche Leben. Die Familie Keyl scheint in den Kreis der Frankfurter Patrizier voll integriert zu sein und auch eine maßgebliche Rolle gespielt zu haben. Ein solches Ansehen lässt sich für die Hütterotts in Triest nicht nachweisen. Louise Keyl scheint alle kulturellen Angebote der Stadt Frankfurt genutzt zu haben, und auch gesellschaftliche Empfänge besucht und im eigenen Haus in der Savignystraße gegeben zu haben. Der vorhandene Briefbestand endet abrupt mit dem vorwurfsvollen Schreiben anlässlich der Silberhochzeit. Es ist nicht anzunehmen, dass es sich um (Nach)Kriegsverluste handelt, sondern eher dass aus Verärgerung eine „Funkstille“ eintrat. Aus den vorhandenen Unterlagen lässt sich aber entnehmen, dass Georg bei seinem Aufenthalt in Wien im März seiner Frau zur Silberhochzeit eine lange Perlenkette mit zwei Brillantschließen kaufte.
Für die Entwicklung der Insel sind zwei Briefe aus dem August interessant, die von dem Plan berichten, die Insel an das örtliche Telefonnetz anzuschließen. Georg nimmt davon aber wieder Abstand, da er der Meinung ist, er würde sich nicht oft und lange genug auf S. Andrea aufhalten, um den finanziellen Aufwand zu rechtfertigen.
Die finanzielle Lage der Hütterotts scheint vermutlich angespannt gewesen zu sein, denn Louise Keyl erwähnt in einen Brief vom 27. Januar, dass sie den „mageren Ertrag aus den Verkauf von zwei Häusern“ gerne nach Triest gibt, der Anteil am Erbe dann aber für Hütterotts später geringer ausfallen wird. Über einen Informationsaustausch Sigmundts und Neufvilles erfährt die Mutter auch von Grundstücksgeschäften ihres Schwiegersohnes, auf die sie aber leider nicht weiter eingeht. Die Finanzlage Georgs scheint bei seinen Schwestern und ihren Männern durchaus ein Gesprächsthema gewesen zu sein.
1905
Der Winter in Triest war für die Familie angenehm. Leider wird nie erwähnt, womit sich Hütterotts in Triest beschäftigen. Aus den Unterlagen im Heimatmuseum ist durch aufwändig gedruckte Menü- und Einladungskarten bekannt, dass größere Diners und auch Hausbälle zu Ehren der Tochter Hanna gegeben wurden. Trotzdem ist es nicht gelungen, sie „an den Mann zu bringen“. Im März/April wird eine vierwöchige Mittelmeerkreuzfahrt mit dem Erzherzog auf der „Rovenska“ unternommen (Riviera, Elba, Neapel). In den Briefen aus Deutschland klingt es, als ob diese Reise eine „Entschädigung“ für Hanna war, deren angeblich geplante Hochzeit mit einem Mitglied des Hochadels wegen kaiserlichen Einspruchs nicht stattfand.
Am 10. Juli, also mitten im Hochsommer, wird die Insel bezogen. Aber es können keine Gäste aufgenommen werden, da an der Wasserversorgung gearbeitet wird. Da scheint es sich um die Verlegung der Wasserleitung vom Festland zur Insel gehandelt haben, denn der Zisternenbrunnen trägt ein früheres Datum. In diese Zisterne wurden nach Augenzeugenberichten die Unterlagen der Hütterotts (Akten und Bücher) geworfen, nachdem sich 1945 die Partisanen in den Besitz der Insel gebracht hatten. Die Zisterne ist zu dieser Zeit wohl nicht mehr für die Wasserversorgung genutzt worden. Es ist mir auch nicht bekannt, ob eine Wasserleitung vom Festland vorhanden war, die kriegsbedingt zerstört wurde oder aber einem natürlichen Verschleiß unterlag, denn sie wäre dann ja bereits 40 Jahre alt gewesen. Zu Beginn des Tourismus auf der Insel kam das Wasser wöchentlich in Tankwagen, die mittels Landungsbooten der jugoslawischen Marine transportiert wurden. Wenn die Touristen zu viel Wasser verbraucht hatten, saßen sie für einige Tage sprichwörtlich „auf dem Trockenen“.
Für dieses Jahr und das folgende Jahr liegen die meisten Briefe vor. Ein großer Teil der Korrespondenz befasst sich mit den Umbau- und Renovierungsplänen des Schlossgebäudes. Es wurde eine Wasserleitung mit Kalt- und Warmwasser (sogar noch unterteilt in See- und Süßwasser) installiert und auch die Fenster in ganzen Haus wurden erneuert. Leider lässt sich den Unterlagen nicht entnehmen, ob die Räume in Inneren baulich verändert wurden. Den Briefen ist jedenfalls zu entnehmen, dass es nicht möglich war, das Gebäude in dieser Zeit zu bewohnen.
Gesellschaftlicher Höhepunkt 1905 war sicherlich die Berufung Georg von Hütterotts als Abgeordneter in das Herrenhaus. Seinem Wirken als Politiker ist ein eigenes Kapitel gewidmet. Ausgelassen wurde aber die Möglichkeit, die Silberhochzeit des Ehepaares zu feiern. Weder in Triest, noch auf S. Andrea fand eine entsprechende Festlichkeit statt. Vielleicht lag es an den noch nicht beendeten Bauarbeiten oder der fehlenden Einrichtung. An diesem Tag hielt sich die Familie auf der Insel auf und wurde von Maries Schwester Clara, ihrem Sohn Alex und dem Schwager Walter Benecke besucht. In den Briefen der Mutter Louise Keyl ist der Unmut über den Ausfall der Feier zur Feier der Silberhochzeit mehrfach dokumentiert. Dafür tauchen aber auch regelmäßig Berichte über Hochzeiten in Frankfurt auf. Die Großmutter scheint immer indirekt darauf hinzuweisen, dass es an der Zeit ist, Hanna zu verheiraten. Da das Thema nie direkt angesprochen wird, dürfte es sich um einen heiklen Punkt gehandelt haben.
Pula, April, Mary Pott, Mizzi und Lola Minutillo
1906
Blatt–36
In diesem Jahr beginnt das Buch nicht mit einer Eintragung zum Winter in Triest. Der Reigen der Gäste beginnt mit der Erzherzogin Maria Josepha und als Begleiterin Carla Attems, die bereits erwähnt wurde. Sie wird vermutlich zu dieser Zeit ihren Dienst als Oberhofmeisterin bei der Erzherzogin Maria Josepha aufgenommen haben.
Der militärische Höhepunkt der Insel scheint am 2. August dieses Jahres erreicht zu sein, indem Admiral Rudolf Graf Montecuccoli der Insel einen offiziellen Besuch abstattet. Er bringt sogar seine Bordkapelle mit, die den ganzen Abend im Säulenhof musiziert. Das ist das einzige Mal, dass eine musikalische Unterhaltung auf S. Andrea erwähnt wird. Die Militärkapelle ist somit die Vorgängerin der nachfolgenden zahlreichen Bands, die für die Unterhaltung der Touristen sorgen. In den letzten Jahren ist diese Tradition auf einen einzelnen Musiker zusammengeschrumpft. Ich muss aber erwähnen, dass diese Einmannkapelle (Franjo) eine sehr gute Leistung erbringt. Der Admiral war einer der größten Förderer des Schiffsneubaus für die Marine und daher für Georg von Hütterott geschäftlich äußerst wichtig.
Anstelle der fehlenden Einleitung sind dafür vier Wetterbeobachtungen eingetragen. Im November wird die Insel verlassen, und Hanna reist mit ihrer Großmutter (Keyl) nach Frankfurt.
Einem Brief des Advokaten Alvise Rismondo ist zu entnehmen, dass Georg in Rovinj, oder Umgebung, fünf Ölmühlen betrieben hat. Im Jahre 1906 wurden 391 Liter gekeltert und zu einem durchschnittlichen Preise verkauft (worauf Rismondo extra hinweist!). Die landwirtschaftliche Verwaltung des Besitzes scheint demnach ausschließlich von Rovinj aus vorgenommen worden zu sein. Georg beteiligt sich auch mit einer größeren Spende für die Figur der Hl. Euphemia auf dem Altar der Pfarrkirche. Anlass für diese Spende war der Tod des Dr. Matteo Campitelli, des Direktors der Tabakfabrik. Aber auch in die Planungen für die erste Wasserleitung der Stadt war Georg eingebunden.
Aus diesem Jahr liegt auch ein umfangreicher Schriftwechsel mit der Firma „Carl Geyling´s Erben für Glasmalerei“ vor. Georg von Hütterott bestellt ein Glasfenster für die Kapelle und schreibt die Gestaltung genau vor: „eine segnende Madonna, darunter links mein Wappen, rechts die Inschrift Hanna v. Hütterott“. Vermutlich ist dieses Kapellenfenster eine Vorbereitung auf die geplante Verehelichung mit einem Mitglied des Hauses Habsburg. Die Hütterotts waren von Hause aus Calvinisten und nahmen auch in der Triestiner Kirchengemeinde gehobene Funktionen wahr. Eine Madonnendarstellung mit Familienwappen wäre daher schwer vorstellbar. Hätte die vom Kaiser angeblich untersagte Heirat stattgefunden, müsste nach Habsburger Hausgesetz Hanna zum Katholizismus konvertiert haben. Die gewünschte Fenstergestaltung wäre logisch. Über den Verbleib des Fensters ist nichts bekannt, angeblich wurde es 1950 von dem damaligen Direktor des Hotels an einen Slowenen verschenkt.
Es existiert auch aus 1906 wieder ein umfangreicher Bestand an Briefen, die überwiegend von der Mutter Louise Keyl aus Frankfurt stammen. Bei dem Inhalt der Schreiben handelt es sich hauptsächlich um die Erörterung familiärer Ereignisse. Am interessantesten ist die Suche nach einer geeigneten Erzieherin für Barbelis, die sich fast über das ganze Jahr erstreckt. Dieses sind wohl die ersten Hinweise, dass es sich bei Barbelis um einen etwas schwierigen Charakter handelte. Gefunden wurde schließlich ein gewisses Fräulein Katharina Tilsner, der Barbelis eine lebenslange Anhänglichkeit bewahrte, wie späterer Schriftverkehr belegt. Die Dame war später als Prinzenerzieherin im Hause der Fürsten zu Wied tätig und entwickelte sich zu einer strammen Nationalsozialistin. Es ist nicht ausgeschlossen, dass ihre Erziehung auch einen Gewissen Einfluss in dieser Richtung auf Barbelis ausübte.
Barbelies und Frl. Tilsner auf der Terrasse der Villa Adele
Dalmatienreise, Oktober, an Bord der „Gödöllö“, Curt Netto, Alex Kessler
1907
Blatt 37–39
Dieses Jahr beginnt mit einer zur Hälfte freien Seite. Vermutlich sollte hier der Bericht über den Winter in Triest stehen. Es ist rätselhaft, warum die Seite nicht ausgefüllt wurde, da weitere Berichte folgen und auch 1908 das Gästebuch mit dem Winterrückblick beginnt.
Georg von Hütterott macht in Begleitung von Arthur Krupp und Paul von Schoeller eine 12-tägige Autofahrt durch Tirol. Für uns ist das heute nichts Außergewöhnliches, aber zur damaligen Zeit war eine so lange Autoreise, besonders im Gebirge, ein größeres Abenteuer als eine Seereise mit eigener Yacht. Paul von Schoeller und Arthur Krupp waren Geschäftspartner im Bereich des Maschinenbaus, und über diese Verbindung bestand Kontakt zum Stabilimento Tecnico Triestino. Hanna und Marie von Hütterott verbrachten diese Zeit in dem Jagdrevier der Familie Krupp in der Walster, an der Grenze zwischen Niederösterreich und der Steiermark. Margarete Krupp, die Ehefrau von Arthur, hatte im Jahre vorher anlässlich ihrer silbernen Hochzeit als Geschenk für ihren Mann dort große landschaftliche Veränderungen vorgenommen.
Nach der Familienchronik war Georg Hütterott im Jahre 1879 mit 27 Jahren aufgrund seiner überragenden Leistungen als junger erfolgreicher Handelsherr zum ersten japanischen Konsul in Europa ernannt worden. Die Fernostreise 1883/84 könnte demnach auch eine konsularische Reise gewesen sein, da Kontakte mit Hofbeamten des Kaisers belegt sind. Der japanische Militärattaché ist mehrmals auf der Insel zu Gast. Im September besucht ein japanischer Flottenverband Triest, und von Hütterotts Anwesenheit ist natürlich notwendig. Erstmalig wird dabei eine gesellschaftliche Aktivität in Triest erwähnt, nämlich ein Dinner und eine Abendgesellschaft, zu der auch die Töchter eingeladen sind.
Ende des Monats fährt Georg von Hütterott zum Stapellauf eines rumänischen Kriegsschiffes, welches der Stabilimento Tecnico Triestino in Galatz baute. Voller Stolz wird im Gästebuch vermerkt, dass die Familie von König Carol I. anwesend war, und alles sehr befriedigend verlaufen ist.
Am 7. Oktober findet der schon traditionelle Besuch von Erzherzog Karl Stefan statt (der aus seiner Familie nur seine Tochter Eleonora mitbringt), dieses Mal aber in Begleitung der bayerischen Verwandtschaft: Prinzessin Maria Theresia mit ihren Töchtern.
Am 3. November (sehr spät) wird das letzte Seebad genommen, und am 9. November findet bei ganz schlechtem Wetter die Rückreise nach Triest statt.
Aus diesem Jahr liegen nur wenige Briefe vor. Drei davon sind von Georg an seine Frau geschrieben. Er berichtet von seinem Aufenthalt in Wien anlässlich der Sitzungsperiode des Herrenhauses. Privat verkehrt er vorwiegend mit alten Freunden, die als regelmäßige Besucher der Insel bekannt sind (Schoeller, Seybel, Krupp, Economo, Graf Kielmansegg usw.). Krupp, den er in den Briefen immer nur „Herr Krupp“ nennt, ist er beim Kauf einer Hochseeyacht behilflich. Über Fahrten mit diesem Schiff finden sich aber keine Hinweise in den Unterlagen. Neben den Sitzungen bemüht er sich aber auch um neue Aufträge für die Werft, hauptsächlich natürlich Kriegsschiffe. Überschwänglich berichtet er über die Reaktionen auf seine im Herrenhaus gehaltene Rede, die ihn plötzlich zu einem „geachteten und beliebten“ Parlamentarier gemacht hat. Eine Wertung von Georgs Tätigkeit als Abgeordneter würde den Umfang dieses Berichtes sprengen. Darum ist ihr ein eigenes Kapitel gewidmet.
Interessant ist, dass Marie und ihre Töchter fast täglich eine Nachricht an ihn schreiben (Karten oder Briefe), er selber aber nur einmal wöchentlich einen kurzen Bericht gibt.
Es liegen noch zwei weitere Schriftstücke vor, einmal die Absage des k.u.k. Statthalters Fürst Hohenlohe, nicht an einem Ausflug, wahrscheinlich mit der „Suzume“, teilnehmen zu können. Dieser Brief zeigt, wie Hütterotts bemüht sind, Anschluss an die „feine“ Gesellschaft in Triest zu halten. Ein zweites Dokument ist gar nicht an Hütterott gerichtet, sondern an den Erzherzog Karl Stefan. Der Militär-Veteranen-Verein „Erzherzog Karl Stephan“ in Rovigno schreibt an den Erzherzog und bittet um eine Spende zur Errichtung eines Vereinshauses. Vermutlich hat der Erzherzog diesen Originalbrief an seinen Freund Georg weitergereicht, mit dem unausgesprochenen Auftrag, gefälligst „Wohltäter“ des Vereins zu werden. Diese Vereinigung umfasste ca. 1000 Mitglieder, wovon aber nur 255 Aktive (also Veteranen) waren. Den größten Teil der Mitglieder (650) stellte das Musikkorps. Man könnte diesen Zusammenschluss von Bürgern Rovinjs auch als Musikverein bezeichnen. Von diesem Verein liegen aus den nachfolgenden Jahren noch mehrere Schreiben vor, die dann auch direkt an Georg von Hütterott gerichtet sind. Erstaunlich ist dabei, dass nur der Brief an Karl Stefan auf Deutsch geschrieben ist. Die nachfolgenden Schreiben sind in Italienisch verfasst worden. Es scheint sich somit wohl weniger um eine österreichische, als vielmehr um eine italienische Organisation gehandelt zu haben. Die Arbeiterkrankenkasse bedankt sich in einem Schreiben für die Anwesenheit Georgs bei einem Fest zu Gunsten des Sozialfonds. Er hat die Veranstaltung nicht nur durch seine Anwesenheit aufgewertet, sondern durch eine „überwältigende“ Festbeleuchtung der Insel einen Höhepunkt beigetragen. Leider fehlen Beschreibungen, wie diese Festbeleuchtung ausgesehen hat, bzw. wie die Bürger daran teilhaben konnten, da S. Andrea von der Stadt aus nicht zu sehen ist, sondern nur von der Punta Corrente, die als zum Besitz Hütterotts gehörig nicht öffentlich zugänglich war. Vielleicht handelte es sich um einen abendlichen Bootskorso, bei dem die Teilnehmer die Beleuchtung sehen konnten. Die kleine Stadt Rovinj hatte schon in der Vergangenheit ein reges und vielseitiges Vereinsleben. Es wäre sicherlich für die Lokalgeschichte interessant, dieses zum Thema einer selbstständigen Forschung zu machen.
Ein Konvolut von vier Briefen (es handelt sich dabei um Durchschläge von mit Maschine geschriebenen Briefen von Georg) beinhaltet die Vorbereitung zu einer Messe für die Sardellenfischer auf S. Giovanni. Der Franziskanerpater Giuliano da Valle des Klosters in Rovinj beabsichtigt, im Juni eine Messe auf S. Giovanni zu zelebrieren. Er bemüht sich sehr um die Anwesenheit der Familie. Auch der Stadtpfarrer Don Francesco Rocco schaltet sich ein und bemüht sich um Hütterotts Teilnahme. Georg nimmt zwar keine ablehnende Haltung zu dieser Veranstaltung ein, sagt aber sein Erscheinen auch nicht zu. Sein Auftreten in dieser Angelegenheit kann aber nicht als kooperativ angesehen werden, denn in sehr bestimmtem Ton behält er sich vor, in ausreichender Zeit vorher informiert zu werden, um ein Betreten der Insel zu gestatten. Er verbietet direkt eine Nutzung der auf S. Giovanni befindlichen Eremitage ohne seine ausdrückliche Genehmigung. Das ist in sofern erstaunlich, da er sich mit großem Engagement für die Fischer und das Fischereigewerbe in der österreichischen Adria einsetzt. Entsprechende Redebeiträge von ihm im Herrenhaus sind bekannt. Auch forcierte er eine soziale Sicherheit der Fischer und befürwortete eine Kranken- und Altersversicherung. Dass er einer Messe für die Sardellenfischer, die in besonderer Weise den Naturgewalten des Meeres ausgesetzt waren und des göttlichen Schutzes bedurft hätten, nicht großzügiger entgegen kam, verwirrt. Es liegt ein Foto vor, das die vollständige Familie auf S. Giovanni nach einer solchen Messe zeigt. Ob es sich dabei um das Jahr 1907 handelt oder um ein späteres Jahr, lässt sich leider nicht feststellen. Vermutlich war dieses Jahr aber der Beginn der regelmäßigen Messen für die Sardellenfischer. Ob es zu einer lang anhaltenden Tradition wurde, lässt sich vielleicht in den sonstigen Unterlagen des Heimatarchivs ermitteln. Im Hütterottarchiv liegen keine weiteren Unterlagen mehr vor. Auch finden sich in den Jahren unter der Leitung von Marie von Hütterott bzw. später hauptsächlich ihrer Tochter Barbelis (1911 bis 1944) keine Hinweise auf weitere Messen, die auf S. Giovanni gelesen wurden.
Berghof, Juli, Olga, Arthur und Walter Goeschen, Walter und Clara Goeschen, Emma, Walter und Arthur Benecke
Walster, August
Bei der Messe für die Sardellenfischer