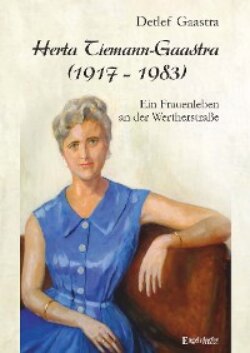Читать книгу Herta Tiemann-Gaastra (1917 – 1983) - Detlef Gaastra - Страница 6
DIE WERTHERSTRASSE
ОглавлениеDie Wertherstrasse gehört zu den längeren Bielefelder Straßen und führte früher vom Stadttor an der Niedernstraße entlang dem Osning (Teutoburger Wald) in die Stadt Werther. Da sie außerhalb der Stadtmauern lag war sie auch nur spärlich bebaut, hauptsächlich mit kleineren Bauerngehöften. Im 19. Jahrhundert vergrößerte sich die Stadt explosionsartig und wuchs aus der mittelalterlichen Enge über die Stadtmauern hinaus. Hauser im Stilgemisch des ausgehenden Jahrhunderts begannen die Straße zu säumen. Die Baustile vom 19. bis zum Ende des 20. Jahrhunderts sind auch heute noch wie Jahresringe eines Baumes abzulesen.
Ursprünglich begann die Straße an der Koblenzer Straße, kreuzte die Bahnlinie der Köln-Mindener Eisenbahn oberirdisch und führte fast gerade bis zur Stadtgrenze am Wellensiek. Dort ändert sie ihren Namen in Bielefelder Straße. Sie war eine befestigte Landstraße und kein Weg wie der parallel verlaufende „Bürgerweg“, der dem angrenzenden Park den Namen „Bürgerpark“ verlieh. Heute trägt diese verkehrsreiche Straße den Namen des Oberbürgermeisters Stapenhorst.
Das älteste Haus ist vermutlich das Haus Nr. 57, ein sogenanntes Ackerbürgerhaus und in den späteren Jahren Wohnhaus und Werkstatt eines Schneidermeisters. Dann gab es an der Straße in unmittelbarer Nähe zum Bürgerpark noch zwei kleine Bauerngehöfte. Ein einzelnes Bauernhaus und einen Hof mit dazugehörigem Kotten. Der Kotten stand der Straßenbegradigung im Wege und wurde abgerissen. Das Haupthaus existiert noch als Teil des Gemeindehauses der Altstädter Nicolaigemeinde. Von den letzten Eigentümern, den Geschwistern Willi und Frieda Ummelmann, wurde der Kirchengemeinde ein Stück Land an der Ecke Werther/ Lina-Oetker-Straße zur Errichtung einer Filial-Kirche überlassen, wenn sie den Hof nicht mehr bewirtschaften würden. Als das Gemeindehaus in der Grünstraße dem Ostwestfalendamm geopfert wurde, entstand ein Gemeindezentrum mit Kirchenraum.
Das Wachsen des Eisenbahnverkehrs machte Veränderungen in der Verkehrsführung notwendig. Die Bahnlinie führte mittels einer Eisenbrücke über die von der Recke-Straße und die Wertherstraße bekam einen Fußgängertunnel. Damit begann die Straße an der Bahnlinie. Dem restlichen Stummel bis zur Koblenzer Straße wurde der Rang einer Straße aberkannt und er wurde in „Albrecht-Delius-Weg“ umbenannt. An diesem Weg steht ein Landhaus im Gotischen Stil, die „Villa-Bozi“. Die Gebrüder Bozi spielten eine große Rolle bei der Industrialisierung Bielefelds und legten den Grundstein zu der „Leinenstadt“ durch die Gründung der dampfbetriebenen „Spinnerei Vorwärts“. Das Fabrikgebäude wurde im englischen Tudorstil errichtet. So wie auch die später erbauten Fabrikschlösser der „Ravensberger Spinnerei AG“ an der Heeper Straße und der „Mechanischen Weberei AG“ an der Teutoburger Straße. Etwas abseits der Straße lag in einem parkähnlichen Anwesen auch ein „Tudorschloss“, die Villa des Seidenfabrikanten Delius. Das eindrucksvolle Haus wurde leider ein Opfer der Bombardierung Bielefelds. Direkt gegenüber der Bozi-Villa erbaute sich der Apotheker Dr. August Oetker ein größeres Haus. Damals steckte das Backpulverimperium noch in den Kinderschuhen. Mit dem Wachsen seiner Fabrik entstand auch ein schlossähnliches Wohnhaus am gegenüberliegenden Hang des Bielefelder Passes. Direkt am Bahnübergang entstand die großbürgerliche Villa des Leinenhändlers Klasing, dem späteren Kunsthaus und Stadtarchiv. Klasing hat dem Leinenhandel bei Zeiten den Rücken gekehrt und mit Herrn Vellhagen einen Buchverlag gegründet, Vellhagen & Klasing. Später wurde aus ihm ein führender Schulbuchverlag. In dem Verlag erschienen auch die „Monatshefte“ und „Künstlerbiografien“. Bielefeld machte sich um die Deutsche Volksbildung verdient. Ein weiterer Leinenhändler, Carl Bertelsmann, dessen Wurzeln in Bielefeld liegen, stieg in das Verlagsgeschäft ein und war in Gütersloh im Kielwasser der „Ravensberger Erweckungsbewegung“ Herausgeber pietistischer Kirchenliteratur. Zu diesem Ensemble gehörten auch zwei Häuser an der Obernstraße, die heutige Handwerkskammer und auf der gegenüberliegenden Straßenseite die „Tiemann-Villa“, die beim Bau der Kunsthalle abgerissen wurde weil sie die Sicht auf das neue Kunsthaus beeinträchtigte. Kommerzienrat Tiemann gehört auch in den Kreis der Gründerväter der Bielefelder Industrie, hat aber nichts mit der Familie meiner Mutter zu tun.
Die gesamte Gruppe, die die industrielle Entwicklung der Stadt geprägt hat, wohnte am Anfang der Wertherstraße. Dadurch wurde die Entwicklung von einer Landstraße zu einer bevorzugten Wohngegend vorgezeichnet. Diese erste Phase der Bebauung endete an der Bismarckstraße. In diesem Abschnitt (und den Nebenstraßen) finden wir die gesamte Palette der historischen Baustile in einer Mixtur des Eklektizismus. Erinnerungen an Romanische Bauten, Villen der Renaissance, Französische Palais, Anleihen bei der Weserrenaissance und Barockpaläste. Dieses Stilgemenge setzt sich in den Seitenstraßen fort. In der Grünstraße finden wir die Delius-Villa im Stil Palladios und einen barocken Reitstall. Es gab an der Wertherstraße auch zwei Häuser die aus dem Rahmen fielen, sogenannte Schiefer-Häuser.
Das waren Bauten aus Holz und Fachwerk, die mit dünnen Schieferplatten gegen Feuchtigkeit belegt waren. Schiefer ist ein Material, das im Raum Ostwestfalen nicht vorkam und darum selten verwendet wurde. In den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurde die Idee wieder aufgegriffen und Häuser wurden mit Eternit-Platten versehen. Das war preiswerter als eine Fassadensanierung. Es stellte sich aber bald heraus, dass durch fehlende Luftzirkulation und eindringender Feuchtigkeit der Verfall der Häuser beschleunigt wurde. Auch die Wertherstraße konnte in der Höhe der Weststraße mit einer solchen Bausünde aufwarten. Das Haus ist inzwischen einem Neubau gewichen. Mit den Namen der Seitenstraßen wurde der Preußischen Geschichte gehuldigt, dem Großen Kurfürsten, dem Reichsgründer Bismarck, den Heerführern Moltke und Roon. Mit der Fehrbelliner Straße wurde dem ersten Sieg Brandenburg-Preußens gedacht und mit der Ellerstraße einem Kommandanten der Sparrenburg. Nicht nur Militärisches sollte sich in den Straßennamen wiederfinden, sondern auch preußische Geistesgrößen.
Hof und Kotten der Geschwister Ummelmann – Heute Gemeindehaus
Dafür standen die Kant- und Humboldtstraße. Aus dem Rahmen fielen die Lamping- und Lina-Oetker-Straße. Lina Oetker wurde gedankt für die Stiftung der Musikhalle, die den Namen des gefallenen Sohnes trägt. Lamping machte sich um das Musikleben in Bielefeld verdient und setzte wichtige Akzente. Der von den Nazis aus dem Amt vertriebene Preußische Innenminister Carl Severing hatte sich in der Straße ein bescheidenes Wohnhaus errichtet. In einer Nazi-Hetzschrift gegen Severing wurde die Oetkerhalle als sein Wohnhaus abgebildet.
Je weiter wir uns vom Stadtkern entfernen, desto moderner und zeittypischer werden die Häuser. Wir finden Anklänge an den Bauhausstil und Nachkriegsbauten mit auffallend spitzen Dächern. Ein solches Haus steht auch in der Lina-Oetker-Straße (Nr. 17). Dieses Haus wurde 1953 von einem kinderlosen Ehepaar errichtet. Die Bauordnung zur Zeit der Wohnraumbewirtschaftung erlaubte pro Person nur eine vorgeschriebene Wohnfläche. Flächen unter Dachschrägen wurden erst ab einer Höhe von 1,50 Meter berechnet. Bauherren, die sich in dieser Zeit ein Haus bauten konnten waren nicht daran interessiert Mieter aufzunehmen. Das Nebenhaus (Nr. 15) ist viel größer. Darin wohnte eine Familie mit zwei Kindern und einer Großmutter. Bis kurz hinter der Einmündung der Stapenhorststraße finden wir eine Anzahl solcher Häuser. Das zeigt, wie attraktiv die Straße für ein, inzwischen wieder wohlhabendes Klientel blieb.
Die Wertherstraße war nicht nur eine Wohnstraße, sondern zahlreiche Geschäfte versorgten die Bewohner mit den Waren des täglichen Bedarfs. An der Ecke Grünstraße befand sich eine Gärtnerei mit einem hölzernen Verkaufspavillon für Blumen und auf der gegenüber liegenden Straßenseite das Feinkostgeschäft „Klötzer“. Es wurde in den Sechziger Jahren in die Niedernstraße verlegt. Neben der Gaststätte „Vahle“ befand sich eine kleine Bäckerei. An der Straßenkreuzung Roonstraße/Gr. Kurfürstenstraße befanden sich gleich drei Geschäfte. Die Kolonialwarenläden Bockermann und Kottemann, sowie die Fleischerei Ridder. Neben dem Lebensmittelgeschäft Kottemann lag der in zwei Generationen geführte Frisörsalon Sandmann. An der Ecke Humboldtstraße das Kolonialwarengeschäft Kolkhorst. Herr Kolkorst erkannte schon früh den Trend der Zeit und wandelte das Einzelhandelsgeschäft in einen Selbstbedienungsladen, genauer gesagt Lädchen mit einer Minikühltruhe, um.
Meine Mutter wurde für Herrn Kottemann eine Glücksfee, denn sie war seine erste Kundin. Meiner Großmutter fehlte etwas zum Kochen und siw schickte die Tochter zu dem neu von einem jungen Mann mit Kriegsverletzung eröffneten Geschäft. Als wir in die Wertherstraße 59 zogen wurden Lebensmittel überwiegend wegen des größeren Angebotes und des günstigeren Preises in der Obernstraße bei Hill gekauft. Aber es ergab sich, das meiner Mutter doch etwas fehlte und nach Jahrzehnten betrat sie das Geschäft, das noch immer bestehende Geschäft des Herrn Kottemann. Der gealterte Inhaber saß im hinteren Teil des Lädchens während seine Frau die Kunden bediente. Es war seine zweite Frau, die ihn umsorgte und die er nach dem Tode seiner ersten Frau geheiratet hatte. Nachdem meine Mutter den Einkauf beendet und bezahlt hatte ertönte aus dem Hintergrund die Stimme Kottemanns: „Magdalene, gib der Dame ein Bonbon, das war meine erste Kundin, die bekommt immer ein Bonbon!“ Und so blieb es auch. Manche Kundinnen waren etwas irritiert, meine Mutter bekam ein Bonbon und sie gingen leer aus. Nach dem Tode des Herrn Kottemann hat seine Witwe das Geschäft noch einige Jahre weitergeführt. Bei Frau Kottemann wurde aus Mitleid gekauft. Als mein Vater und ich von der Beerdigung meiner Mutter nach Hause kamen, lag vor der Wohnungstür ein Blumenstrauß und eine Beileidskarte mit der Bitte und Erklärung wir mögen die Blumen auf das Grab legend entschuldigen, sie wäre emotional nicht in der Lage gewesen die erste Kundin ihres Mannes auf ihrem letzten Wege zu begleiten.
Aber auch trinkfreudige Einrichtungen waren an der Werthersraße reichlich vorhanden. Es begann mit der Brauereiniederlage des Falkenkrugs gegenüber der Einmündung der Dornberger Straße, dann kam die noch heute bestehende Gaststätte „Vahle“ als bürgerliches Restaurant. Die nächste trinkfreudige Einrichtung was das nach dem Kriege verschwundene „Cafe Paradies“ mit einem angebauten Tanzsaal. Bis in die Siebziger Jahre war der Schriftzug über dem Saalanbau noch schemenhaft zu sehen.
Gaststätte „Vahle“ mit Bäckerei
Ein Großhandel mit technischem Glas hatte das Gebäude übernommen. Nur wenige Meter weiter befand sich das „Cafe des Westens“ in dem an den Wochenenden sogenannte „Dienstmädchenbälle“ mit einer Live-Kapelle stattfanden. Jetzt ist das „Cafe des Westens“ ein „Edelgrieche“. Im Bürgerpark wurde in der ursprünglichen Ziegelei Hagemeyer das Cafe Hagemeyer mit angeschlossener Konditorei betrieben. Der Bürgerpark war ursprünglich eine Tongrube und das spätere Café die Ziegelei und das Wohnhaus des Besitzers.
Die vormalige Verwendung ist noch an dem großen Schornstein zu erkennen. In einem großen Seitengebäude der Ziegelei war in der Kinderzeit meiner Mutter das Lager eines Lumpenhändlers untergebracht. Es war ein idealer Spielplatz für die Kinder der Nachbarschaft. Mit dem Nachteil, dass sie zuhause erst entlaust werden mussten. Die letzte Gaststätte an der Wertherstraße war „Brackensiek“, schon mehr ein Ausflugslokal mit einem großen, mit Kastanien bestandenen Biergarten. Die Gaststätte verfügte über einen Saalanbau, in dem die Vereine des Westens ihre Veranstaltungen abhielten. In dem Saal fanden auch Verkaufsveranstaltungen statt, die im Vorfeld mit Postwurfsendungen beworben wurden. Dazu gab es Lose mit attraktiven Haushaltsgeräten als Gewinne. Meistens handelte es sich um Werbeveranstaltungen für teure Dampfkochtöpfe mit enormer Energie- und Zeitersparnis. Als Gewinn gab es dann unter anderem ein „Rührgerät“, das sich als hölzerner Quirl entpuppte. Unter den Besuchern der Veranstaltung gab es eine große Empörung, dass Brackensiek sich zu solch betrügerischen Veranstaltungen zur Verfügung stellte.
Gaststätte Brackensiek – ursprünglich eine Ausspannstation
Die Gaststätte „Brackensiek" musste dem Neubau der Pädagogischen Hochschule weichen, wodurch der hintere Teil der Wertherstraße eine enorme Aufwertung erhielt. Das galt auch für die Hausbesitzer und Mieter größerer Wohnungen, die jetzt Zimmer an Studenten vermieteten.
Lange Zeit behielt die Straße den Charakter einer breiteren Kleinstadtstraße. Nur wenige Bewohner besaßen ein Auto, was auch nicht benötigt wurde da die Innenstadt fußläufig zu erreichen war. Die Spedition Wahl & Co lieferte größere Sendungen mit einem zweispännigen Pferdefuhrwerk an, die Firma Grave belieferte mit einem Einspänner die Gaststätten zum Kühlen der Getränke mit Stangeneis. Auch Milch wurde von dem Milchhändler Hermann Struck aus Dornberg mit einem Pferdewagen geliefert. morgens um vier Uhr ertönte Pferdegetrappel auf der mit Blaubasalt gepflasterten Straße und die Bewohner wussten, dass Herr Struck zur Molkerei fuhr und die Milchversorgung für den Tag gesichert war. Auf dem Rückweg blieb Freia, so hieß das Pferd, vor den Gaststätten an der Wertherstraße stehen, weil es bei denen Futter bekam und getränkt wurde. Bei der Gelegenheit nahm der Kutscher ein klares Wässerchen zu sich. Der letzte Steinhäger wurde bei Brackensiek vertilgt.
Dann schlief Herr Struck auf dem Kutschbock ein, was auch unproblematisch war da das Pferd seinen Weg in den heimatlichen Stall alleine fand. Bis zu dem Tage, an dem ein Autofahrer an der Einmündung der Wertherstraße in die Stapenhorststraße auf seiner Vorfahrt bestand und nicht verstehen konnte, dass Tradition Vorfahrt haben könnte. Freia landete beim Rossschlächter und der Milchverkauf wurde von der Tochter Strucks aus einem Lieferwagen weitergeführt. Wobei das Sortiment um Milchprodukte (Butter und Käse) erweitert wurde. Diese Periode war nur von kurzer Dauer da die Molkerei Bielefeld (Mobi) die Vertriebsform änderte und ihre Milch in Flaschen verkaufte, oder in dreieckigen Papierbehältern, den sogenannten „Picasso-Eutern“. In dem schneereichem Winter 1953/54 habe ich noch erlebt, dass Herr Struck die Milch mittels eines Pferdeschlittens auslieferte.
Ab sechs Uhr war auf der Wertherstraße ein fröhliches aber falsches Pfeifen zu hören. Dann war der „Flötjer“ unterwegs, der Stoffbeutel mit frischen Brötchen von der Bäckerei Pörschke in der Stapenhorststraße an die Haustüren hing. Die Bewohner der Wertherstraße mussten auf Annehmlichkeiten nicht verzichten.
Und die Wertherstraße hatte einen eigenen Wetterdienst! Wenn in den frühen Morgenstunden das Pfeifen der Dampflokomotiven vom Brackwerde Güterbahnhof zu hören war würde es mit hundertprozentiger Sicherheit regnen. Nachdem die Bahnstrecke elektrifiziert wurde existiert dieser Wetterservice nicht mehr.
Villa des Verlegers Klasing, Stattarchiv und Kunsthaus. Opfer des Ostwestfalen Dammes. Eine Keimzelle der Straße verschwindet