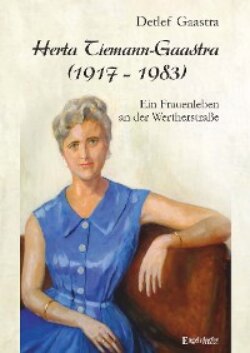Читать книгу Herta Tiemann-Gaastra (1917 – 1983) - Detlef Gaastra - Страница 7
DIE FAMILIE
ОглавлениеDer Name „Tiemann“ kommt in den verschiedensten Schreibweisen vorwiegend im Norddeutschen Raum vor (Thiemann, Timann, oder auch nur mit einem „n“). Ein „Tie“ bezeichnete in einer Ortschaft einen Platz, der auch zu Versammlungszwecken diente. Vermutlich besteht auch eine sprachliche Nähe zum germanischen „Ting“ als Beratungsort. Der Tiemann wird vermutlich am Tie gewohnt haben oder war verpflichtet den Platz für die Allgemeinheit in Ordnung zu halten.
Die Tiemanns scheinen keine große Rolle gespielt zu haben. Wikipedia nennt zwar eine größere Zahl erwähnenswerter Namensträger, aber keine herausragenden Persönlichkeiten. In Bielefeld gab es einen Kommerzienrat Tiemann, der bei der Industrialisierung der Stadt eine Rolle gespielt hat. Seine Villa befand sich an der Niedernstraße, gegenüber der heutigen Handwerkskammer. Das stattliche Haus wurde abgerissen als die Kunsthalle erbaut wurde. Vermutlich weil es die Sichtachse auf den Bau von Philip Johnson beeinträchtige. Der Kommerzienrat ist nicht mit der hier behandelten Familie verwandt.
Auffallend ist, dass die Reihe der bedeutenden Namensträger erst im 19. Jahrhundert beginnt. In der vorangegangenen Zeit scheinen keine nennenswerten Taten vollbracht worden zu sein.
Die Herkunft liegt im Dunkel. Als ein Vetter meiner Mutter für die Anstellung als Lehrer einen Ahnenpass benötigte um drei Generationen Reinrassigkeit nachzuweisen, wies die Herkunft auf Schildesche hin. Andere Aufzeichnungen nennen Quelle Nr.1 als Herkunft. Quelle gehörte zum Kirchspiel Brackwede und deren Kirchenbücher befinden sich in einem schwer lesbaren Zustand und machten mir Nachforschungen nicht möglich. Ich schließe nicht aus, dass es sich bei dem Schriftstück aus Schildesche um ein Gefälligkeitsgutachten handelt. Das wurde häufig praktiziert, weil die Pfarrer wenig Lust verspürten die alten Bücher zu wälzen, und sie eine Abneigung gegen das Naziregime hatten. Die Zugehörigkeit zur Bekennenden Kirche im Ravensberger Land war besonders hoch.
Quelle Nr. 1 bezeichnete den Hof Meyer zu Olderdissen. Die Nummerierung erfolgte nach der Größe des Landbesitzes. Ein Blick auf die Flurkarte bestätigt die Berechtigung in Quelle die Nummer 1 zu sein. Mittelpunkt war der jetzige Tierpark mit dem Ausflugslokal als Meierhof. Die Grenze zur Stadt Bielefeld verlief entlang der „Sieben Hügel“ umfasste die Ochsenheide, das Gebiet des Bauernhausmuseums und das Johannistal. Der Kahle Berg war die andere Begrenzung. Der Johannisberg war städtischer Besitz.
Meine Urgroßmutter entstammte der Familie des Meierhofes Olderdissen, auch wenn sie in den Unterlagen nicht so genannt wurde. Das lag daran, dass die Bezeichnung „Meier zu“ nur dem Inhaber des Meierhofes zustand. Dadurch wird die Erstellung eines Stammbaumes erschwert. Die Geschichte des Meierhofes zu Olderdissen ist noch nicht geschrieben worden. Kompliziert werden die Familiengeschichten noch durch eine Besonderheit im ländlichen westfälischen Erbrecht. Der jüngste Sohn erbte den Hof und musste seine älteren Geschwister auszahlen. Dadurch war sichergestellt, dass die Altbauern lange auf dem Hof bleiben konnten, um dann aufs Altenteil (in Ravensberg „Leibzucht“ genannt) zu ziehen. Meine Urgroßmutter hatte nur zwei Schwestern und keine Brüder. Die Linie starb somit im Mannesstamm aus. Die älteste Schwester heiratete einen Meyer zu Senden, der Meyer zu Olderdissen genannt wurde. Durch eine Todesanzeige aus dem Jahre 1946 ist bekannt, dass ein „Meier zu Senden, genannt Meyer zu Olderdissen“ in Bielefeld verstorben ist. Das dürfte deren Sohn sein. Die andere Schwester heiratete standesgemäß einen Großbauern im Fürstentum Schaumburg-Lippe.
Die jüngere Tochter meiner Urgroßmutter heiratete einen Mann der als Stahlarbeiter in Dortmund arbeitete. Diese Dame hieß Fredericke und muss das Leben wohl sehr leicht genommen haben. Meiner Mutter wurde vorgeworfen sie hätte den gleichen Charakter wie ihre Tante. Einen Arbeiter aus dem Ruhrgebiet zu heiraten war absolut unmöglich. Der Vorwurf der wirtschaftlichen Unsicherheit wurde von ihr mit dem Satz „kriegen wir nichts, haben wir nichts, dann gehen wir umso leichter“ abgetan. Es gab unzählige Anekdoten über sie. So ist eine Nachbarin zu ihr gelaufen und hat gerufen „kommen Sie schnell, Ihr Mann prügelt sich in der Kneipe“. Sie soll von ihrer Handarbeit nicht aufgesehen und geantwortet: haben: „Na und? Wenn er genug hat wird er schon nachhause kommen.“ Das könnte durchaus zum Charakter meiner Mutter passen. Zu der Familie in Dortmund hat Kontakt bestanden und die Tochter hat meine Großmutter auch noch in Bielefeld besucht. Aber es wurde Distanz gewahrt, weil sie in der Nazizeit Aufseherin in einem Frauengefängnis war. Über Einzelheiten wurde nicht gesprochen.
Es gibt nur ein Familienfoto, von dem nicht bekannt ist wann und zu welchem Anlass es aufgenommen wurde. Vermutlich zum 65. Geburtstag der Mutter. Die Aufnahme sagt viel über die Familie aus.
In der Mitte sitzt Frau Tiemann in Ravensberger Witwentracht, umgeben von ihrer Kinderschar. Mein Großvater steht oben rechts, er war das jüngste Kind. Der Altersunterschied zu den Geschwistern war sehr groß. Meine Mutter hat das sehr bedauert, denn dadurch hatte sie Vettern, die im Alter ihres Vaters waren. Mein Großvater war erst vier Jahre alt, als sein Vater verstarb.
Auf dem Bild ist zu sehen, dass alle sehr gut gekleidet sind und einen bürgerlichen Eindruck machen. Die Familie gehörte nicht zur Gruppe der Heuerlinge oder Kötter. Außer meinem Großvater haben es auch alle es einem gewissen Wohlstand gebracht. Er war auch der einzige der es nicht zu eigenem Grundbesitz gebracht hat, sondern nur zu einem Schrebergarten. Und auch der war kein Eigentum, sondern gepachtet.
Mutter Tiemann war eine geborene Olderdissen (korrekt Meier zu Olderdissen) und muss nach dem Tode ihrer Eltern einen erheblichen Erbteil bekommen haben. Das Haus in dem sie wohnte liegt auf der Ochsenheide hinter dem Bauernhausmuseum und gehört nicht zu dem Museumskomplex, Es war das einzige Haus auf dem Areal, auch wenn es heute so aussieht als sei es der Kotten zum Haupthaus. Aber dafür ist das Haus zu groß geraten, es sieht eher wie ein kleines Gehöft aus. Es ist sicherlich als Leibzucht, also Altenteiler für den Altmeyer errichtet worden. Der Balken über der Toreinfahrt nennt zwar Meyer zu Olderdissen als Erbauer aber hat keinen Hinweis auf einen Ruhesitz. Das der reichste Bauer von Quelle auch im Alter standesgemäß wohnen will ist nachzuvollziehen.
An der Ehe meiner Urgroßmutter haftete ein Makel. Während die ältere und jüngere Schwester standesgemäß heirateten ging sie (vermutlich) eine Liebesheirat ein und verband sich zum Schrecken der Familie mit einem Schäfer, der wochenlang mit seinem Schäferkarren durch die Lande zog. Im Standesregister wird er als Heuerling, also Tagelöhner, bezeichnet. Vermutlich stand er im Dienste des Meierhofes. Aber die Ehe war mit acht wohlgeratenen Kindern gesegnet, aus denen allesamt etwas geworden ist. Die älteste Tochter war Geschäftsfrau und führte in Bielefeld ein Kurzwarengeschäft. Die mittlere zog nach Dortmund, darüber habe ich schon berichtet. Über ihre Ehe ist außer zahlreichen Anekdoten nichts Nachteiliges bekannt. Die jüngste Tochter Friedericke blieb bis zum Ableben bei der Mutter und heiratete einen Tischlermeister. Sie war der gute Geist der Familie und hielt sie zusammen. In ihrem Haus versammelte sie die Familie und mein Großvater hat bis zu seiner Hochzeit mit 32 Jahren bei Ihr gewohnt. Das war nicht „Pension Mama“, sondern „Pension Schwester“. Mein Großvater und meine Mutter hatten zu Rickchen, wie sie im Familienkreis genannt wurde ein inniges Verhältnis.
Es gibt ein Indiz, dass ein gewisser Wohlstand und entsprechende Verbindungen bestanden haben. Mein Großvater bekam 1891 von seinem Paten zur Konfirmation eine vergoldete Taschenuhr, mit Uhrkette und einem mit kleinem Rubin verziertem Behälter für ein Foto. Es existiert keine Fotografie meines Großvaters, auf dem die Uhrkette nicht zu sehen ist. Die Uhr muss seinerzeit ein Vermögen gekostet haben. Selbst für das achte Kind eines einfachen Landarbeiters fand sich ein solventer Taufpate.
Die Taschenuhr meines Großvaters, die auf jedem Foto, das es von ihm gibt zu sehen ist. Die Uhr war bis 1968 voll Funktionsfähig.