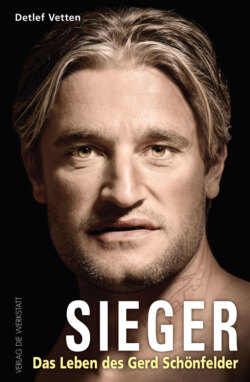Читать книгу Sieger - Detlef Vetten - Страница 7
ОглавлениеSCHICKSAL
11. September 1989. Hersbruck. 16.41 Uhr.
Das ist der Moment, auf den alles zugelaufen ist.
Gerd Schönfelder ist auf einer neuen Baustelle. Da er fast fertig mit seiner Ausbildung ist, wird er schon wie eine reguläre Arbeitskraft als Elektroniker eingesetzt. Er wird auf Montage geschickt, muss sich auf wechselnde Arbeitsplätze und immer neue Anforderungen einstellen.
Berufsleben eben.
Am Freitag hat ihm der Arbeitgeber noch gesagt, vielleicht müsse er am Montag nicht nach Nürnberg kommen. Vielleicht Marktredwitz. Oder eine andere Baustelle in der Region.
»Schau’n mer mal, habe ich mir gesagt. Auf jeden Fall klingt das mal nicht schlecht, dass ich nicht in die Stadt muss. Mein Chef hat gemeint, er meldet sich bei mir. Okay, habe ich gesagt, alles gut, das Wochenende kann kommen.
Samstag habe ich nichts gehört, am Sonntag habe ich versucht, ihn telefonisch zu erreichen. Hat nicht geklappt. Also ist mir nichts anderes übriggeblieben, als am Montag nach Nürnberg zu fahren.«
Beim Frühstück sagt er zur Mutter: »Du, ich fahr heut mit dem Motorrad.« Dann ist wenigstens der Weg zur Arbeit nicht so fad. Gerd liebt es, mit seiner 600er XT unterwegs zu sein. Ist doch was ganz anderes als das Rumsitzen in einem Zug, in dem lauter Menschen in die Woche starten.
»Nein«, meint die Mutter. »Das machst nicht. Nimm lieber den Zug, das ist gescheiter. Ist nicht so gefährlich.«
»Aber schau, wir haben schönes Wetter, und mit dem Motorradl macht es doch viel mehr Spaß.«
»Ja, und ich habe die Sorgen.«
»Und wenn die jetzt in Nürnberg sagen, dass sie mich woanders haben wollen, dann bin ich flexibel. Brauch mich an keine Fahrpläne halten. Und du weißt es eh, dass ich um sechs Uhr verabredet bin. Ich hab versprochen, dass ich da was im Bad mache. Wird mit der Bahn saumäßig knapp.«
»Nein, Gerd, tu mir einen Gefallen: Lass des Motorradl stehen und nimm den Zug.«
Was soll’s? Streiten muss man deswegen nicht. Gerd nimmt den Zug.
Kommt in der Lehrwerkstatt an, da kratzen sie sich am Kopf und wissen nicht, was sie mit dem Burschen anfangen sollen. Letztlich schicken sie ihn hinaus zum Hafen, zur AEG-Werkstatt. Dort werde sich schon eine Arbeit finden.
Er ärgert sich übers Durcheinander, kommt in der Werkstatt an, läuft dem Capo über den Weg.
Der überlegt kurz.
»Na ja, jetzt bist schon da, jetzt bleibst auch da.«
Fängt ja super an, die Woche. Gerd wurschtelt vor sich hin und sinniert, wie er denn wohl vom Hafen pünktlich zurück nach Kulmain kommt, wo der Spezl ihn um sechs in dem halb fertigen Bad erwartet.
Gerd Schönfelder ist schon immer einer gewesen, der seine Termine eingehalten hat. Er macht mit einem Kumpel etwas aus, das gilt dann auch. Er mag es nicht, wenn andere unpünktlich sind. Und er ist bekannt dafür, dass man sich auf ihn verlassen kann. Deswegen ist die Frage, wie er es mit den Öffentlichen zuverlässig bis zum frühen Abend nach Hause schaffen kann, für ihn an diesem Montag ein echtes Problem.
»Das war ja alles nicht so einfach. In der Lehrwerkstatt hatte ich einen U-Bahn-Anschluss an der Muggenhofer Straße, da kannte ich meine Verbindungen und wusste, wann ich welchen Zug nehmen musste. Jetzt war ich aber im Hafen. Von dort zum Bahnhof und vom Bahnhof nach Hause – das war eine neue Situation.
Auwehzwick, dachte ich, das wird wirklich knapp. In der Mittagspause bin ich zur Bushaltestelle gelaufen und habe den Fahrplan angeschaut. Dann war mir klar: Das schaffe ich nicht.«
Er schlurft missmutig zurück zur Werkstatt. Nach der Mittagspause trifft er einen Kollegen, dem er erzählt, dass heute wirklich verdammt viel schiefläuft.
Der Kollege versteht. »Du«, sagt er, »ich fahre eh nach Hersbruck – ich kann dich beim Bahnhof absetzen, wann geht denn dein Zug?«
»Um zwanzig vor fünf«, antwortet Schönfelder.
Kein Problem. Man treffe sich um vier am Parkplatz, dann habe man alle Zeit der Welt.
»Das wär super.«
»Na, dann ist es abgemacht.«
Gerd Schönfelder schlendert fröhlich an seinen Arbeitsplatz zurück. Er ist schon ein Hans im Glück. Hat er ja immer wieder, dass sich die Dinge in seinem Sinne fügen.
»Dann tut es einen Schlag …«
16 Uhr. Arbeitsende. Schönfelder packt die letzten Sachen in den Rucksack, marschiert mit dem Kollegen zum Parkplatz, sie steigen ein.
»Halt!«, sagt der Kollege. »Einen Augenblick, ich habe was vergessen.«
Steigt aus und läuft eilig zurück in die Werkstatt. Schönfelder sieht ihn zurückkommen, schaut auf die Uhr und bleibt optimistisch. Wird schon klappen, denkt er.
Es ist acht nach vier.
Sie fahren los, rauf auf die Autobahn und rein in den Stau. Um die Zeit ist das nichts Ungewöhnliches.
Schönfelder kontrolliert die Uhr im Minutentakt. Der Wagen bewegt sich quälend langsam vorwärts. Die Chancen, den Zug zu erreichen, sinken.
Endlich die Ausfahrt. Sie verlassen die Autobahn, ordnen sich ein, bewegen sich auf eine Ampel zu. Die steht schon lange auf Grün, sie sind fast an der Kreuzung, die Ampel schaltet von Grün auf Gelb.
Der Kollege bremst. Er ist ein vorsichtiger Fahrer.
»Ich weiß noch, dass wir die Ersten gewesen sind, die an der roten Ampel standen. Ich hätte – so bin ich immer gewesen – noch Gas gegeben, er hat halt ziemlich stark gebremst.
Wir sind da vor der roten Ampel gestanden, und ich habe gemeint: ›So, des war’s jetzt.‹
Wie lang steht so eine Ampel auf Rot? Nach meinem Gefühl ist es eine Minute gewesen, und ich dachte, das ist genau die Minute, die mir fehlt.«
Schönfelder sieht hinüber zur Eisenbahnbrücke über die A9, da macht er den Zug aus, der ihn pünktlich nach Hause bringen soll. Im Affentempo fährt der in Richtung Hersbruck.
Sie folgen der Bahnlinie. Kommen am Bahnhof an. Schönfelder hat die Tasche und die Jacke griffbereit. »Danke und servus!« Er gleitet aus dem Auto, wirft die Tür hinter sich zu, rennt los.
Er ist keiner, der so schnell aufgibt. Das Rennen um die letzte Chance hat er im Blut. Wenn die anderen schon aufgeben, macht er noch weiter. Das kennen sie im Fußballverein, das erleben die Spezln immer wieder, wenn sie mit dem Gerd zum Motorradfahren gehen. Da kommen sie an ein Wasserloch – und alle bleiben stehen und schauen sich um, wie sie das Hindernis umfahren können. Der Gerd kann das nicht. Er nimmt Anlauf und rast mit Vollgas ins Wasser. Entweder kommt er am anderen Ufer als der Sieger raus – oder er bleibt stecken und landet mit der ganzen Montur in der Brühe. Na ja, dann schleppt er die Maschine aus dem Schlamm, lässt sie wieder an und fährt weiter. Probiert hat er es wenigstens.
Gerd sprintet die Bahnhofstreppe hinunter. Zwei, drei Stufen auf einmal. Leute kommen ihm entgegen.
Einer ruft dem rennenden jungen Mann zu: »Kannst vergessen, der ist schon weg.«
Jetzt versucht er es erst recht. Treppe hoch, Gerd sieht die Waggons noch auftauchen.
Er nimmt die letzte Stufe.
Der Zug ist schon in Bewegung.
»Ich denk irgendwie: ›Ah, der is ja noch da.‹ Renne hin. Mache eine Türe auf. Dann geht alles so fürchterlich schnell.
Ich habe ja die Tasche und die Jacke in der Hand. Loslassen will ich sie nicht, in den Waggon schmeißen geht auch nicht.
Alles verheddert sich an der Klinke, ich renne neben dem Waggon her, der rechts von mir immer mehr an Fahrt aufnimmt.
Ich laufe, laufe, laufe. Immer schneller. Die Hand am Griff der aufgeschwenkten Tür.
Irgendwann kann ich das Tempo nicht mehr halten.
Ich schlage mit dem linken Knie am Bahnsteig auf. Denke, jetzt ist die Kniescheibe in Stücken.
Das Knie schlägt wieder und wieder auf.
Das Ende des Bahnhofs kommt rasend näher. Und dann – wie soll ich es sagen? –, dann zieht es mich rein. Wusch!
Ich rutsche aus.
Wusch! Ich weiß ja auch nicht.
Auf einmal ist es dunkel.
Ich rechne damit, dass ich irgendwo aufschlage.
Aber es zieht mich zwischen den Zug und den Bahnsteig in diese 30-Zentimeter-Lücke.
Dann wird es dunkel. Und ich denke: ›So, jetzt wird es gefährlich.‹ Ich ziehe den Kopf ein. Sehen tue ich nichts mehr, weil ich die Augen zu habe.
Ziehe den Kopf ein und denke: ›So klein wie möglich machen.‹ Dann tut es einen Schlag.
Bumm!
Ich kann nicht einschätzen, was los ist. Nur dieser Schlag. Bumm!
Der Zug ist weg, es wird wieder hell, ich weiß, dass etwas Schlimmes passiert ist, da passt etwas nicht, kein Mensch in der Nähe, ich stehe auf und schleppe mich zurück zum Bahnhof, das ist ja ein ganzes Stück, es kommt mir vor wie zwei-, dreihundert Meter, ich erreiche den Bahnsteig.
Da sitzt einer auf einer Bank.
Der schaut mich an wie ein Alien. Ist so unter Schock, dass er gar nichts macht. Schaut nur. Stottert, ruft: ›Hilfe, Hilfe!‹
Jemand anders kommt auf mich zu. Noch einer, noch ein paar. Sie ziehen mich aus dem Gleisbett auf den Bahnsteig, legen mich auf die Bank, so eine Holzbank.
Dann liege ich da.
›Wahnsinn!‹, denke ich. Ich weine.
Dann legt mir einer den Arm auf den Bauch. Der hängt noch in Fetzen am Körper, aber ich spüre ihn nicht. Das könnte auch der Arm eines Fremden sein, der da auf meinem Bauch liegt.«
»Bitte net amputieren, bitte net amputieren!«
Später wird er ein Gefühl zeitlebens nicht mehr los. Er hat keine Phantomschmerzen, von denen ihm andere Menschen berichten, denen Gliedmaßen abhanden gekommen sind. Aber auf der rechten Seite des Rumpfes schleicht sich immer mal wieder so ein Kribbeln ein. Oder alles ist ganz taub. Das hat er in den Oberschenkeln – vor allem nachts und morgens. Und das kann auch in einem Arm auftreten, den es nicht mehr gibt.
Auch 26 Jahre nach dem Unfall, den er Abertausende Male in seinen Erinnerungen hat ablaufen lassen, kann Schönfelder nicht erklären, was genau geschehen ist. Dabei ist er ein rationaler Mensch, der den Dingen auf den Grund geht. Er will begreifen, wie etwas funktioniert – dann kann er darüber auch nachdenken. Er analysiert Probleme, um sie zu lösen. Aber die Sache mit dem Arm ist so ungeheuerlich, wie soll man die erklären?
»Ich nehme mal an, dass irgendwas unten am Zug rausgestanden ist, der Oberarm ist in die Schulter reingedrückt und anschließend mit der Schulter aus dem Oberkörper gerissen worden. Da sind alle Nerven aus dem Rückgrat gefetzt worden – alles, was eben an so einem Arm dranhängt. Geblieben ist schließlich nur dieses Phantomgefühl. Eine Taubheit in den Fingern, die es ja gar nicht mehr gibt. Eine Erinnerung an ein Körperteil, das mal zu mir gehört hat. Verrückt, oder?«
»Ich liege also auf dem Rücken, und sie legen mir den Arm auf den Bauch. Dass auch mit der linken Hand ein Unglück geschehen ist, merke ich gar nicht. Keine Schadensmeldung ans Gehirn, kein Alarm, kein Schmerz. Mir ist nicht bewusst, dass die auf der Schiene liegt.
Ich überlege: ›Soll ich den rechten Arm anschauen oder nicht?‹ Ist ja seltsam, was in einem Menschen in so einem Moment vorgeht.
Arm auf dem Bauch. Die Ahnung, etwas ist ganz schlimm. Und das ganz klare Abwägen: ›Eigentlich mag ich gar nicht hinschauen. Aber andererseits – wenn ich jetzt nicht gucke, werde ich das alles vielleicht nie mehr sehen. Das ist meine letzte Chance.‹
Also, ich gucke und stelle fest, dass die rechte Hand da ist. Aber sie hat eine unnatürliche Farbe, so ein dunkles Lila habe ich noch nie an einem Menschen gesehen. Die Hand ist ganz, aber in ihr zirkuliert kein Blut mehr.«
Wenn er das erzählt, bemüht er sich um einen beiläufigen Ton. Er beschreibt seinen abgerissenen Arm, das Aufschlagen der Knie auf dem Bahnsteig, das Mitgeschleiftwerden umsichtig und mit Sorge um jedes Detail.
Ob ihm das schwerfällt?
Gerd Schönfelder schweigt einen Augenblick, weil er nichts Falsches sagen will. Die Antwort kommt zögernd: »Noja, man durchlebt es halt noch einmal ein bissl. Aber es ist jetzt nicht schlimm.«
Nein, er merkt, so geht es nicht. Er mag ja nichts Unwahres sagen.
»Aber es ist schon intensiv. Wenn du das so in den Einzelheiten erzählen willst, dann musst schon noch mal – dann muss das eben noch mal so ablaufen.«
Aber wie kann man so eine Erinnerung ertragen? Sieht er sich da wie in einem Film von außen?
»Nein!«, sagt Schönfelder sehr schnell und mit starker Stimme. Das muss er jetzt schon einmal klarstellen: »Das schaue ich mir doch nicht von außen an. Da bin ich ganz in mir drin, das ist lebendig. Wie ich da so liege und sage: ›Bitte net amputieren, bitte net amputieren!‹ Das sehe ich so, wie ich es erlebt habe. Davor will ich mich doch nicht drücken.«
»Und dann sage ich immer: ›Bitte net amputieren, bitte net amputieren!‹ Mittlerweile ist auch ein Arzt in Zivil da. Der beruhigt mich, man werde das schon wieder hinbekommen. Aber ich muss mir die Bescherung nur angucken, dann merke ich schon, dass ich ein Problem habe.
Die Knochen stehen in die Luft, die Haut ist in Fetzen. Da ist nichts mehr normal.
Die Leute versuchen, die Blutung zu stoppen. Mittlerweile sind auch die Sanitäter und der Notarzt da. Sie heben mich auf eine Trage, schaffen mich zum Rettungswagen, es geht mit Blaulicht zum Krankenhaus in Hersbruck, ich komme in die Notaufnahme, drei Ärzte kümmern sich um mich.
Mit der Zeit sind diese Schmerzen gekommen. Sie werden immer heftiger. Ich liege in der Notaufnahme und halte es nicht mehr aus.
›Jetzt müsst’s mir was geben!‹
Dann gehen die Lichter aus.«
Wenn er es noch einmal ablaufen lässt nach all diesen Jahren, sieht er jedes Mal von Neuem auf einen Gerd Schönfelder, der ihm fremd ist. Da liegt einer, dem gerade der Arm abgerissen worden ist. Der junge Mann schleppt sich blutend zurück zum Bahnhof. Er denkt und redet mit den Leuten …
»Und am Anfang betäubt der Schock alles. Ich hatte die Kontrolle über mich verloren. Tat es weh? Brannte es? Zog es? War’s kalt oder heiß? Wie soll man das erklären? Ich denke, es war so, als ob einem jemand mit einem Vorschlaghammer auf die Kniescheibe haut – im ersten Moment kannst du nicht sagen, ob es wehtut oder nicht.«
Das war, sagt er, ein so dumpfes Ding in seinem Körper, dass er nichts mehr einordnen konnte. »Wenn du dir nur in den Finger schneidest oder in einen Nagel trittst, weißt du, wie weh es tut.« Aber damals auf dem Bahnhof hat ihn im ersten Augenblick der Körper mit seinem Schockreflex beschützt.
Der Hubschrauber bringt den erstversorgten Gerd Schönfelder ins Klinikum Erlangen. Acht Stunden wird er operiert. Ein Team hält ihn am Leben. Da sind die Spezialisten fürs Amputieren, fürs Retransplantieren, die Haut- und Gefäßexperten, Neurologen.
Die Task Force wird von Walter Wagner geleitet. Das ist ein erfahrener Mann – aber ein solcher Fall kommt ihm auch nicht so oft auf den Tisch. Jahre später treffen der Chirurg und der mittlerweile schon erfolgreiche Sportler sich wieder. Schönfelder: »Das war selbst für ihn ein besonderer Fall. Normalerweise ist die Geschichte – wenn einer in meinem Zustand eingeliefert wird – gelaufen.«
Tagelang im Delirium
Schönfelder wacht auf. Na ja, »wach« ist das falsche Wort. Er duselt tagelang in einem Delirium. Das Zimmer ist abgedunkelt. Immer wieder huscht eine Schwester herein und sieht nach dem Rechten. Der Arzt kümmert sich. Apparate fiepen, durch Kanülen wird der Körper mit Überlebensmedizin und Schmerzmitteln versorgt.
Um sieben Uhr morgens wird am Dienstag sacht die Tür geöffnet. Die Mutter und der Vater drücken sich ins Zimmer. Sie haben am Vorabend vom Unfall erfahren und sich nach schlafloser Nacht ins Auto gesetzt. Nun treten sie ans Bett und sehen den Buben.
Wachsweiß. Hängt an Schläuchen. Ist am ganzen Körper bandagiert. Die Mutter und der Vater zwingen sich, nicht zu weinen. Was für eine Ohnmacht.
Sie kommen jeden Tag. Sitzen am Bett und sehen zu, wie der Sohn um sein Leben ringt. Jeden Tag wird es ein wenig besser. Irgendwann sagt der Doktor, der Bursche werde es packen. Die Eltern sehen auf den bandagierten Körper und richten sich auf den Kampf für ihren Sohn ein.
Wie das alles wird?
Wer weiß so etwas schon? Wer rechnet mit so einem Unglück?
Eines Tages kommen sie in dieses Zimmer, und der Sohn schaut sie an. Man braucht ja nicht groß über Gefühle zu reden, man hat sie für den anderen. Man weiß, wie mächtig Sorgen sein können.
Gerd also sieht seine Eltern an und sagt (seine Stimme ist nicht mehr so dünn wie anfangs, sie klingt schon wieder voll und zuversichtlich wie vor dem Unfall): »Jetzt macht’s euch amal keinen Kopf. Die Füß sind ja noch dran.«
Der Chefarzt tritt ans Bett des Patienten. Er spricht ein paar Takte mit Gerd Schönfelder, der sich schwertut, zu folgen. Die OP ist zwei, drei Tage her, noch ist alles verschwommen.
Walter Wagner sagt etwas Beruhigendes, dann unterhält er sich mit Gerds Eltern, die die Szene im Hintergrund verfolgt haben. Das dringt in Schönfelders Bewusstsein, aber so, als sprächen die Eltern und der Doktor über einen Fremden. Nur Fetzen bleiben hängen. Ihm ist zumute wie einem blöd Betrunkenen – der hört zu, aber eigentlich ist ihm alles auch wieder wurscht.
»Er ist über den Berg …«
»Man wird sehen, was mit dem linken Arm möglich …«
»Erst einmal müssen wir den Kreislauf stabilisieren …«
»Die Schmerzen sind am ganzen Körper …«
»Du wirst immer klarer im Kopf. Und realisierst immer mehr: ›Ach, Scheiße, es ist jetzt wirklich so.‹ So schlimm, so unwiderruflich schlimm. Zefix, der Arm ist weg – und er wird auch nicht mehr kommen.
Das Ausmaß wird deutlicher und deutlicher. Du hast jetzt echt ein Problem.«
Für den ungeduldigen Mann, der vor ein paar Tagen noch die Welt hätte einreißen können, ist es ein Martyrium. Da liegt er und denkt an den Arm, der ihm weggekommen ist.
Gerd Schönfelder mag es nicht, zu jammern. Wenn er sich vor dem Unfall ein Unglück eingefangen hat, hat er nicht lange geklagt. Er hat sich geschüttelt, nach vorne geschaut, seine Zukunft für sich hingebogen.
Es gibt einen Sportlerspruch für den Fall, dass etwas schiefgelaufen ist: Mund abputzen, weitermachen! Das heißt: Die blöde Geschichte abhaken, es werden bessere Tage kommen.
Nun liegt er da und kann sich kaum rühren. Er hat Schmerzen wie noch nie in seinem Leben. Der Arm ist ab.
Gerd reißt sich zusammen und versucht, positiv zu denken. Da gibt es ja noch die linke Hand, immerhin. Die steckt zwar im dicken Gips. Aber er spürt sie noch. Die ist ja da, die Hand. Die Nerven spielen ja Klavier in seinem Kopf. Das ist doch okay. Herrgott noch mal, nun ist das Unglück passiert, jetzt kann er es auch nicht mehr ändern.
Mund abputzen! Weitermachen!
Dann wechseln sie den Gips. Schönfelder schaut der Schwester zu, wie sie behutsam alle Verbände löst.
»Und da sehe ich, dass praktisch nichts mehr übrig ist. Nur der Daumen. Sonst ein Rest vom Handballen – und nix. Nichts. Nix mehr.
Nix – kann man sagen.
Der Daumen ist schwer verletzt, fixiert in einem Durcheinander von Eisen und Schrauben. Der sieht nicht gut aus, echt nicht. Das ist der nächste Schock.
Heftig. Dieses ungewohnte Bild. Das muss dein Hirn doch erst mal verarbeiten, dass das deins ist.
So schaust du also jetzt aus. Ein Arm weg. Ein Daumen und nix. Ein paar Tage vorher bin ich noch braungebrannt gewesen, kurz nach dem Urlaub. In bester Form. Ich bin voll im Saft gewesen, ein sportlicher Kerl. Und nun kann ich zusehen, wie die Muskeln von Tag zu Tag verkümmern, wie ich weniger und weniger werde. Ich bin nicht mehr braun, ich bin käsweiß. Alles, die Bräune, die Kraft, alles ist so schnell weg, als würdest du das Licht ausmachen.
Und dieser kaputte Daumen als Rest.
Ich bin so, bin so … so verstümmelt.«
Dazu kommt, dass Gerd Schönfelder von Hals bis Fuß ramponiert ist. Das Knie ist kaputt, am rechten Knöchel müssen die Ärzte reparieren.
Das Schmerzhafteste sind die Verletzungen am Gesäß. Mit der linken Seite ist Gerd auf einen Gegenstand geknallt. Könnte die Bahnsteigkante gewesen sein. Dabei ist der Ischiasnerv gequetscht worden.
Das linke Bein ist »von der Ansteuerung her total im Eimer«. Es droht ein Spitzfuß, weil die Muskeln die unteren Extremitäten nicht mehr bewegen. Gerd wird eine Plexusschiene angepasst, die den Fuß nach oben zwingt. Das muss sein, um die nächste Behinderung zu vermeiden. Folge der Schiene: Nach ein paar Tagen kann der Patient seinen Fuß nicht mehr nach unten drücken.
Die Schmerzen, die vom Ischias und vom Hintern ausgehen, sind kaum auszuhalten. Ein riesiger Bluterguss ist aus dem Fleisch geschnitten worden. Gerd liegt auf einem Spezialbett – doch das hilft nicht viel. Die vielen Schmerzmittel vernebeln den Kopf – aber nach einer Viertelstunde wirken sie nicht mehr gegen die Qualen.
Den Schmerz hat er in großer Intensität bis Weihnachten. Die ersten zwei Wochen ganz extrem, es wird mit der Zeit ein wenig besser, aber weh tut es Tag und Nacht.
Bier auf ärztliche Anweisung
Zwei Wochen liegt er in Erlangen. Nach zehn Tagen kann er sich leicht aufsetzen, er schafft es in den Rollstuhl. Er wiegt noch 57 Kilo, bei einer Größe von 1,85 Meter, vor dem Unfall sind’s 78 gewesen.
Er bekommt Fresorbin. Das schmeckt wie dicker Kakao. Einen Liter soll er hinunterwürgen, damit er wieder ein wenig Gewicht zulegt. Gerd graut es vor der Pampe, er kann das Gebräu nicht mehr sehen.
Arztvisite.
»Na, wie geht’s, Herr Schönfelder? Sie machen Fortschritte, Respekt. So einen wie Sie haben wir noch nicht gehabt. Jetzt müssen Sie wieder zunehmen, dann geht es auch bergauf.«
Schönfelder schweigt grimmig.
»Stimmt etwas nicht? Können wir was tun?«
Schönfelder meint: »Naa, passt schon. Wird schon wieder.« Er mag es nun mal nicht, wenn andere Mitleid haben. Außerdem ist er keiner, der sich beschweren würde.
»Sagen S’ schon, was ist es?«
»Ah, des Fresorbin, Herr Doktor.«
»Was ist damit?«
Es bricht aus ihm heraus: »Des kannst doch net saufen. Ich hab eh schon keinen Hunger, aber des Zeug verdirbt einem ja den letzten Appetit. Ich mag das nicht mehr trinken – und wenn ich’s trink, dann mag ich schon gar nichts mehr essen.«
»Ja, das verstehe ich. Aber wir müssen schauen, dass Sie wieder zu Kräften kommen. Auf was hätten S’ denn Lust?«
Schönfelder sieht den Arzt an. Ja, der meint es ernst mit seiner Frage.
»Also, wenn Sie es wirklich wissen wollen – auf ein Bier hätt ich Lust.«
»Patschbumm! Habe ich zwei Flaschen Bier an meinem Bett stehen.
Auf ärztliche Anweisung.
Ich trinke das Bier, es ist ein fränkisches Helles – und es passiert etwas.
Ich kann es nicht beschreiben.
Die ganze Zeit liegst du da und siechst dahin. Du kriegst so ein pappiges Zeug, das dich am Leben hält.
Aber ein Leben ist das ja nicht.
Jetzt läuft mir das Bier die Gurgel runter. Der Alkohol beamt mich nieder, klar.
Ich schlafe ein, wache auf, weil die Blase drückt.
Der Pfleger, den ich rufe, besieht sich den Katheter und erklärt, alles ist okay. ›Nein, das kann nicht sein, sonst hätte ich nicht diesen Druck.‹ Er widerspricht noch einmal. Ich beharre, dass etwas nicht in Ordnung sein kann. ›Alles in bester Ordnung‹, sagt der Mann. Na gut, dann lasse ich’s halt laufen.
Er ärgert sich über die Sauerei. Das Bett muss sauber gemacht werden, ich muss neue Wäsche bekommen, man muss mich umbetten. Er ist sauer.
Ich auch.
Nichts ist mehr wie früher.
So hilflos bin ich.
So ein Bündel Mensch.
So eine Kacke.
Aber mein Bier kriege ich von nun an täglich. Und das mit dem Katheter bekomme ich auch unter Kontrolle. Das schwöre ich mir.«