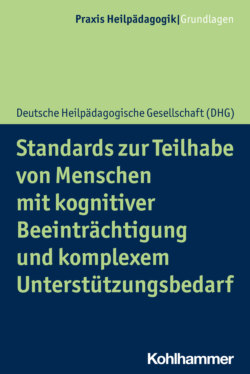Читать книгу Standards zur Teilhabe von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung und komplexem Unterstützungsbedarf - Deutsche Heilpädagogische Gesellschaft - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.4 Sozialraumorientierung
ОглавлениеDer Begriff Sozialraum hat eine mehrdimensionale Bedeutung. Als subjektive Kategorie bezieht er sich primär auf die individuellen Beziehungsnetzwerke, unabhängig vom jeweiligen Ort. Als geografischer Raum fokussiert er das nähere und weitere Wohnumfeld, den Stadtteil, das Dorf oder die Gemeinde. Als Verwaltungskategorie ist er für kommunale Planungen relevant.
Für die Zielsetzungen der UN-BRK sind die genannten Dimensionen gleichermaßen von Bedeutung. Die UN-BRK will einen »Beitrag zur Beseitigung der tiefgreifenden sozialen Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen leisten und ihre Teilhabe am bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben auf der Grundlage der Chancengleichheit fördern« (Präambel lit. y). Damit werden Wege eröffnet, die die »Gleichzeitigkeit von Drinnen und Draußen« überwinden könnten, die das Alltagserleben von Menschen mit Behinderungen prägt, in allen Lebensphasen und Lebensbereichen.27 Gleichzeitigkeit von Drinnen und Draußen bedeutet, »Teil einer Gesellschaft zu sein und dennoch die Erfahrung machen zu müssen, nicht dazuzugehören«28 – ein Sachverhalt, der nicht allein den gesellschaftlichen Verhältnissen geschuldet ist, sondern auch als ein Produkt des Systems Behindertenhilfe interpretiert werden kann, das – in guter Absicht – in allen Bereichen für Menschen mit Behinderungen spezielle Angebote entwickelt hat. Dieser Tatbestand kann nur durch die Entwicklung einer inklusiven (Bürger-)Gesellschaft aufgelöst werden, in der die Verantwortung für soziale Ausgrenzungsprozesse und ihre Bewältigung zurückgegeben wird an die gesellschaftlichen Institutionen und Akteure.29
In diesem Kontext spielt das Fachkonzept Sozialraumorientierung eine zentrale Rolle. Es hat seine Wurzeln in der Gemeinwesenarbeit der 1970/1980er Jahre, ist in der Jugendhilfe, in der sozialen Stadtentwicklung und in Quartierskonzepten der Altenhilfe fest etabliert und wird zunehmend auch in der Behindertenhilfe rezipiert. Sozialraumorientierte Arbeit will dazu beitragen, Lebensbedingungen so zu gestalten, »dass Menschen dort entsprechend ihren Bedürfnissen zufrieden(er) leben können«.30 Ausgehend vom Willen des Einzelnen, der Stärkung seiner Eigeninitiative und dem Einbezug seiner persönlichen und sozialen Ressourcen werden durch zielgruppen- und bereichsübergreifende Kooperation und Vernetzung mit lokalen Akteur*innen Ressourcen im Stadtviertel oder der Gemeinde erschlossen, die die Teilhabechancen stärken. Auf der Basis der genannten Prinzipien haben Früchtel & Budde die Handlungsfelder sozialraumorientierter Arbeit in einem mehrdimensionalen Modell beschrieben (SONI-Modell).31 Es konkretisiert sozialraumbezogene Handlungsfelder in der alltäglichen Lebenswelt (Bezug: Individuum und Gemeinwesen) und auf Systemebene (Bezug: Organisation und Kommunalpolitik).32
Die Inklusionsdebatte zwingt Träger von Einrichtungen und Diensten der Behindertenhilfe, sich mit sozialräumlichen Handlungsansätzen auseinanderzusetzen. Es sind Konzepte gefragt, die Inklusion als Kultur des Zusammenlebens im Stadtteil, im Dorf oder in der Gemeinde begreifen und die professionelle Unterstützung entsprechend profilieren. Es gilt, die bisherigen Handlungsfelder zu erweitern und sich Kompetenzen anzueignen, die Inklusionsprozesse fördern und Menschen mit Behinderungen bei der Wahrnehmung ihrer Bürgerrolle unterstützen. Das heißt konkret: Die auf das Individuum bezogene Ausrichtung der Hilfen ist durch eine sozialräumliche Perspektive zu ergänzen, die die Lebenswelt des Individuums und die Gestaltung des Gemeinwesens in den Blick nimmt:
»Die Feststellung und Reklamierung von individuellen Hilfen zur Integration und Partizipation (…), ihre Legitimationen und legislativen Absicherungen laufen ins Leere, wenn nicht gleichzeitig die Gestaltung der Infrastruktur der nahen sozialen Räume, in denen Partizipation und Integration alltagspraktisch verwirklicht werden müssen, in Angriff genommen wird. Personenbezogene Hilfen bedürfen der Stützung durch entsprechende sozialräumliche Strukturen: Lebenschancen konstituieren sich nur in einem ausgewogenen Verhältnis von individuellen Optionen und sozialen Einbindungen.«33
Quartiere sind Möglichkeitsräume für Teilhabe. Sie haben ein jeweils eigenes Gesicht. Bauliche Gegebenheiten, die Versorgungsstruktur und Infrastruktur, die Zusammensetzung der Bevölkerung, die ökonomische Situation, Engagementstrukturen und soziale Problemlagen kumulieren zu einem Geflecht von Bedingungsfaktoren, das Einfluss auf die Lebensgestaltung und Lebensqualität hat. Die Bedingungen vor Ort werden durch soziale und kulturelle Prozesse und durch politische Praxen entschieden und gestaltet und sind damit veränderbar.34 Bildung, Beratung und Begleitung von Menschen mit Behinderungen sollten von daher »auf die Befähigung zur wirksamen Partizipation im Sinne der Einflussnahme und Gestaltung sozialräumlicher Bedingungen am selbstgewählten Wohn- und Lebensort gerichtet sein«.35
Im Zeichen von Inklusion und Partizipation ist für Menschen mit komplexem Unterstützungsbedarf das Erleben von Anerkennung und unbedingter Zugehörigkeit von zentraler Bedeutung. Unterstützer*innen sind aufgefordert, Brücken in die Gemeinde zu bauen, damit das Zusammenleben gelingt. Brücken entstehen zum Beispiel, wenn Menschen mit komplexem Unterstützungsbedarf in sozialen Rollen wahrgenommen werden, die die Gemeinsamkeit von Menschen mit und ohne Behinderung dokumentieren (z. B. als Kund*in oder Nachbar*in), und weniger in Rollen, die die Unterschiede bewusst machen (z. B. als Heimbewohner*innen, meist in Gruppen auftretend). Beispielhaft sei die Nutzung allgemeiner sozialer, kultureller und sportlicher Angebote und allgemein zugänglicher Lokalitäten sowie Kontakte zu Kirchengemeinden, Vereinen oder Nachbarschaftstreffs genannt. Auf diese Weise kann das soziale Umfeld für eine veränderte Wahrnehmung von Menschen mit Behinderung sensibilisiert und die Bereitschaft zu persönlichen Kontakten und Interaktionen mit dem Personenkreis geweckt werden. Zur Realität gehört aber auch, dass Menschen mit herausfordernden Verhaltensweisen von der Umwelt als Belastung oder störend erlebt werden und dass es im Zusammenleben im Quartier Konflikte gibt, deren Bewältigung große Anforderungen an die professionellen Unterstützer*innen stellt.
Neben neuen Ansätzen auf der Handlungsebene sind Unterstützungsstrukturen zu entwickeln, die die Teilhabe von Menschen mit schweren Beeinträchtigungen fördern: Inklusion als Gestaltungsprinzip, in allen Lebensbereichen und Lebensphasen. Viele Träger von Einrichtungen und Diensten der Behindertenhilfe haben sich bereits »auf den Weg in die Gemeinde« begeben – durch Aktualisierung ihrer Konzeptionen, durch Veränderungen ihrer Strukturen, durch inklusive Praxisprojekte, durch Öffentlichkeitsarbeit. Teilweise werden in bewusster Abgrenzung zu tradierten Angeboten Teilhabe fördernde Wohnkonzepte realisiert, die auch Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf einbeziehen. Allen gemeinsam ist das Bemühen, die Unterstützungsleistungen personenzentriert zu gestalten und zugleich den Sozialraum in den Blick zu nehmen. Unter den gegebenen leistungsrechtlichen Regelungen und administrativen Vorgaben stößt die Realisierung neuer Konzepte jedoch oft auf Hindernisse.
Im BTHG werden personenzentrierte Leistungen ausdrücklich mit dem Sozialraum verknüpft: Die Leistungsberechtigten sind zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder dabei zu unterstützen (§ 76 SGB IX).36 Für fallunspezifische sozialraumbezogene Arbeit, die den Prozess der Inklusion im Sinne einer »enabling community« maßgeblich unterstützen kann, gibt es im System der Behindertenhilfe bislang keine leistungsrechtliche Grundlage.