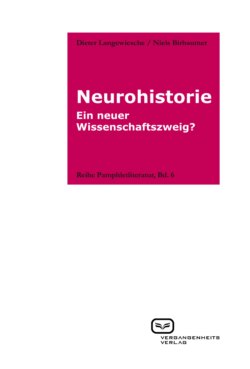Читать книгу Neurohistorie - Dieter Langewiesche - Страница 7
Wovon diese Studie nicht handelt
ОглавлениеEs geht nicht um das, was in der Debatte zwischen Geistes- und Neurowissenschaftlern im Zentrum steht: das Problem der Willensfreiheit. Der Grund dafür ist einfach. Historiker begegnen in ihren Quellen stets gesellschaftlich konditionierten Menschen. Konditioniert sind sie jederzeit in unterschiedlichsten Zusammenhängen: religiösen bzw. weltanschaulichen, politischen und sozialstrukturellen; nach Geschlecht; konditioniert wird auch durch die Art des Berufes und die Berufsposition, durch den Bildungsgrad und den kulturellen Raum, in dem jemand lebt, durch die Werteordnung, die in der Gesellschaft oder in gesellschaftlichen Gruppen vorherrscht, durch die Art der Staatsorganisation, und vieles mehr. All dies war und ist unterschiedlich bedeutsam in den verschiedenen Handlungsfeldern, und alle diese Konditionierungsagenturen wandeln sich im Laufe der Geschichte – in sich und in ihrem Verhältnis zur Gesellschaft. Ihre Bedeutung für die Menschen, ihre Prägekraft ändert sich manchmal still, manchmal eruptiv bis hin zu gewaltsamen Revolutionen. Stets geht es in solchen Veränderungen um die Institutionalisierung von Wertvorstellungen. Darauf zielen alle, die in der Gesellschaft etwas bewirken und diese Wirkung auf Dauer stellen wollen. Institutionalisierung meint Verstetigung von Handlungsmaximen.23
Wer das menschliche Handeln in konkreten gesellschaftlichen Situationen untersucht, betrachtet den Menschen immer unter Bedingungen, die dieser zwar gestalten kann und will, aber doch begrenzt von einer Fülle struktureller Konditionierungen, die der Einzelne zu beachten hat, wenn er als soziales Wesen handeln will. Diese Bedingungen in ihrem historischen Wandel zu analysieren und aus ihnen die Handlungen und die Handlungsmöglichkeiten der Menschen in ihrer jeweiligen Zeit zu erkennen, ist das Geschäft der historischen Fächer. Es geht stets um das Verhalten von Menschen in einem gesellschaftlichen Raum, der in vielfältiger Weise den Menschen konditioniert. Anders formuliert: es geht um die Zurechenbarkeit von menschlichem Handeln und den Entwicklungen, die aus ihm folgen, auf jene Strukturen, die als handlungsbestimmend angesehen werden.
Neurowissenschaftliche Konditionierungen von menschlichem Verhalten in geistes- und sozialwissenschaftlichen Analysen einzubeziehen, ist eine Herausforderung, der sich diese Fächer nicht entziehen sollten. Dabei dürfte es angebracht sein, von der Hypothese auszugehen, dass in Forschungen, die nach menschlichem Verhalten in komplexen gesellschaftlichen Situationen fragen, neurowissenschaftliche Prägungen in das weite Feld der Konditionierungen menschlichen Verhaltens einzuordnen sind, ihre Erklärungskraft also situativ bestimmt werden muss, nicht aber, dass neurowissenschaftliche Prägungen allen gesellschaftlichen übergeordnet sind. Zu bedenken ist auch, dass die Neurowissenschaft und generell die biologischen Fächer sich außerordentlich dynamisch entwickeln. Es ist deshalb für Außenstehende nicht einfach zu erkennen, wo sie andocken könnten und wo sich die Naturwissenschaftler selber nicht sicher sind. Die Probleme, die damit verbunden sind, wurden kürzlich in einem interdisziplinären Gespräch erörtert, das die Zeitschrift American Historical Review initiiert und dokumentiert hat.24