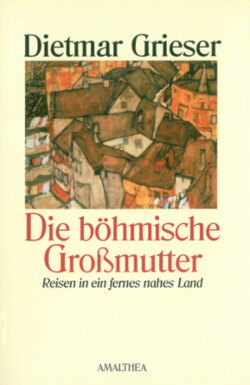Читать книгу Die böhmische Großmutter - Dietmar Grieser - Страница 11
»Wie glänzt mir deine Pracht!«
ОглавлениеSchon die Wagenfahrt durch das naive Land war so schön …« Auch heute noch stimmt Rilkes schwärmerische Beschreibung seiner Annäherung an Schloß Janowitz. Einunddreißig ist der Dichter, als er im Herbst 1907 den Besuch der Prager Cézanne-Ausstellung mit einem Abstecher auf den Landsitz seiner Seelenfreundin Sidonie Nádherny von Borutín verbindet. Hier die sanften Hügel, die ihn an »leichte Musik« erinnern, dort die flachen Äcker und Apfelbaumreihen »wie ein Volkslied ohne Refrain«.
Bis zu der Kreisstadt Benešov geht es, von Prag kommend, auf fast gerader Strecke Richtung Süden; erst dort setzt die Suche nach jenen leicht in die Irre führenden, wenig befahrenen Nebenstraßen ein, die uns ans Ziel bringen sollen: Vrchotovy Janovice lautet die heutige Ortsbezeichnung.
Nirgends würde man altösterreichische Nostalgie weniger vermuten als auf dem Bahnhof dieses von häßlichen Industriebauten geprägten Städtchens. Eine Gedenktafel, goldene Schrift auf schwarzem Grund, klärt den Reisenden darüber auf, daß in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg in dem kleinen Raum, der heute die Kanzlei des Bahnhofsvorstandes bildet, hohe und höchste Herrschaften auf ihren Zug gewartet haben: Kaiser Franz Joseph, der auf der Fahrt nach Prag einen Zwischenstop eingelegt, Thronfolger Franz Ferdinand, der im nahen Schloß Konopište residiert und Kaiser Wilhelm II., den die Jagdlust zu exklusiven Vergnügungen in die böhmischen Wälder gelockt hat. Der computerbestückte Schreibtisch des Bahnhofsvorstehers bildet einen reizvollen Kontrast zu den alten, hinter Glas gerahmten Photographien, die nach wie vor an den Wänden hängen: Momentaufnahmen von den Aufenthalten der Potentaten in dem mit sparsamer Eleganz ausstaffierten Salon. Der zur Abfahrt bereitstehende Schülerzug ist abgefertigt, der freundliche Beamte der Tschechischen Staatsbahnen kann sich uns zuwenden und die Ereignisse von damals, die er nur vom Hörensagen kennen kann, in einem kuriosen Gemisch aus Tschechisch und Deutsch zu schildern versuchen. Auch den weiteren Weg nach Vrchotovy Janovice beschreibt er bis ins Detail: Erst, als er ganz sicher ist, wir würden all die Abzweigungen, Kurven, Brücken, Waldstücke und Tankstellen nicht durcheinanderbringen, entläßt er uns mit einem herzlichen »Grüß Gott«.
Auch das Schloß, das unser Reiseziel bildet, bietet sich dem Auge des Besuchers so dar, wie es vor hundert Jahren Rainer Maria Rilke beschrieben hat: »durch einen alten Wassergraben abgetrennt, mit Fenstern und Wappenschildern gleichmäßig bedeckt, mit Altanen, Erkern und um Höfe herumgestellt, als sollte niemals jemand sie zu sehen bekommen«.
Wir aber bekommen sie zu sehen; Student Václav, der hier während der warmen Jahreszeit an den Wochenenden die Führungen übernimmt und für uns, die wir an einem normalen Werktag angereist sind, eine Sonderschicht einlegt, steht an der Schloßpforte bereit, um – eine Kollektion historischer Photos, einen Lageplan, ein tschechisch-deutsches Wörterbuch sowie einen eigens angefertigten Spickzettel in der Hand – für alle zu erwartenden Fragen gerüstet zu sein. Für die Eintragung ins Gästebuch bittet er, Federkiel und Tintenfaß zu benützen; die Filzpantoffeln, die in größerer Zahl bereitstehen, sind für Schülergruppen bestimmt, die es mit dem Respekt vor dem alten Gemäuer und den kostbaren Fußböden weniger genau nehmen. Václav ist auf die unterschiedlichen Interessen der Schloßbesucher eingestellt: Die deutschen Gäste, so berichtet er, würden sich nach Rilke erkundigen, die österreichischen eher nach Karl Kraus. Wir bekommen also den noch nicht restaurierten Karl-Kraus-Trakt im ersten Stock zu sehen: Studierstube, Schlafzimmer und Bad. Und im Obergeschoß Hausherrin Sidonies Reich mit der schönen alten Bibliothek im Mittelpunkt, zu deren Schätzen eine komplette Kollektion der »Fackel«-Bände zählt. Auch hier Familienbilder von einst an den Wänden, dazu das große Ölporträt von Sidonie, das 1934 jener Max Švabinsky gemalt hat, den Sidonie Nádherny zwar weniger umsorgt hat als die beiden ihr devot ergebenen Dichter, den sie dafür aber jederzeit bereit gewesen wäre zu heiraten.
Wir begeben uns ins Freie: Václav geleitet uns durch den wunderschönen 15 Hektar großen Park, den Karl Kraus in so vielen seiner Gedichte besungen hat, er zeigt uns dessen Lieblingswiese, den Teich mit den schreienden Schwänen, den steinernen Tisch, an dem der Gast bei Schönwetter geschrieben hat, den weitab an einer der Schloßmauern angelegten Erbfriedhof, auf dem nicht nur die Familienmitglieder, sondern auch die Haushunde bestattet worden sind.
Im schlicht improvisierten Souvenirshop sind Postkarten erhältlich, auf denen die morbide Romantik der zum Renaissanceschloß umgebauten Wasserfeste eingefangen ist (die später durch Barockisierung und neugotische Umbauten abermals ihr Gesicht verändert hat). Auch ein Foto der von Rilkes Gattin Clara Rilke-Westhoff modellierten Marmorbüste Sidonie Nádhernys liegt auf, ein Schnappschuß des viersitzigen Cabriolets, mit dem sie und Karl Kraus ihre Autoausflüge unternommen haben, sowie – aus neuester Zeit – eine Serie kindlichnaiver Schloßzeichnungen, die aus einem Schülerwettbewerb hervorgegangen sind.
Auch auf alle Karl Kraus betreffenden Fragen erhält der Besucher Auskunft. Der große Spötter, der durch seine Aufenthalte in Janowitz und seine leidenschaftliche Liebe zu Sidonie Nádher-ny zum Dichter mutiert, ist mit diesem Land ja schon lange vor der schicksalhaften Begegnung mit der elf Jahre jüngeren Aristokratin aufs innigste verbunden: Böhmen ist seine Geburtsheimat. In der nordböhmischen Kleinstadt Gitschin, Wallensteins Lieblingsresidenz, in der der berühmte Feldherr nach seiner Ermordung auch bestattet worden ist, betreibt Vater Jakob Kraus eine Papierhandlung, ehe er es mit einer ebenso einfachen wie genialen Idee zu immensem Wohlstand bringt: Er verlegt sich auf die Herstellung geklebter Papiersäcke, die bald in allen Teilen der Habsburger-Monarchie, ja in ganz Mitteleuropa massenhaft Abnehmer finden.
Am 28. April 1874 kommt – als neuntes Kind – Karl zur Welt; in Gitschin verbringt er seine ersten Lebensjahre. Als er drei Jahre alt ist, übersiedelt die Familie nach Wien. Hier besucht er Volksschule und Gymnasium, hier unternimmt er seine ersten Schritte als Schauspieler, als Vorleser, als Zeitungsmitarbeiter. Noch während des Universitätsstudiums (das er vor der Zeit abbricht) reift in dem Vierundzwanzigjährigen der Plan zur Herausgabe der satirischen Zeitschrift »Die Fackel«, 1902 erscheint sein berühmter Essay »Sittlichkeit und Kriminalität«, es folgen Aphorismensammlungen, weitere Essaybände, schließlich die öffentlichen Vorlesungen, in denen er auch sein mimisch-deklamatorisches Talent voll entfalten kann. Die Frau an seiner Seite ist eine junge Wienerin, die er 1904 während eines Urlaubs in Ischl kennengelernt hat: Helene Kann. Was ihn an der ebenso schönen wie geistreichen Person besonders entzückt, sind ihr Einfallsreichtum, ihr Witz. Ihr widmet er sein 1909 erscheinendes zweites Buch: »Sprüche und Widersprüche«.
Es kommt das Jahr 1913. Das Lieblingslokal des Neununddreißigjährigen ist zu dieser Zeit das Café des Wiener Ringstraßenhotels Imperial. Hier stellt ihn am 8. September einer seiner Bekannten, der Sportarzt Max Graf Thun Hohenstein, einer weitläufigen Verwandten vor, die zu Besuch in Wien weilt: der elf Jahre jüngeren Baronesse Sidonie Nádherny von Borutín.
Die streng-schöne Aristokratin mit dem hellwachen Geist und dem seherischen Blick und der alternde, neuerdings auch von mancherlei beruflichen Rückschlägen irritierte Schriftsteller kommen sogleich miteinander ins Gespräch, spüren, daß sie einander eine Menge zu sagen haben, setzen die begonnene Konversation noch am selben Abend bei einem gemeinsamen Diner fort. Sidonie ist seit dem Selbstmord ihres Lieblingsbruders seelisch angeschlagen: Der einige Jahre ältere Johannes Nádherny hat sich vor drei Monaten während eines Spitalsaufenthalts in München das Leben genommen, weil er sich für unheilbar krank hielt. Die Eltern, 1898 in den Freiherrenstand erhoben, sind schon seit längerem tot, Sidonie muß also nun die Agenden des Bruders übernehmen, der nicht nur Schloß Janowitz, die jüngst noch um drei Meierhöfe erweiterten Besitzungen der Familie, verwaltet hat, sondern, ein durch und durch kunstsinniger Mann, der Schwester auch in punkto Musik, Theater und Kunst ein inspirierender Mentor gewesen ist. Sidonies Zwillingsbruder Karl hingegen, ausgebildeter Jurist, entledigt sich der mit der Erbschaft verbundenen Aufgaben durch Pachtverträge; damit ihm die Schwester nur ja nicht auf der Tasche liegt, drängt er darauf, daß sie eine standesgemäße Ehe eingeht, die ihre Versorgung sichert.
Sidonie ist selig, in Karl Kraus einem Menschen zu begegnen, dem sie alle ihre Sorgen anvertrauen kann. Man verabredet sich auch für den folgenden Tag, unternimmt eine Fiakerfahrt durch den Prater und einen Ausflug in den Wienerwald, läßt sich von Kraus’ Freund Adolf Loos zu einem gemeinsamen Gabelfrühstück und von der Pädagogin Eugenie Schwarzwald zum Souper einladen. Als man auseinandergeht und Sidonie zur Heimreise aufbricht, lädt die elf Jahre Jüngere ihre neue Bekanntschaft zu einem baldigen Besuch auf Schloß Janowitz ein.
Ende November trifft Karl Kraus auf dem prachtvollen Besitz 50 Kilometer südlich von Prag ein. Hat er Sidonie schon in den zwischenzeitlich abgesandten Briefen offen zu erkennen gegeben, wie sehr er sich zu ihr hingezogen fühlt, so sind es nun auch das Schloß mit dem romantischen Park, dem stillen Teich und der Sidonies Einsamkeit teilenden Menagerie aus Pferden, Hunden, Schwänen und Nachtigallen, die auf den notorischen Stadtmenschen stärkste Faszination ausüben.
So oft es ihm der Terminkalender erlaubt, wiederholt Karl Kraus seine Besuche in Janowitz; zwischendurch werden Briefe, Postkarten und Telegramme gewechselt. Tritt dabei eine zu lange Pause ein, leidet er Todesangst um die verehrte Freundin: »Ich habe den gestrigen Tag mit Warten verbracht. Lauern, ob ein Telegramm in den Kasten fällt. Über zwanzigmal lief ich ins Vorzimmer, wenn ich die Klappe fallen zu hören glaubte.«
Mit zunehmender Häufigkeit gehen nun auch Verse, die die sich anbahnende Liaison zum Gegenstand haben, auf dem Postweg nach Böhmen. Sie haben Titel wie »Verwandlung« oder »Sendung«, »Zuflucht« oder auch »Mit dir vor einem Springbrunnen«. Oder – einfacher, direkter: »Sidi!« Der große Spötter Karl Kraus schlägt auf einmal völlig ungewohnte Töne an, wird zum schwärmerischen Hymniker, zum Poeten:
Nun bin ich ganz im Licht,
das milde überglänzt mein armes Haupt.
Ich habe lange nicht an Gott geglaubt.
Nun weiß ich um sein letztes Angesicht.
Wie es den Zweifel bannt!
Wie wirst du Holde klar mir ohne Rest.
Wie halt’ ich dich in deinem Himmel fest!
Wie hat die Erde deinen Wert verkannt.
Wie glänzt mir deine Pracht!
Dein Menschliches umarmt, der beten will.
Er heiligt es im Kuß. Wie ist sie still
von Sternen, deiner Nächte tiefste Nacht.
Zum Namenstag schickt er der Angebeteten einen Vers, dessen Zeilenanfänge »Sidonie« ergeben; ein andermal ist es gar ein vierundzwanzigstrophiges Gebilde, dessen Vierzeiler allesamt mit den geliebten Buchstaben S, I, D und I beginnen. Am Ende werden es an die 60 solcher Wortkunstwerke sein, mit denen Karl Kraus dem »himmlisch Wesen«, der »Unendlichen« und »Gnadenvollen« huldigt. Von den neun Bänden »Worte in Versen«, die nun nach und nach erscheinen, werden am Ende nicht weniger als sechs ihr gewidmet sein.
Unkompliziert darf man sich die Beziehung der beiden extrem empfindsamen Naturen freilich nicht vorstellen. Sidonie fühlt sich von all dem Überschwang der Gefühle bisweilen fast erdrückt; auch sind die äußeren Umstände ihres Beisammenseins auf Schloß Janowitz alles andere als ideal: Die Beziehung muß vor Sidonies Bruder Karl, der sich eine Art Vormundschaft anmaßt, verheimlicht werden. Erst wenn alle inklusive der Dienerschaft in tiefem Schlaf liegen, kann Karl Kraus ins Zimmer seiner »Braut vor Gott« schleichen, und auch, um engumschlungen durch den Park schlendern zu können, heißt es, das Dunkel der Nacht abwarten. Entschließt sich die »Heilige« und »Herrliche« zu einem Gegenbesuch in Wien, muß sie sich, um dem mißtrauischen Zwillingsbruder keinen Anlaß zum Einschreiten zu geben, plausible Gründe einfallen lassen. Keinesfalls darf sie zugeben, daß Karl Kraus sie zu seiner nächsten Vorlesung eingeladen hat.
Auch, wenn sie einmal nicht kommt, bleibt der Stammplatz in der zweiten Reihe für sie reserviert; in diesem Fall erstattet ihr der Enttäuschte brieflich Bericht über den Verlauf des Abends.
1915 nimmt Karl Kraus den Kampf gegen den mittlerweile tobenden Krieg auf: Noch während einer gemeinsamen Autoreise durch die Schweiz schreibt er die ersten Dialoge seines Dramas »Die letzten Tage der Menschheit« nieder. Auch im privaten Bereich herrscht Alarmstufe 1: Hier ist es der eifersüchtige »Konkurrent« Rainer Maria Rilke, der ihn herausfordert. Der ein Jahr Jüngere, obwohl selber kein Heiratskandidat, versucht Sidonie jede zu starke Bindung an Karl Kraus auszureden und schreckt dabei nicht einmal vor versteckten antisemitischen Anspielungen zurück, indem er sie vor jenem »letzten untilgbaren Unterschied« warnt, der ihrer beider Lebenswelten voneinander trennt.
Daß sich Sidonie Nádherny von Borutín im Sommer 1918 tatsächlich von Karl Kraus zurückzieht und im Jahr darauf den Sportarzt Graf Max von Thun Hohenstein heiratet, hat allerdings andere Gründe: Kraus’ gar zu heftiges Werben, das in der Bereitschaft gipfelt, der Angebeteten alles zu verzeihen, auch jegliche Kränkung von ihr hinzunehmen, ja nichts weiter als ihr »Hündchen« zu sein, stößt die stolze Frau ab, und so geht sie eine Ehe ein, von der sie sich zwar nichts erwartet, die sie aber immerhin von einem immer unerträglicher werdenden Druck befreit. Tatsächlich ist die Verbindung mit Graf Thun nicht von Dauer: Sidonie verläßt ihren Mann, nimmt wieder ihren Mädchennamen an und kehrt auf Schloß Janowitz zurück.
Im Sommer 1921 lebt die alte Freundschaft mit Karl Kraus wieder auf; allerdings sind es nun eher zufällige Begegnungen, die die beiden zusammenführen, und auch eine Reihe hochfliegender Reisepläne – unter anderem mit dem Ziel China! – bleiben unausgeführt. Zwar schreibt ihr Karl Kraus noch im Dezember 1921 »Es ist unmöglich, daß ich Dich aufgebe«, aber der vertraute Ton von einst ist wohl für alle Zeiten dahin. Undenkbar, daß er der Geliebten – wie noch im Kriegsjahr 1916 – von den »täglich sich mehrenden Reibungen mit dem äußeren Leben« schriebe und sie gar um die im darbenden Wien fehlenden Nahrungsmittel anbettelte:
»Seit Wochen keine Kartoffeln, an manchen Tagen auch kein Brot. Könnte man mir da nicht helfen? Wenn daran Überfluß ist, natürlich. Sonst nicht!«
Einen Herzenswunsch hält Karl Kraus allerdings weiterhin aufrecht: Er möchte, wenn eines Tages seine Zeit abgelaufen ist, in Janowitz beerdigt werden. Von einer gemeinsamen Reise durch die Schweiz hat man vor Jahren einen Bibelspruch mitgebracht: Karl Kraus entdeckte ihn in einer Gebirgskapelle, schrieb ihn ab und trug ihn ins Janowitzer Gästebuch ein. Er lautet: »Ich habe diesen Ort erwählet, daß mein Herz allzeit daselbst bleiben solle.«
Sidonie hat genau im Kopf, wie das Grab des Geliebten beschaffen sein soll: eine schlichte Steinplatte mit nichts als Namen und Jahreszahlen, mit wilden Wiesenblumen als einzigem Schmuck. Doch Bruder Karl verweigert seine Zustimmung; außerdem hat sich die Stadt Wien gemeldet und spendiert ein Ehrengrab auf dem Zentralfriedhof.
Noch wenige Wochen vor seinem überraschend eintretenden Tod – Karl Kraus trug sich eben noch mit dem Gedanken, vor der nationalsozialistischen Gefahr in die Tschechoslowakei auszuweichen – treffen Sidonie und er einander zum letzten Mal: Vom 30. April bis zum 4. Mai 1936 hält sich der soeben 62 Jahre alt Gewordene in Janowitz auf. Sidonie wird darüber später in ihrem Tagebuch festhalten:
»Stunden innigster Freundschaft und reinsten Glücks, nur getrübt durch seine gesteigerte Atemnot. Wir nahmen Abschied auf der Station in Benešov, wohin ich ihn um 1 Uhr zum Prager Schnellzug gebracht hatte. Seine Stimme hörte ich zum letzten Mal in einem telephonischen Anruf von Wien am Pfingstsonntag. In derselben Woche fing die Todeskrankheit an; am Mittwoch legte er sich nieder, um nie wieder aufzustehen. Am Sonntag ließ er mir sagen, ich solle kommen, bis ihm besser sei, um ihn abzuholen. Bis zum letzten Augenblick seines klaren Denkens war es sein einziger Wunsch, nach Janowitz zu fahren. Von Dienstag an war er nicht mehr bei sich, denn starke Morphiuminjektionen mußten seine Schmerzen bannen. Am Donnerstag – es war Fronleichnam – fiel er in Bewußtlosigkeit, und Freitag früh um 4 Uhr hörte das edelste Herz zu schlagen auf. «
Sidonie Nádherny trifft am Vortag in Wien ein, sieht den Sterbenden jedoch nicht mehr. Beim Begräbnis am 12. Juni wirft sie einen Ring ins offene Grab, tags darauf kehrt sie nochmals wieder und zündet ein Licht an.
Zurück auf Schloß Janowitz, wird ihr der so sehr geliebte Besitz im heimatlichen Böhmen nunmehr zur »Wüste«: »Mein Leben vollzieht sich in fast klösterlicher Abgeschiedenheit innerhalb der Parkmauer, deren Tore kaum mehr geöffnet werden, denn draußen habe ich nichts zu suchen.«
Mit der bedrückenden Stille, die über dem Ort liegt, ist es erst sechs Jahre später vorbei, nur ist das, was sich nun rund um Sidonie ereignet, noch um vieles schlimmer: Die SS fällt ein und verwandelt das Schloß in eine Kaserne samt Panzerreparaturwerkstatt für den nahe Benešov errichteten Truppenübungsplatz der Deutschen Wehrmacht. Dem Wahnsinn nahe, irrt die Achtundfünfzigjährige durch die wenigen ihr verbliebenen Räume; am 27. Dezember 1943 trägt sie in ihr Tagebuch ein: »Es wäre besser, zu sterben.« Nicht nur, daß es weder Strom noch Telephon noch Radio gibt, wird nun auch noch die Zufahrtstraße für jeglichen Zivilverkehr gesperrt: Sidonie von Nádherny ist total von der Außenwelt abgeschnitten.
Nach dem Einmarsch der Russen im Mai 1945 erhält sie zwar ihren Besitz zurück, doch in welchem Zustand! »Mein Herz blutet, wenn ich durch den verwilderten Park gehe. Alles preisgegeben, was sonst wie ein Heiligtum war.«
Wenigstens ist ihre Bibliothek gerettet: Alles – inklusive der »Fackel«-Bände – wartet, in Kisten verpackt, darauf, wiederaufgestellt zu werden. Im Augenblick sind allerdings andere Arbeiten vordringlicher: Um sich zu ernähren, pflanzt Sidonie im Schloßgarten Gemüse; einen eigenen Gärtner gibt es schon lange nicht mehr. Eine alte Gießkanne muß herhalten: »Gartenspritze und Wasserleitung wurden von den Deutschen zerstört.«
Das endgültige Aus kommt mit der Machtübernahme durch die tschechischen Kommunisten: Bei Nacht und Nebel und nur mit leichtem Gepäck (darunter das Widmungsexemplar der »Ausgewählten Gedichte« von Karl Kraus) verläßt Sidonie Nádherny am 11. September 1949 Janowitz (das nunmehr Janovice heißt), schlägt sich zu Fuß zur nächsten Bahnstation durch, flieht über die grüne Grenze nach Deutschland und reist nach England weiter. Freunde in London nehmen sich ihrer an, auch bei Bekannten in Südirland findet sie vorübergehend Unterschlupf. Ein inzwischen ausgebrochenes Krebsleiden veranlaßt sie, nach London zurückzukehren, und dort, im Harefield Hospital in der Grafschaft Middlesex, stirbt die Vierundsechzigjährige am 30. September 1950 und wird auf dem Dorffriedhof von Denham beerdigt. Fast ein halbes Jahrhundert verstreicht, bis die sterblichen Überreste – im Mai 1999 – nach Böhmen überführt und endgültig im Park von Schloß Janovice beigesetzt werden. In jenem Boden, von dem Karl Kraus in seinem Gedicht »Wiese im Park« gesagt hat: »Und dieses war mein Land.«