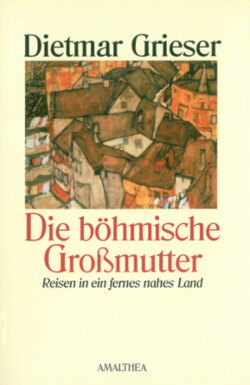Читать книгу Die böhmische Großmutter - Dietmar Grieser - Страница 9
Stifter allerwege
ОглавлениеIm Sommer 1857 hat der knapp zweiundfünfzigjährige Adalbert Stifter ein Erlebnis, das ihn zutiefst aufwühlt: Er sieht zum ersten Mal das Meer. Begleitet von Frau und Ziehtochter, hat er eine Reise in den Süden angetreten – zuerst zu den Verwandten in Klagenfurt, dann weiter nach Triest. Der Anblick des fremden Elements löst in dem vielfach unglücklichen Mann, der sein Leben zu fünf Sechsteln hinter sich hat, gewaltige Erschütterungen aus:
»Ich wußte nicht, wie mir geschah. Ich hatte eine so tiefe Empfindung, wie ich sie nie in meinem Leben gegenüber von Naturdingen gehabt hatte. Jetzt, da ich es gesehen, glaube ich, ich könnte gar nicht mehr leben, wenn ich es nicht gesehen hätte. «
Heute hätte er es vor der Haustür. Zwar nicht das Meer, doch immerhin ein Gewässer von 44 Kilometer Länge und bis zu 12 Kilometer Breite: Es ist der 1959 fertiggestellte Moldau-Stausee, der das Land östlich des Böhmerwaldes mit Strom versorgt. Und mit Touristen.
Der Literaturfreund, Stifters Doktrin vom »sanften Gesetz« im Sinn, braucht sich dennoch nicht zu schrecken: Nur Paddelboote und Ausflugsschiffe sind zugelassen, lautlose Autofähren ersetzen lärmreiche Brücken, und an den Ufern gehen Angler ihrem stillen Tagwerk nach oder ziehen Radfahrer vorüber. Sogar die örtlichen Fremdenverkehrsstrategen, obwohl festen Willens, die nur zweimonatige Sommersaison in Hinkunft zu verlängern, scheinen von »ihrem« Dichter gelernt zu haben und propagieren einen »sanften Tourismus«.
Sobald man die österreichisch-tschechische Grenze bei Wullowitz und die ersten paar Straßenkilometer mit den offenbar unvermeidlichen Animierlokalen à la »Paradiso« und »Kamasutra« hinter sich hat, regieren nur noch Wasser und Wald: Baumriesen lassen ihre Fichten- und Lärchenzweige hoch über den Asphalt hängen, fliegende Händler bieten frisch gebrockte Heidelbeeren an, postmoderne Ferienbungalows wetteifern mit den schäbigen Datschas aus der kommunistischen Zeit. Dazwischen Wegkreuze, hinterm Ufergebüsch versteckte Campingplätze, einfache Proviantbuden – es könnte alles viel schlimmer sein. Den Besuch bei meiner tschechischen Übersetzerin hebe ich mir für den Rückreisetag auf; Jana Dušková lebt mit ihrer Familie in Loučovice, der letzten Ortschaft vor der Talsperre. Unbedingt noch vor Einbruch der Dunkelheit will ich Oberplan erreichen, mein vorrangiges Ziel. Hier ist am 23. Oktober 1805 der Leinenwebersohn Adalbert Stifter zur Welt gekommen, hier hat er seine Kindheit verbracht, und hierher ist er auch als erwachsener Mann wieder und wieder zurückgekehrt.
Schon meine ersten Kontakte mit den Einheimischen belehren mich, ich könne getrost »Oberplan« sagen: Horní Planá, wie der Name der 2000-Seelen-Gemeinde heute offiziell lautet, lebt von den deutschsprachigen Touristen, und die Leute aus dem Ort, die nach 1945 die vormals zu 95 Prozent deutschen Siedler verdrängt haben, haben sich klugerweise darauf eingestellt.
Auch mit ihrem »Lokalmatador« wissen sie umzugehen: Gleich am Ortseingang erblicke ich eine Tafel mit stilisiertem Stifter-Porträt, »Rostbraten Adalbert« lese ich auf der Speisekarte der Gastwirtschaft, die dem Stifter-Geburtshaus gegenüberliegt, und dortselbst wartet auf den Besucher eine vorzügliche Dokumentation zu Leben und Werk des Verehrten.
Nach dem Brand von 1934 originalgetreu wiedererrichtet, birgt der behäbige zweigeschossige Bau Memorabilien wie Stifters Reisezylinder und Reisepaß, eine Staffelei erinnert an seinen Zweitberuf als Maler, und das lateinische Lehrbuch in einer der Vitrinen lenkt den Blick auf den verehrten Landschulmeister Josef Jenne, der seinem Lieblingsschüler »Bertl« nicht nur Lesen und Schreiben, Zeichnen und Singen beigebracht, sondern dem vielfach Begabten, nach elterlichem Wunsch für einen geistlichen Beruf Bestimmten den Weg zur höheren Schule gewiesen hat.
Bei der Wiedereröffnung des Stifter-Hauses hat man übrigens auch an den berühmten Feldstein gedacht, der sich neben dem Eingang befand; hier hat der Bub, allein oder an der Seite des Großvaters, seine ersten Eindrücke von der ihn umgebenden Welt eingefangen:
»Ich saß gerne im ersten Frühlinge dort, wenn die milder werdenden Sonnenstrahlen die erste Wärme an der Wand des Hauses erzeugten. Ich sah auf die geackerten, aber noch nicht bebauten Felder hinaus, ich sah einen Geier darüberfliegen, oder ich sah auf den fernen blaulichen Wald, der so hoch ist, daß ich meinte, wenn man auf den höchsten Baum hinaufstiege, müßte man den Himmel angreifen können.«
In der Schausammlung des Stifter-Hauses fehlt es auch nicht an Zeichen der Endlichkeit: Der Sargschlüssel erinnert daran, daß dem Dichter nur eine Lebenszeit von 62 Jahren vergönnt gewesen ist, und die Fotos von den durch den Moldau-Stausee ausgelöschten Dörfern erklären, wieso manche der dem Stifter-Leser vertrauten Ortsnamen heute von der Landkarte verschwunden sind.
Im Obergeschoß des Stifter-Hauses erwartet den Besucher eine eigene Überraschung: Die stimmungsvollen Böhmerwald-Fotos, die hier zu einer separaten Ausstellung vereinigt sind, stammen von Adalbert Stifters Hand – es ist ein 1950 geborener Nachkomme, dessen Eltern der Versuchung nachgegeben haben, ihren Sohn auf den berühmten Vornamen zu taufen. Der heute Fünfundfünfzigjährige übt einen Doppelberuf aus, ist in der Verwaltung der Erzdiözese Salzburg tätig und zugleich als Theaterfotograf bei den Salzburger Festspielen akkreditiert.
An einer der Außenmauern der Pfarrkirche von Oberplan die Grabplatte von Stifters Mutter Magdalena – die des Vaters wäre auf dem Friedhof der oberösterreichischen Gemeinde Gunskirchen zu suchen, wo Johann Stifter, als sein Erstgeborener zwölf Jahre alt war, unter einem umgestürzten Leiterwagen zu Tode kam. Der 1906 auf dem Gelände des nahen Gutwasserberges angelegte Stifter-Park mit dem secessionistischen Dichterdenkmal, nach dem Zweiten Weltkrieg als Fußballplatz, Freilichtkino und Kleingartenkolonie genutzt, wird von einer nach der »sanften Revolution« von 1989 gegründeten Vereinigung gutwilliger Idealisten und freiwilliger Helfer Zug um Zug wiederhergestellt, und daß man sich dieser gewaltigen Aufgabe erklärtermaßen »zu Ehren unseres Landsmannes Adalbert Stifter« unterzieht, ist ein erfreulicher Beweis dafür, daß sich zumindest in Oberplan das vielpropagierte Werk der Aussöhnung zwischen Tschechen und Deutschen auf gutem Weg befindet.
Gleiches gilt für die Ruine der Burg Wittinghausen, die mein nächstes Ziel bildet. Es ist jenes auf der gegenüberliegenden Seite des Moldau-Stausees tief im Wald von St. Thomas versteckte Relikt, das für den jungen Adalbert Stifter von überragender Bedeutung gewesen ist. Mit 34 hält er die »zerfallene Ritterburg« in einem seiner schönsten Ölbilder fest; drei Jahre später, in seiner berühmten Erzählung »Der Hochwald«, schildert er, wie sie »von dem Tale aus wie ein luftblauer Würfel anzusehen« sei, »der am obersten Rande eines breiten Waldbandes schwebet«.
Während des 13. Jahrhunderts von einem Ritter Wittigo aus dem nahen Krumau als Festung errichtet, fällt die nur aus Wehrmauern und Turm bestehende Anlage in späterer Zeit an das Geschlecht der Rosenberger, die den Burgfried zu einem der größten von ganz Böhmen ausbauen. Hier schmachtet König Wenzel IV., als er im Zuge eines Feudalherrenaufstandes in den Kerker geworfen wird. Immer wieder wechselt Burg Wittinghausen ihre Besitzer, ist schließlich ganz dem Verfall preisgegeben, und erst 1871, als Kronprinz Rudolf den Originalschauplatz von Stifters Roman »Witiko« in Augenschein nehmen will, werden, dem hohen Besuch zu Ehren, die allernötigsten Ausbesserungs- und Konservierungsarbeiten vorgenommen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wird das Gelände – der nahen Grenze zu Österreich und Bayern wegen – Sperrgebiet, der für militärische Zwecke unbrauchbaren Burgruine ein stählerner Turm zur Luftraumüberwachung an die Seite gestellt. Daß sich 1998 erstmals Kräfte zu regen beginnen, die die Revitalisierung der Anlage und die Umwandlung des Burgfrieds in einen Dreiländereck-Aussichtsturm zum Ziel haben, ist niemand anderem als Adalbert Stifter zu verdanken: Die eilends gegründete Bürgervereinigung Wittinghausen/Vítkuv Hrádek mag nicht mit leeren Händen dastehen, wenn es am 23. Oktober 2005 den 200. Geburtstag des Böhmerwalddichters zu feiern gilt. Das ist übrigens alles andere als eine Selbstverständlichkeit: Auch unter den erklärten Büchernarren Tschechiens bilden die Stifter-Leser heute wie ehemals eine verschwindende Minderheit.
Šumava heißt der Böhmerwald auf tschechisch, also »die Rauschende« – das ist schon vom Lautmalerischen her anheimelnd, anziehend. Auch wimmelt es in der 1999/2000 zur »Landschaft des Jahres« erklärten Region, die auf der deutschen Seite in den Nationalpark Bayerischer Wald übergeht, von Stifter-Motiven. Plöckenstein lautet eines der Ziele; wer sich von Oberplan aus, immer in Westrichtung fahrend, der wildromantischen Mixtur aus Heidewiesen und Hochmoor, aus Berggipfel und Bergsee nähern will, muß aufpassen, daß er beim Studium der Landkarte keine Straße erwischt, die sich als bloßer Wanderweg entpuppt. Die Bäume werden von Mal zu Mal höher, die Felsbrocken größer, die Fahrbahn enger. Bei dem Weiler Jeleni Vrchy ist das Auto abzustellen; eine Jausenstation bietet Stärkung für den Zwei-Stunden-Marsch, den der fränkische Schriftsteller Klaus Gasseleder, ein begnadeter Literaturpilger von für seine Generation ungewöhnlicher Ausdauer, so eindrucksvoll beschrieben hat.
Mich reizt vor allem ein Kuriosum, dem Gasseleder beim Aufstieg auf den Plöckenstein nachspürt. Es ist jenes unausgeführt gebliebene Projekt des seinerzeitigen Böhmerwaldvereins, das oberhalb des Plöckensteinsees eine monströse Stifter-Huldigung vorsah: In zwei Meter hohen Buchstaben sollten Kurzzitate aus dem Werk des verehrten Dichters in die Seewand gemeißelt werden, vom Geburtsort Oberplan aus mit dem Fernglas lesbar. Doch Fürst Schwarzenberg, der Grundbesitzer, versagte dem in der Tat irrwitzigen Plan seine Zustimmung, und so blieb es bei der 1875 realisierten Miniaturversion eines steinernen Obelisken von 15 Meter Höhe, dessen Inschrift heute selbst aus nächster Nähe nur mit Mühe zu entziffern ist: »Auf diesem Anger, an diesem Wasser ist der Herzschlag des Waldes.« Kein Geringerer als der berühmte Ringstraßenarchitekt Heinrich von Ferstel, der Erbauer der Votivkirche und der Wiener Universität, hat die Entwürfe gezeichnet.
Was mir bei meinen Streifzügen durch Adalbert Stifters Böhmerland noch fehlt, sind die Spuren, die der in seinen jungen Jahren so glücklose Liebhaber hinterlassen hat. »Ich bitte Dich, weiche mir nicht aus, sag es mir geradezu – ich kann und will nicht länger in diesem Zwitterverhältnis zwischen Freundschaft und Liebe schweben!« beschwört der Fünfundzwanzigjährige die drei Jahre jüngere Friedberger Kaufmannstochter Fanny Greipl, die er, nach der Gymnasialzeit in Kremsmünster nunmehr Student in Wien, während der Sommerferien in der alten Heimat kennengelernt hat.
Das stolze Mädchen, im Elternhaus streng gehalten und auch von so manchem ansehnlicheren Jüngling, als es der pockennarbige, schlecht gekleidete und im Umgang ungeschickte Adalbert Stifter ist, heftig umworben, verhält sich abweisend. Zwar stickt sie ihm – als Gegengeschenk für das Aquarell, das Stifter von Fannys Geburtsort Friedberg gemalt hat – einen Tabaksbeutel, doch seine schwärmerischen Briefe läßt sie unbeantwortet, und greift sie ausnahmsweise doch zur Feder, so nur, um ihm mitzuteilen, daß ihre Mutter einen armen Schlucker wie ihn nie und nimmer als Schwiegersohn akzeptieren würde. Das Haus des reichen Leinenhändlers Greipl auf dem Marktplatz von Friedberg darf Stifter lediglich als Motiv in sein Aquarell einfügen; als Ort des ersehnten Beisammenseins mit der »herzinnigst geliebten Freundin« bleibt es ihm verschlossen.
Verschlossen bleibt es auch mir. Zwar finde ich Friedberg/Frymburk in groben Zügen noch genau so vor, wie es mir von Stifters Bild her vertraut ist, erkenne den langgezogenen Hauptplatz mit dem baumbestandenen Grünstreifen, dem schmalen Rinnsal und dem alten Brunnen, und wenn ich mir die Veränderungen wegdenke, die die nach wie vor anmutigen Bürgerhäuser in den 175 Jahren erfahren haben, die in der Zwischenzeit verstrichen sind, ersteht noch immer ein erstaunlich klares Bild jenes Schicksalsortes, den Stifter an mehreren Stellen seines Werkes verewigt hat. Manchmal nennt er ihn bei seinem wirklichen, manchmal gibt er ihm den Namen Pirling. Wieso Pirling? Vielleicht soll ihm die dichterische Verfremdung eine Hilfe sein, den Schmerz des abgewiesenen Liebhabers zu lindern.