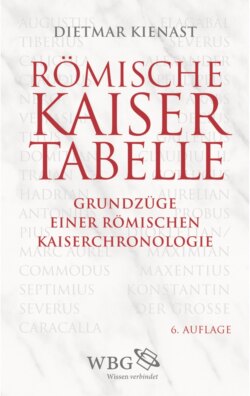Читать книгу Römische Kaisertabelle - Dietmar Kienast - Страница 7
Vorwort zur ersten Auflage
ОглавлениеGeist, Entwicklungsgang und Fatum:
Ihr Geheimnis ist das Datum,
Die Geschichte ist Kalender,
Leb’ er hoch der Einsichtspender
Und sein Segen, die Notiz!
(F. Th. Vischer: Faust. Der Tragödie Dritter Teil,
Nachspiel, Zweiter Auftritt. Gesang der Stoffhuber)
Eine bequeme Übersicht über die wichtigsten Daten der römischen Kaiserchronologie stellt seit langem ein Desiderat dar. Die nützliche Übersicht von U. Schillinger-Häfele1 reicht nur bis zu Constantin I. und beschränkt sich weitgehend auf die regulären Kaiser. Die übrigen verfügbaren Hilfsmittel sind alle älteren Datums.2 Aber gerade in den letzten Jahrzehnten sind für verschiedene Epochen oder einzelne Aspekte der Kaiserchronologie wichtige Untersuchungen erschienen, die der Nicht-Spezialist allerdings nur schwer überblicken kann. In dem vorliegenden Band sollen daher nach einer Übersicht über die Quellen und einer knappen Diskussion einzelner Elemente der Kaiserchronologie die wichtigsten Kaiserdaten von Augustus bis Theodosius I. aufgelistet werden. Der Tod Theodosius’ I. wurde als Enddatum gewählt, weil er faktisch die definitive Teilung des römischen Imperium besiegelte. Das Jahr 395 schien als Enddatum aber auch insofern sinnvoll zu sein, weil bis dahin die meisten Elemente der alten Kaisertitulatur endgültig verschwunden waren und sich mit Theodosius I. bereits das römische Kaisertum in seiner neuen byzantinischen Ausformung fest etabliert hatte.
Die Kaiserdaten werden nach einem festen Schema aufgelistet, das zumindest für die regierenden Kaiser nach Möglichkeit streng eingehalten wurde, um auch die Lücken unserer Kenntnisse sofort sichtbar zu machen. Nach dem Geburtsdatum und der Herkunft eines Kaisers wird im Allgemeinen zunächst der ursprüngliche Name angegeben, zumindest dann, wenn er von dem späteren Kaisernamen abweicht. Es folgt in Stichworten die Laufbahn, soweit sie uns bekannt ist, und dann die Erhebung zum Augustus (bzw. seit dem 2. Jh. n. Chr. zum Caesar), wobei jeweils die offizielle Titulatur angegeben ist, wie sie auf den Urkunden oder den Reichsmünzen erscheint. Mit der offiziellen Titulatur wird auch vermerkt, ob ein Kaiser die Titel pontifex maximus, pater patriae und proconsul (letzteren zunächst nur bei Abwesenheit aus Rom/Italien, später generell) geführt hat. Nur wenn sich für die Annahme von pontifex maximus und pater patriae-Titel genauere Daten angeben lassen, werden diese Titel gesondert in ihrem chronologischen Kontext aufgeführt. Es folgen die wichtigsten Einzeldaten aus der Regierungszeit des jeweiligen Kaisers, wobei zur Orientierung auch Angaben zum Itinerar aus den Werken von Halfmann und Seeck übernommen wurden.3 Am Schluss dieses Teiles findet man Angaben über Zeit und Ort des Todes sowie der Beisetzung des Kaisers (soweit bekannt) und gegebenenfalls zu seiner Consecration bzw. zur damnatio memoriae. Es folgen in Listenform Angaben über die Kaiserkonsulate, die tribuniciae potestates, die imperatorischen Akklamationen, die Siegestitel und die congiaria bzw. die liberalitates. Notiert werden ferner die von einem Kaiser bekleideten Archontate in Athen und Delphi, während Ämter in anderen Städten etwa als IIvir quinquennalis nicht berücksichtigt wurden. Auch die Indiktionszyklen, die wegen ihres festen Charakters eher zur allgemeinen Chronologie gehören, wurden nicht berücksichtigt.4 Zum Schluss findet man Hinweise auf die Familie des jeweiligen Kaisers.
Die Literaturangaben enthalten regelmäßig Verweise auf die einschlägigen Handbuchartikel, auf die Zusammenstellung der kaiserlichen Reichsmünzen in ‚Roman Imperial Coinage‘5 und auf die Kaiserikonographien (die oft auch Datierungsangaben enthalten). Dazu werden wichtige neuere Einzeluntersuchungen zu Fragen der Chronologie und der Titulatur aufgeführt. Darstellungen und Kaiserbiographien allgemeiner Art, die auf chronologische Fragen nicht näher eingehen, werden dagegen in der Regel nicht aufgeführt. Eine vollständige Bibliographie für jeden einzelnen Kaiser zu geben, war nicht beabsichtigt. Analog werden auch die Angaben für die Caesares, für die kaiserlichen Frauen und für die Usurpatoren, soweit sie namentlich bekannt sind, aufgelistet. Um das Buch nicht zu sehr zu belasten, wurden die Quellenangaben auf ein Minimum beschränkt und nicht im Einzelnen angegeben, vor allem soweit diese in den angegebenen Nachschlagewerken aufgeführt und über diese leicht aufzufinden sind. Nach Möglichkeit wurden jedoch neue oder abweichend überlieferte bzw. kontroverse Daten mit einem kurzen Quellenhinweis versehen. Dabei werden die Fasti und die Chroniken sowie die Arvalakten und die der Saecularspiele in der Regel ohne genaue Stellenangaben zitiert, da die Stellen über das angegebene Kalenderdatum meist schnell zu finden sind. Für das ‚Chronicon Paschale‘ wird nur für diejenigen Partien, die nicht in Mommsens ‚Chronica Minora‘ abgedruckt sind, auf die Ausgabe von L. Dindorf zurückgegriffen.6 Bei den fiktiven Angaben der ‚Historia Augusta‘ (und gelegentlich auch der spätantiken Breviarien) wird durch entsprechende Hinweise auf die Fragwürdigkeit dieser Überlieferung aufmerksam gemacht.
Um die Benutzung zu erleichtern, geben laufende Seitentitel die effektiven Daten des regierenden Herrschers – ebenso die entsprechenden Überschriften und das Inhaltsverzeichnis –, also z.B. für Commodus die Zeit seiner Alleinherrschaft, für Gallienus aber auch die Zeit der Samtherrschaft mit seinem Vater, für Constantius, Galerius und andere Herrscher der Tetrarchie schon die Zeit seit der Caesarerhebung. An entsprechender Stelle der Kaisertabelle wurde eine synchrone Übersicht über die Herrscher der Tetrarchie eingeschaltet.
Ein Kalendarium der römischen Kaiserdaten und -feste soll schließlich die entsprechenden Übersichten bei G. Wissowa, K. Latte und A. Degrassi um dort nicht aufgenommene bzw. inzwischen neu bekannt gewordene Daten erweitern und ergänzen.7 Eine weitere Übersicht erlauben die am Schluss des Bandes beigegebenen Stammtafeln der wichtigsten Herrscherfamilien.
Wegen der Übersichtlichkeit der Gestaltung wurde im zentralen Teil des Bandes, der Kaisertabelle, auf die sonst durchgeführte Kursivierung der lateinischen Texte verzichtet.
Für wertvolle Hinweise dankt der Verfasser Herrn Dr. Hans Roland Baldus, Herrn Dr. Johannes Nollé und Herrn Dr. Ruprecht Ziegler sowie besonders seinem Kollegen, Herrn Prof. Dr. Werner Eck, der sich trotz vielfacher Belastungen der Mühe unterzog, das Manuskript zu überprüfen. Für das Lesen der Korrekturen und ebenfalls für wertvolle Hinweise ist der Verfasser Herrn Dr. Raban von Haehling und Herrn Dr. Otfried von Vacano sowie Herrn Bernd Graf und Herrn Joachim Lehnen zu großem Dank verpflichtet. Sein besonderer Dank gilt wieder Frau Herta vom Bovert, die mit nie ermüdender Geduld und Ausdauer das schwierige Manuskript in eine übersichtliche Form brachte. Schließlich gilt der Dank des Verfassers nicht zuletzt auch Herrn Peter Heitmann, der das Manuskript für den Druck hergerichtet hat.
| Düsseldorf, Sommer 1989 | Dietmar Kienast |
1 U. Schillinger-Häfele, Consules, Augusti, Caesares. Datierung von römischen Inschriften und Münzen, Stuttgart 1986, 51ff.
2 Genannt seien die Kaiserliste im Anhang von W. Liebenam, Fasti consulares imperii Romani von 30 v. Chr. bis 565 n. Chr., Bonn 1909; die entsprechenden Listen bei R. Cagnat, Cours d’épigraphie latine, Paris 41914, und bei M. Bernhart, Handbuch zur Münzkunde der römischen Kaiserzeit, 2 Bde., Halle 1926; sowie die Angaben bei H. Dessau, Inscriptiones Latinae Selectae III 1, Berlin 1914 (1955), 257ff.
3 H. Halfmann, Itinera principum, Stuttgart 1986. O. Seeck, Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr., Stuttgart 1919.
4 S. dazu jetzt R. S. Bagnall – K. A. Worp, The chronological Systems of Byzantine Egypt, Zutphen 1978, 1ff. und K. A. Worp, ZPE 33, 1987, 91ff.
5 H. Mattingly – E. A. Sydenham u.a., The Roman Imperial Coinage I–IX, London 1923ff., I2 London 1984.
6 Vgl. unten Anm. 37.
7 Vgl. G. Wissowa, Religion und Kultus der Römer, München 1912, Anhang. K. Latte, Römische Religionsgeschichte, München 1960, Anhang (z.T. fehlerhaft). A. Degrassi, Commentarii diurni, in: Inscriptiones Italiae XIII 2, Rom 1963, 388ff.