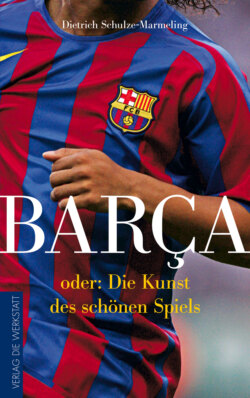Читать книгу Barca - Dietrich Schulze-Marmeling - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vorwort
ОглавлениеAm 29. November 1899 wurde in einer Turnhalle in Barcelonas Altstadt der Football Club Barcelona aus der Taufe gehoben. Initiator der Gründung war der Schweizer Hans Gamper, erster Präsident wurde der Engländer Walter Wild. Die Gründungsmitglieder waren in ihrer Mehrheit Ausländer und Protestanten, Fremde in einem Land, dessen Verfassung die „katholische, apostolische, römische Religion“ zur Staatsreligion erklärte und einzig deren Zeremonien und öffentliche Kundgebungen zuließ.
Barcelona wurde in diesen Jahren zum Manchester Spaniens, eine Stadt, deren Rhythmus von Handel und Industriearbeit bestimmt wurde. Hunderttausende zogen in die staubige, graue und laute Industriestadt voller Schlote und Elendsquartiere, die damit einen vorzüglichen Nährboden für den Fußball bot. Denn Fußballhochburgen entstanden oftmals dort, wo viele Menschen Einwanderer waren und nur einen schwachen Bezug zum Territorium hatten, wie etwa im Ruhrgebiet. Der Fußball füllte hier eine emotionale Lücke und wirkte identitätsstiftend.
Dies galt auch für den FC Barcelona. Barça, wie der Klub auch kurz gerufen wird, war schon frühzeitig „més que un club“ (mehr als ein Klub), wie das offizielle Vereinsmotto heute lautet.
Bereits 1908, ein knappes Jahrzehnt nach der Gründung, führte Hans Gamper, der seinen Vornamen zu „Joan“ katalanisieren ließ, den FC Barcelona an den Katalanismus heran, der nach politischer und kultureller Unabhängigkeit vom Zentralismus des kastilischen Madrid trachtete.
1935 wurde Josep Sunyol Präsident des FC Barcelona, ein Aktivist der katalanischen Linken. Sunyol, der im August 1936, wenige Wochen nach Ausbruch des Spanischen Bürgerkriegs, ermordet wurde, war Herausgeber der Zeitung La Rambla, die mit dem Untertitel „esport i ciutadania“ („Sport und Bürgerrecht“) erschien und eine Melange aus Sport und Politik anstrebte.
Sein Image, mehr als nur ein Klub zu sein, „verdankt“ der FC Barcelona aber vor allem den Jahren der Franco-Diktatur. Als die katalanische Sprache verboten war und die eigenständigen Strukturen Kataloniens zerschlagen wurden, avancierte Barça zur letzten katalanischen Institution und das Stadion Camp Nou zum Parlament Kataloniens. „Für den Klub zu sein hieß, gegen das Regime zu sein“, formulierte der Schriftsteller Sergie Pàmies nachbetrachtend.
Trotz internationaler Stars wie Ladislao Kubala und Trainern wie Helenio Herrera stand Barça in den Jahren der Franco-Diktatur zumeist im Schatten des großen Rivalen Real aus der Hauptstadt Madrid. In den Jahren 1956 bis 1966 wurde der Europapokal der Landesmeister von den fußballerischen Repräsentanten faschistischer Hauptstädte dominiert. Real Madrid und Benfica Lissabon vereinigten acht der elf in diesem Zeitraum vergebenen Titel auf sich.
Wenn vom spanischen Fußball jener Jahre gesprochen wird, ist noch heute viel von Schiedsrichter-Beeinflussung zugunsten Reals und auf Kosten Barças die Rede. Entscheidender war aber wohl, dass Real auf vielfältige Weise indirekt von Francos zentralistischer Politik profitierte, die Macht und Ressourcen in der Hauptstadt konzentrierte.
Barças Rettung kam aus den Niederlanden. Eine kulturelle, politische und soziale Revolution hatte in den 1960er Jahren das kleine Land von einem eher rückständigen Gebilde zu einer der progressivsten Adressen Europas katapultiert. Ein Exportschlager aus dieser Umwälzung wurde der Fußball. Barça geriet zum Objekt eines der bemerkenswertesten Kulturtransfers in der europäischen Fußballgeschichte.
1970 wurde mit dem Niederländer Rinus Michels ein Architekt des sogenannten totaal voetbal Trainer des FC Barcelona. Bergauf ging es mit Barça aber erst wieder, als zur Saison 1973/74 auch noch sein Landsmann und Schüler Johan Cruyff von Ajax Amsterdam in die katalanische Metropole wechselte. Am 17. Februar 1974 besiegte Barça das „Regime-Team“ Real Madrid in dessen Stadion Santiago Bernabéu mit 5:0. Für Millionen Spanier und Katalanen war dieser Tag der Anfang vom Ende der Diktatur. Johan Cruyff erlangte mit seinem furiosen Auftritt im Wohnzimmer des Rivalen den Status eines Erlösers (El Salvador) und Heiligen. Am Ende der Saison war der FC Barcelona erstmals seit 14 Jahren wieder Meister.
Aber auch über Amsterdam und Barcelona hinaus bediente Cruyff mit seiner Art des Fußballspielens die Lebensphilosophie vieler junger Menschen in Europa. Fußball à la Oranje bedeutete Angriffslust, Kreativität, lange Haare und das Hemd über der Hose – ein radikales Kontrastprogramm zur Strenge und Düsterheit autoritärer Regime. Für den Autor dieses Buchs war Johan Cruyff sein größtes Idol, repräsentierten der Niederländer und seine Mitspieler – ob bei Ajax, in der niederländischen Elftal oder bei Barça – doch eine gelungene Verbindung von Kollektivismus und kreativem Individualismus. Cruyff schlug nicht nur Real, sondern auch Marx, Lenin und Che Guevara um Längen. In des Autors Heimat Ruhrgebiet mochte Libuda Gott umdribbeln („Keiner kommt an Gott vorbei – außer Libuda“), aber Cruyff ließ sogar Karl Marx furchtbar alt aussehen.
Nach der WM 1974 schloss sich mit Johan Neeskens ein weiterer Niederländer den Katalanen an, mit dessen Namen insbesondere der Gewinn des Europapokals der Pokalsieger 1979 in Verbindung gebracht wird – Barças erste bedeutende europäische Trophäe, die zeitlich mit der Gewährung eines Autonomiestatuts für Katalonien zusammenfiel.
Die niederländische Fußballphilosophie und die Kunst des offensiven und schönen Fußballs hielt aber erst so richtig und nachhaltig Einzug, als Cruyff 1988 ein weiteres Mal von Ajax Amsterdam zum FC Barcelona wechselte. Diesmal als Trainer und mit seiner bereits bei Ajax erprobten Ausbildungsphilosophie im Gepäck.
Die Stadt Barcelona befand sich im Vorfeld der Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele 1992 in einem Erneuerungsrausch und entledigte sich nun auch städtebaulich der Relikte der Franco-Jahre. Aus einer grauen Industriestadt wurde eine Dienstleistungs-, Tourismus- und Kreativmetropole. Wenige Wochen vor der Eröffnung der Sommerspiele auf Barcelonas Stadtberg Montjuic gewann Cruyffs Barça erstmals den Europapokal der Landesmeister, eine Trophäe, die in Spanien bis dahin ausschließlich mit dem Rivalen Real in Verbindung gebracht wurde. Andoni Zubizarreta, Ronald Koeman, Michael Laudrup, Josep Guardiola, Hristo Stoichkov und Co. gingen als Dream-Team in die Annalen ein, das die Experten noch viele Jahre später wegen seines Pass- und Offensivspiels mit der Zunge schnalzen ließ. Luis César Menotti, Philosoph des „linken Fußballs“, aber auch ein Freund schöner Frauen, war später sogar bereit, den Anblick der nackten Models Claudia Schiffer und Naomi Campbell zugunsten dieses Teams zu verschmähen.
Als die niederländischen Klubs – bedingt durch das Bosman-Urteil und andere Entwicklungen im internationalen Fußball – auf europäischer Bühne nicht mehr reüssieren konnten, garantierte der FC Barcelona den Fortbestand der niederländischen Fußballphilosophie, wenngleich in „katalanisierter“ und internationalisierter Form.
Auch beim zweiten großen europäischen Triumph, dem Gewinn der Champions League 2006, saß mit Frank Rijkaard ein Niederländer auf der Bank, dank der Fürsprache Johan Cruyffs. Und beim erneuten Gewinn der europäischen Königsklasse 2009 führte mit dem Katalanen Josep „Pep“ Guardiola ein ehemaliger Spieler und Schüler Cruyffs das Kommando.
Der „totale Fußball“ und Fußball à la Johan Cruyff war stets mehr Idee als System gewesen. Genau betrachtet, befreite er den Fußball ein Stück weit vom System- und puren Ergebnisdenken – zugunsten eines ausdrucksvollen, kreativen Angriffsspiels. Am Anfang stand gewissermaßen eine Ablehnung von System. Das Ajax von Rinus Michels und Johan Cruyff musste massive gegnerische Abwehrriegel knacken, weshalb man die Zahl der Angriffskräfte erhöhte – durch Einbeziehung der Defensivkräfte und eines fußballspielenden Torwarts. Fußball à la Cruyff heißt in erster Linie Offensivfußball und Unterhaltung. Cruyff im Oktober 2005 über den damaligen Chelsea-Coach José Mourinho, der sich in diesen Jahren zum fußballphilosophischen Antipoden des Barça-Fußballs aufschwang: „Man kann sagen, dass er im pragmatischen Sinne ein guter Trainer ist. Aber ich glaube, dass Fußballtrainer auch die Pflicht haben, mit ihren Mannschaften zu unterhalten. Das Ergebnis darf nicht immer die einzige Sache sein, besonders nicht für große Teams wie Chelsea und Barcelona. Mourinho sagt, nur der Sieg wäre wichtig, aber ich finde, nur kleine Teams sollten so vom Ergebnisdenken besessen sein, damit sie in der Topliga bleiben. Die Topteams tragen nicht nur für sich selbst Verantwortung. Sie haben auch eine Verpflichtung gegenüber dem Spiel als solches.“
Eine Hymne auf den neuzeitlichen FC Barcelona ist unweigerlich auch eine auf Johan Cruyff – zum Ende des 20. Jahrhunderts völlig zu Recht zum „europäischen Jahrhundertfußballer“ gekürt – und auf eine in den Niederlanden geborene Idee vom Fußball.
Wer den FC Barcelona, das Estadi Camp Nou und das Museum des Klubs besucht, der realisiert, wie klein sich dagegen selbst ein hierzulande als Branchenführer gehandelter FC Bayern ausnimmt. Dabei trennen Barça und Bayern mehr als Umsatzgrößen. Es sind vor allem das unterschiedliche Gewicht der Geschichte, die politische und soziale Bedeutung, die diese Geschichte dem Verein zuweist, sowie die Existenz einer Spielphilosophie. Dies alles ist bei Barça deutlich stärker ausgeprägt, weshalb dieser Verein so viel bedeutsamer und legendärer erscheint.
Der FC Barcelona ist nicht nur ein Fußballklub, sondern der Sportklub Kataloniens. Im Trikot des FC Barcelona wird auch Handball, Basketball, Baseball, Rugby, Eishockey und Feldhockey sowie Volleyball gespielt. Barças Handballer gehören seit vielen Jahren zu den besten Europas. Siebenmal wurde die EHF Champions League gewonnen. Und die Basketballer konnten bislang 14 spanische Meisterschaften einfahren.
„Més que un club“: Dass dieses Motto heute lebendiger denn je ist, ist nicht nur dem Katalanismus seines Präsidenten Joan Laporta zu verdanken, der den FC Barcelona mit Werten wie „Sportlichkeit, Fairness, Universalismus und Gemeinwohl“ verknüpft wissen will, für den Barça „ein schöner Lebensstil“ ist und dem eine „katalanische Republik des FC Barcelona“ vorschwebt. Das Barça als „Modell des Guten in der Fußballwelt“ (Financial Times Deutschland) bezieht ganz wesentlich seine Kraft aus der Kunst des schönen Spiels, der Liebe zum Ball, dem Spaß am Spiel. Denn auch für den FC Barcelona gilt: Ohne Fußball wäre alles nichts.
Dietrich Schulze-Marmeling
Frühjahr 2010