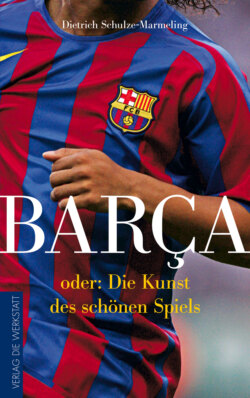Читать книгу Barca - Dietrich Schulze-Marmeling - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 3 Fußball und Bürgerkrieg
ОглавлениеAm 6. August 1936 befindet sich Josep Sunyol, seit 1935 Präsident des FC Barcelona, auf dem Weg in die Sierra de Guadarrama, einer Bergkette, die sich von Südwesten nach Nordosten erstreckt und dabei südlich in die Provinz Madrid hineinragt. Drei Wochen zuvor ist in Spanien ein erbitterter Bürgerkrieg ausgebrochen, bei dem sich die Verteidiger einer demokratischen Republik und die faschistischen Rebellen des Generals Francisco Franco gegenüberstehen.
Der Fußball ist in den Hintergrund getreten, Sunyol ist in politischer Mission unterwegs. Am 4. August hat er sich noch in Valencia aufgehalten, am Tag darauf ist er nach Madrid gereist. Und nun geht es weiter in die Guadarrama-Berge, wo Sunyol Republikaner treffen will, die noch südlich von Madrid Stellungen halten. Seinen Wagen, nebst Chauffeur eine Leihgabe der republikanischen Militärs, schmückt eine katalanische Standarte. Denn Sunyol ist nicht nur Barça-Boss. Der aus einer wohlhabenden, katalanistisch gesinnten Familie stammende Anwalt ist überzeugter Sozialist, Republikaner und Katalanist, Mitglied der Acció Catalana, einer linksgerichteten katalanischen Gruppierung mit einem gewissen Faible für den Anarchismus. Zudem fungiert er als Parlamentsabgeordneter der 1931 gegründeten links-republikanischen Esquerra Republicana de Catalunya (ERC, zu deutsch: „Republikanische Linke Kataloniens“), einem Zusammenschluss mehrerer linker und republikanischer Parteien.
Dem FC Barcelona ist Sunyol 1925 beigetreten, dem Barça-Vorstand gehört er seit 1928 an. 1930 hat er die linke Zeitung La Rambla aus der Taufe gehoben, in der er sich um eine Verzahnung von Fußball und katalanischer Politik bemüht. Nicht nur dem FC Barcelona dient Sunyol als Präsident, sondern auch dem katalanischen Automobilklub (Reial Automòbil Club de Catalunya) und dem katalanischen Fußballverband (Federaciò Catalana de Futbol).
Mord in den Bergen
Die Gegend, die Sunyol nun am 6. August 1936 durchquert, ist eines der hauptsächlichen Schlachtfelder im Ringen um die Kontrolle über Madrid. Wobei zuweilen unklar ist, wer wo genau das Sagen hat, Republikaner oder Falangisten. Hinter dem Ortsausgang der Kleinstadt Guadarramas, wo die Straße in die Berge ansteigt, wird Sunyols Wagen von falangistischen Milizionären gestoppt. Sunyol wird verhört und noch am gleichen Abend standrechtlich erschossen. Javier Cáceres: „Für den FC Barcelona war sein Tod ähnlich aufwühlend wie der Mord am Dichter Federico García Lorca für das kulturelle Spanien. Der Poet wurde kurz nach Kriegsausbruch von Mitgliedern der Guardia Civil, der militarisierten Polizei, verhaftet und erschossen.“
40 Jahre später, am Ende der Franco-Herrschaft, ist Sunyol beim FC Barcelona in Vergessenheit geraten. Und in der sensiblen Phase des Übergangs zur Demokratie möchte die Klubführung nicht mit der Erinnerung an einen Linksrepublikaner und „Separatisten“ provozieren. Erst 1996, anlässlich des 60. Todestags von Josep Sunyol, nimmt sich der FC Barcelona wieder seiner an.
Sunyol ist nicht der einzige Präsident, den Katalonien als Folge des Bürgerkriegs verliert. Im Sommer 1940 fordert El Caudillo Francisco Franco, Spaniens neuer Führer, Vichy-Frankreichs Marschall Pétain auf, 3.617 über die Grenze geflüchtete Republikaner auszuliefern. Einer der Gesuchten ist Lluís Companys, Barça-Fan, Sunyol-Vertrauter, ehemals Bürgermeister von Barcelona und Präsident der Regierung Kataloniens.
Nach der Eroberung Kataloniens durch die Truppen Francisco Francos war Lluís Companys über die Grenze nach Perpignan geflohen, später siedelte er nach Paris über, um in der katalanischen Exilregierung mitzuarbeiten. Nach der deutschen Besatzung zog er sich nach La Baule-les-Pins (Pyrénées-Atlantiques) zurück. Er blieb in Frankreich, um den Kontakt mit seinem geisteskranken Sohn Micó zu halten.
Das Vichy-Regime stimmt nur wenigen Auslieferungsbegehren zu. Aber sieben führende Köpfe der Republikaner werden der deutschen Gestapo übergeben, darunter Lluís Companys. In seiner alten Heimatstadt wird er am 15. Oktober 1940 von einem Sondergericht in einem eintägigen Schnellverfahren zum Tode verurteilt und auf Barcelonas Stadtberg Montjuic hingerichtet.
An Josep Sunyol erinnert seit dem 4. Juni 1996 ein unscheinbarer Stein am Rande Guadarramas. Die Inschrift ist schlicht, vermeidet jeden Hinweis auf Sunyols Rolle als Präsident des FC Barcelona und ERC-Politiker und bevorzugt die kastilische Version seines Namens: „José Suñol Garriga: Barcelona 21-VII-1998; Guadarrama 6-VIII-1036.“ Lluís Companys zu Ehren wird man später das Estadi Olimpic auf dem Montjuic in Estadi Olimpic Lluís Companys umbenennen und am Eingangstor der Arena eine Gedenktafel für den Ermordeten anbringen.
Demokratie und Autonomie
Am 12. April 1931 hatte man auf Barcelonas Straßen noch gejubelt. Primo de Riveras Nachfolger Brenguer hatte in ganz Spanien Kommunalwahlen ausgerufen, als ersten Schritt der Rückkehr zu einer verfassungsmäßigen Ordnung. Überraschend gewinnen am 12. April in allen spanischen Städten die Republikaner. In Barcelona, wo der Barça-Fan Lluís Companys zum Bürgermeister gewählt wird, ist die Euphorie besonders groß. König Alfonso XIII. dankt ab, und am 14. April 1931 wird die Zweite Spanische Republik ausgerufen. Die Zentralregierung in Madrid stellen nun Republikaner und Sozialisten.
Am 9. September 1932 erhält Katalonien ein Autonomiestatut und eine Regionalregierung, die Generalitat. Aus den am 20. November 1932 abgehaltenen Wahlen zum katalanischen Regionalparlament geht die ERC als klarer Sieger hervor. Ihr Führer Francesc Marcià erklärt zunächst die Unabhängigkeit Kataloniens, stimmt jedoch später dem Modell katalanischer Autonomie innerhalb einer spanischen Republik zu. Das „autonome“ Barcelona avanciert zu einem Zentrum der Avantgarde.
Am 12. Juni 1933 beerbt Lluís Companys den verstorbenen Francesc Marcià als Regierungschef Kataloniens. Bei den Wahlen zum spanischen Parlament am 19. November 1933 geht jedoch die vereinigte Rechte als Sieger hervor. Am 6. Oktober 1934 ruft Companys in einer „spanischen Oktoberrevolution“ den „Staat Katalonien innerhalb der föderalen Republik Spanien“ aus. Aber die Generalitat befehligt keine Armee, weshalb das Abenteuer schnell beendet ist. Madrid schlägt zurück: Das Autonomiestatut von 1932 wird aufgehoben, die Generalitat suspendiert, und ihre Führer werden verhaftet. Companys wird zunächst auf dem Kriegsschiff „Uruguay“ im Hafen von Barcelona festgehalten, später nach Madrid verlegt und mit der gesamten katalanischen Regierung zu 30 Jahren verschärfter Haft verurteilt.
Doch 1936 zerbricht die rechte Koalition in Madrid an internen Querelen. Bei den Wahlen vom 16. Februar 1936 gewinnt die Frente Popular (Volksfront) aus Stalinisten, Linkskommunisten, Republikanern und radikaldemokratischen Katalanisten. Allerdings verfügt die neue Regierung nur über eine knappe Mehrheit.
Infolge des Wahlsiegs wird Lluís Companys aus der Haft entlassen und in Katalonien die Generalitat wiederhergestellt – unter der Führung von Companys. Die Region erlebt einige ungewöhnlich friedliche Monate. In anderen Teilen Spaniens wachsen indessen die Spannungen. Rechte Politiker weigern sich, den Verlust der Macht anzuerkennen, und ihre Verbündeten im Militär starten Vorbereitungen für einen Staatsstreich.
Barça wird „kollektiviert“
Für die Ausrichtung der Olympischen Spiele 1924 hatte sich auch Barcelona beworben. Doch der französische IOC-Präsident Baron Pierre de Coubertin hintertrieb dieses Ansinnen, indem er in einem Brief an alle IOC-Mitglieder um die Wahl von Paris als Austragungsort bat. Auch die Austragungsorte für 1928 (Amsterdam) und 1932 (Los Angeles) wurden sehr frühzeitig festgelegt.
1936 sollte es nun endlich klappen. Die IOC-Sitzung, die über die Ausrichterstadt entscheiden sollte, fand 1931 in Barcelona statt, was sich wegen der revolutionären Wirren aber nicht als Vorteil erwies. Nur 19 IOC-Mitglieder konnten nach Katalonien reisen. Die abwesenden Mitglieder mussten per Briefwahl entscheiden. Die Auszählung ergab 43 Stimmen für Berlin und nur 19 für Barcelona. Als infolge der nationalsozialistischen Machtübernahme aus den Spielen in Berlin „Nazi-Spiele“ zu werden drohen, will die verhinderte Olympiastadt Barcelona der NS-Propagandashow etwas entgegensetzen: eine Volksolympiade auf dem Montjuic, die Olimpiada Popular.
Etwa 6.000 Sportler aus 22 Ländern melden sich an. Der größte Teil der Sportler soll aus den USA, Großbritannien, den Niederlanden, der Tschechoslowakei, Dänemark, Norwegen, Schweden und Algerien kommen. Auch im Exil lebende deutsche und italienische Sportler wollen nach Barcelona reisen. Viele Athleten werden von Gewerkschaften, sozialistischen und kommunistischen Parteien gesandt.
Die Spiele sollen vom 19. bis 26. Juli 1936 stattfinden und somit sechs Tage vor Beginn der IOC-Veranstaltung in Berlin enden. Doch am 17. Juli beginnt der bewaffnete Putsch von General Francisco Franco und anderen Armeeoffizieren gegen die Republik. Die Rebellion der Faschisten hat ihren Ausgangspunkt in einer Militärrevolte in Spanisch-Marokko. Die Fremdenlegion (Tercio) wechselt per Luftbrücke aufs europäische Festland – mit Hilfe von Hermann Görings Luftwaffe, es ist der erste deutsche Kriegseinsatz seit der Niederlage von 1918. Die Putschisten um Franco erhalten Unterstützung durch die antidemokratisch eingestellte katholische Kirche, die sich in einer zweiten Reconquista wähnt – diesmal nicht gegen die Mauren, sondern die „jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung“. Bischöfe sprechen vom „erhabensten Kreuzzug“ gegen „absurde Doktrinen“ oder die „Söhne Kains“, gemeint sind „Kommunisten und Anarchisten“.
In Barcelona kommt es zu ersten bewaffneten Konflikten, die Olimpiada Popular wird abgesagt. Sehr zum Leidwesen von Angel Mur, Platzwart des Barça-Stadions Les Corts, der am 3.000-Meter-Hindernislauf teilnehmen will. Anstatt den Montjuic zu erklimmen, muss sich Mur zwei Tage lang in seinem Haus verschanzen: „Überall waren Schießereien. Den ganzen Tag über rannten Menschen mit Pistolen und Gewehren durch die Stadt. Ich war Sportler, kein Politiker, und mein Rennen war abgesagt worden.“ Die meisten der Olimpiada-Teilnehmer, die bereits in der Stadt sind, reisen schnellstmöglich ab. Mindestens 200 bleiben und schließen sich dem Kampf zur Verteidigung der Republik an, so beispielsweise Emanuel Mink, der Kommandant der jüdischen Einheit der Internationalen Brigaden „Botwin“ wird.
Einige Wochen nach Ausbruch des Bürgerkriegs muss der verhinderte Alternativ-Olympionike Angel Mur den FC Barcelona und Les Corts gegen die Anarchisten von der CNT-FAI verteidigen. Am Morgen des 16. August 1936 entdeckt er im Stadion eine Gruppe von Männern, die Plakate aufhängen, auf denen die sofortige Enteignung des Klubs durch die anarchistische Arbeiterbewegung verkündet wird. Der Platzwart alarmiert den Barça-Vorstand. Dieser erklärt tatsächlich seine Auflösung und wird durch ein „Arbeiterkomitee“ ersetzt. Doch in diesem Komitee sitzen auch Mur und Klubsekretär Rosendo Calvet. Zwei Monate später erhalten sie Verstärkung durch drei ehemalige Barça-Direktoren, die als Vertreter der Mitglieder ins Komitee einziehen. Mur, Calvet und ihre Mitstreiter sorgen dafür, dass der formal erste „kollektivierte“ Klub Europas weiterhin eine pluralistische Einrichtung bleibt.
Krieg zwischen Moderne und Konservativismus
Der europäische Bürgerkrieg, der de facto seit dem Ersten Weltkrieg schwelt und in dem ein großer Teil der europäischen Kulturlandschaft die Ideen von 1789 zurückweist, findet in Spanien seinen greifbarsten Ausdruck.
Der italienische Politologe Enzo Traverso resümiert in seinem brillanten Werk „Im Bann der Gewalt“ (2007) den Spanischen Bürgerkrieg als „einen Krieg zwischen der Moderne und dem Konservativismus, in dem die Vertreter des katholischen und ländlichen Spaniens denen des modernen Spaniens, das die Republik verkörperte, entgegentraten. Zudem war es ein Nationalkrieg, in dem die imperiale kastilische Tradition gegen das Autonomiebestreben der Regionen, vor allem Kataloniens, kämpfte. Darüber hinaus war es aber auch ein Klassenkrieg des städtischen und ländlichen Proletariats gegen das Kapital und den Grundbesitz, der von einem Krieg zwischen dem Faschismus und der Demokratie begleitet wurde. Überdies gab es auch noch einen Bürgerkrieg innerhalb des Bürgerkriegs, da sich auch im republikanischen Lager selbst Revolution und Konterrevolution gegenüberstanden, was im Mai 1937 in Katalonien sogar zu bewaffneten Auseinandersetzungen führte. Nicht zuletzt war es ein europäischer Krieg zwischen der Demokratie und dem Faschismus, in dem das franquistische Lager vom Italien Mussolinis und von Hitler-Deutschland unterstützt wurde, während die Sowjetunion die republikanischen Kräfte mit Waffen belieferte.“
Im Kampf gegen Francos Truppen erhält die republikanische Regierung Unterstützung durch Freiwilligenverbände aus zahlreichen Ländern. In den Internationalen Brigaden kämpfen ca. 40.000 Mann, darunter auch 5.000 Deutsche. Die Brigaden sind politisch heterogen. In ihren Reihen finden sich bürgerliche Liberale und Intellektuelle (George Orwell, Alfred Kantorowicz), Stalinisten, Sozialisten, Anarchisten etc. Prominente Schriftsteller arbeiten als Berichterstatter und schaffen eine Gegenöffentlichkeit zur Propaganda Francos und der Achsenmächte. Ilja Ehrenburg berichtet für Istwestija, Arthur Koestler für den New Chronicle, Kim Philby für die Times, Ernest Hemingway, Louis Aragon und Antoine de Saint-Exupéry sind ebenfalls vor Ort. Ebenso profilierte Fotografen wie Robert Capra, David Semur, Hans Namuth und Georg Reisner, die Fotoreportagen für Magazine in aller Welt erstellen. Erstmals wird die Fotografie zur politischen Waffe im Kampf um die Sympathien des Publikums.
Nach den Machtübernahmen Mussolinis (1924) und Hitlers (1933) sieht die europäische Linke in den Siegen der Volksfrontbündnisse in Spanien und Frankreich (Mai 1936) eine Trendwende. Spanien wird zum Schlachtfeld, wo der Gegner endlich zu stellen ist. Willy Brandt schreibt von der „ersten offenen Schlacht gegen den internationalen Faschismus“.
Tatsächlich scheitert der Putsch der Militärs um Franco und Emilio Mola zunächst in Katalonien mit Barcelona, in Valencia, Madrid, Andalusien, Asturien und im nördlichen Teil des Baskenlandes. Doch aus dem Putsch wird ein Bürgerkrieg, der fast drei Jahre tobt und einen enormen Blutzoll fordert. Der amerikanische Historiker Gabriel Jackson schätzt, dass 100.000 während der Kampfhandlungen fielen, 10.000 bei Bombenangriffen und 50.000 kriegsbedingt an Krankheiten und Hunger starben. Weitere 150.000 bis 200.000 wurden Opfer der politischen Repression, wobei mindestens zwei Drittel davon auf das Konto der Franquisten gingen.
Ligafußball in einem geteilten Land
Kein gesellschaftlicher Bereich bleibt vom Bürgerkrieg verschont, schon gar nicht der Fußball. Im Februar 1937 verlegt der spanische Fußballverband sein Hauptquartier von Madrid nach Barcelona. Im Juni desselben Jahres bilden die Anhänger Francos in San Sebastián einen Alternativverband, der sich für allein rechtmäßig erklärt. Im Geltungsbereich dieses Verbandes liegen einige der prominentesten Klubs Spaniens, so FC und Betis Sevilla, Real Saragossa, Celta Vigo, Deportivo La Coruña und Athletic Bilbao.
Die FIFA steht vor einem Dilemma, da ihre Statuten nur die Anerkennung eines Verbandes pro Land vorsehen. Der Weltverband lässt den etablierten und von republikanischen Kräften dominierten offiziellen Verband im Regen stehen, indem er ausnahmsweise und vorübergehend beiden Organisationen seine Anerkennung erteilt. So hält sich die FIFA für den Ausgang des Bürgerkriegs alle Optionen offen. Nach dessen Ende wird der italienische Vertreter im Exekutivkomitee der FIFA, der Faschist Giovanni Mauro, ein öffentlicher Unterstützer der Franco-Bewegung, einen Alleinvertretungsanspruch des Fußballverbandes in San Sebastián durchsetzen.
Ein Produkt des Bürgerkriegs ist auch die noch heute existierende Sporttageszeitung Marca, deren Erstausgabe 1938 erscheint und auf ihrem Titelblatt ein blondes Mädchen mit dem Faschistengruß zeigt.
Die nationale Liga stellt nach der Saison 1935/36 ihren Spielbetrieb ein. In einem Land, das in eine republikanische und anti-republikanische Zone geteilt ist, erscheint ein gemeinsamer Spielverkehr undurchführbar. Die Klubs in den republikanisch beherrschten Teilen Spaniens messen sich nun in einer „Mittelmeer-Liga“ miteinander. Die acht Teams kommen aus Katalonien und der Region Valencia. 1937 wird Barça vor Espanyol Champion der Liga. 72 Jahre später, im April 2009, kündigt der FC Barcelona an, dass er von Historikern prüfen lasse, ob der Liga-Gewinn von 1937 als spanische Meisterschaft zu werten sei. Vorausgegangen ist eine Entscheidung des spanischen Parlaments, UD Levante nachträglich zum Cupsieger des Jahres 1937 zu küren, in dem die Valencianer den Pokal in der republikanischen Zone gewonnen hatten.
Als während der Saison 1937/38 das republikanische Territorium weiter schrumpft, wird eine Lliga Catalunya organisiert, der ausschließlich katalanische Klubs angehören.
Kicken im Exil
Die katalanischen Kicker, die sich vor den Franco-Truppen ins Exil absetzen, sind nicht die ersten Fußball-Flüchtlinge der Geschichte. Eine politisch motivierte Emigration von Fußballern gab es bereits kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Schauplatz war Wien, die erste multikulturelle Stadt auf dem Kontinent. Wien war eine Einwandererstadt – vor allem für Tschechen, Ungarn sowie ost- und mitteleuropäische Juden. Genau hieraus sollte der Wiener Fußball seine Stärke beziehen. Wien avancierte zur ersten kontinentalen Fußballmetropole, Anziehungspunkt für ausländische Spieler auch deshalb, weil Österreich 1924 als erstes kontinentales Land das Profitum legalisierte.
1919 hatte in Ungarn der rechtsgerichtete Admiral Miklos Horthy mit der Armee die Macht übernommen. Es folgte der „weiße Terror“, der sich vor allem gegen die Juden im Land richtete, unter denen sich überproportional viele Aktivisten und Befürworter der rätekommunistischen Bewegung Bela Kuns befanden. Im Sommer 1919 nutzten prominente Spieler des als „jüdisch“ firmierenden Budapester Klubs MTK eine Deutschland-Tournee ihres Teams, um den drohenden autoritären Verhältnissen in ihrer Heimat zu entkommen. Der als Fußballgott gefeierte Alfred „Spezi“ Schaffer und Peter Szabo blieben in Deutschland, Schaffer spielte später aber auch u. a. für Austria Wien. Ferenc Platko, Barças erster Ungar, verließ ebenfalls das Land und schloss sich zunächst dem Wiener Association Football-Club an, bevor er vorübergehend nach Budapest zurückkehrte. Als MTK Budapest 1922 eine Spanien-Tournee unternahm, blieb der Keeper, von den Barça-Verantwortlichen als Nachfolger von Ricardo Zamora ausgeschaut, in Barcelona hängen.
Der spanische Bürgerkrieg löste eine weitere Welle von Fußball-Flüchtlingen aus. Im März 1937 erobern Francos Truppen das Baskenland, im Juni fällt auch dessen industriell bedeutende Metropole Bilbao in ihre Hände. Um den Wirren des Bürgerkrieges zu entgehen und für die republikanische und baskische Sache zu werben, startet im April 1937 ein Team mit dem Namen „Republik Euskadi“ eine Auslandstournee, darunter immerhin sechs Akteure aus dem spanischen WM-Kader von 1934. Man absolviert Freundschaftsspiele zunächst in Frankreich (Racing Club de Paris, Olympique Marseille, Sète) und der Tschechoslowakei, bevor man Ende Juni in der Sowjetunion eintrifft. Von den neun Begegnungen in Moskau, Kiew, Tiflis und Minsk werden sieben gewonnen. Lokomotive Moskau unterliegt den Basken mit 1:4, Lokalrivale Dynamo mit 4:7. Auch Dynamo Kiew muss sich den Basken beugen (1:3), ebenso eine Auswahl der Stadt Minsk (1:6). In der Geschichte des sowjetischen Fußballs nehmen diese Spiele eine bedeutende Stellung ein, denn die Vorführungen der Basken revolutionieren den bis dahin von der Außenwelt weitgehend abgeschnittenen Fußball im kommunistischen Vielvölkerstaat. So machen die Gäste ihre Gastgeber mit dem W-M-System bekannt.
Nach dem Aufenthalt in der Sowjetunion reist das Team nach Lateinamerika, wo die Basken wiederholt in Mexiko City und Havanna auflaufen. Die Rückkehr nach Bilbao ist nach dem Fall der Stadt nicht mehr möglich. Auch in Lateinamerika kann die Euskadi-Auswahl reüssieren. Fast sämtliche Auftritte enden mit einem Sieg der Basken, so auch vier Begegnungen gegen die Nationalelf Mexikos. Die Spiele wurden möglich, nachdem der mexikanische Fußballverband das baskische Team in seinen Reihen aufnahm. In der Saison 1938/39 spielt das Team Euskadi in der mexikanischen Hauptstadtliga mit, wo es hinter Asturias de Mexico den zweiten Platz belegt. Von den 30 baskischen Akteuren bleiben schließlich 28 in Lateinamerika, wo sie den Klubfußball Mexikos und Argentiniens bereichern.
Auch der FC Barcelona geht auf Tour, um eine Auszeit vom Bürgerkrieg zu nehmen. Im April 1937 erreicht den Klub eine Einladung des mexikanischen Geschäftsmannes und ehemaligen Basketballers Manuel Sas Sariano. Barça soll in Mexiko einige Spiele gegen lokale Teams bestreiten. Die Visite wird mit 15.000 Dollar Cash und der Übernahme von Reisekosten und Verpflegung honoriert. In Mexiko erfährt das Team einen warmherzigen Empfang. Seit 1934 wird das mittelamerikanische Land von dem progressiven Politiker und General Lázaro Cárdenas del Rió regiert. Zahllose Flüchtlinge aus Europa finden hier ein Asyl. Allein 1938 nimmt das Land, trotz immenser innen- und wirtschaftspolitischer Probleme, über 40.000 Flüchtlinge des Spanischen Bürgerkriegs auf. Im Mai 1939, nach dem Ende des Bürgerkriegs, erklärt sich die mexikanische Regierung sogar zur Aufnahme von 150.000 republikanischen Flüchtlingen aus dem französischen Exil bereit.
Von Mexiko aus reisen die Barça-Kicker weiter in die USA, wo sie sich in New York u. a. mit einem Team lateinamerikanischer Immigranten – Hispano of Brooklyn – messen. Von 16 Spielern kehren nur vier mit dem irischen Coach Patrick O’Connel und Klubsekretär Rosendo Calvet in die Heimat zurück. Die Mehrheit lässt sich in Mexiko nieder, drei Spieler gehen nach Frankreich ins Exil.
Die Einnahmen aus der Tournee betragen stattliche 12.500 Dollar. Rosendo Calvet trifft eine weise Entscheidung, als er die Summe auf ein Konto einer Pariser Bank einzahlt. Denn in Barcelona droht die Beschlagnahmung im Namen der Revolution. So aber verfügt der Klub über das notwendige Kapital für den Neustart nach dem Bürgerkrieg.
Vom Futbol Club zum Club de Fútbol
Am 16. November 1938 verlieren die Republikaner eine entscheidende Schlacht am Ebro. Einige Wochen später beginnt die Invasion Kataloniens. Am 16. Januar 1939 ziehen Francos Truppen in Barcelona ein. Falangistische Schlägertrupps marodieren durch die Straßen und bedrohen Passanten: „Bell nicht, katalanischer Hund, sprich christlich!“ Und die christliche Sprache ist kastilisch. Unter dem Franco-Regime wird das Katalanische seine gründlichste Unterdrückung erfahren. Nach dem Fall Kataloniens überqueren ca. 450.000 Republikaner die Grenze nach Frankreich. Unter denjenigen, die Zuflucht im Nachbarland suchen, befinden sich auch die Großeltern des späteren französischen Fußballstars Eric Cantona.
Am 28. März 1939 fällt auch Madrid in Francos Hände. Drei Tage später erklärt Franco das Ende des Bürgerkriegs. Zu den ersten Gratulanten gehört Papst Pius XII.: „Der katholische Glaube hat soeben den Anhängern des materialistischen Atheismus unseres Jahrhunderts den erhabensten Beweis dafür geliefert, dass die ewigen Werte der Religion und des Geistes über allem stehen.“
Der Terror geht anschließend weiter. Im ersten Jahrzehnt der Franco-Herrschaft werden im Rahmen eines „legalen Bürgerkriegs“ ca. 270.000 Republikaner in Konzentrationslagern festgehalten. Mindestens 50.000 Menschen werden vom Regime hingerichtet. Franco zeichnet den Tod durch die Garotte gewöhnlich bei einer Tasse Kaffee ab, im Beisein seines persönlichen Priesters José Maria Bulart. Wer der Todesstrafe entgeht, dem steht eine lange Haftzeit unter schrecklichen Bedingungen in einer der 500 „Besserungsanstalten“ bevor.
Unter der Diktatur wird der spanische Sport zentralisiert. Seine Verbände und Vereine verlieren jegliche Autonomie und unterliegen fortan der Kontrolle durch die Delegación Nacional de Deportes de Falange Española Tradicionalista y de la JONS, an deren Spitze der Bürgerkriegsheld und Fußballfan General José Moscardó steht. In einem Akt von Exorzismus lässt Moscardó die „Befreiung“ Kataloniens im Barça-Stadion Les Corts feiern, wo 24.000 Falangisten parieren und Ernest Giménez Caballero, ein rechter Intellektueller und Mitverfasser des Anti-Autonomie-Dekrets der Regierung, als Festredner auftritt.
Am 15. Januar 1941 muss sich der Futbol Club Barcelona in Club de Fútbol Barcelona umbenennen. Der katalanische Name fällt dem Verbot der katalanischen Sprache zum Opfer. Auch das Klubemblem muss verändert werden: Zwei der vier Streifen in der katalanischen Fahne werden gestrichen, sodass dieser Teil des Wappens nur noch als Wiedergabe der spanischen Farben erscheint. Offizielle Ankündigungen des Klubs müssen fortan in Spanisch erscheinen, die katalanische Fahne ist im Stadion verboten. Die Mitgliederlisten werden von der Polizei registriert. Nach dem Gewinn von Trophäen pflegte Barça zur „Schwarzen Madonna“ im ca. 50 km nordwestlich von Barcelona gelegenen Kloster Montserrat zu pilgern. Dies ist in Zukunft nur mit Auflagen gestattet: Nur noch nach spanischen Meisterschaften darf gepilgert werden, nicht mehr nach katalanischen; die Strecke muss in Bussen, Zügen oder Privatautos zurückgelegt werden und darf nicht den Charakter einer Demonstration annehmen. Weshalb zwischen den einzelnen Fahrzeugen eine Distanz von nicht weniger als zwei Kilometern einzuhalten ist.
Der katalanische Bestseller- und Krimi-Autor Manuel Vázquez Montalbán später: „Francos Besatzungstruppen betraten die Stadt. Auf dem vierten Platz der Liste der Organisationen, die nun verfolgt wurden, stand hinter den Kommunisten, Anarchisten und Separatisten der Barcelona Football Club. Der FC Barcelona verlor den Bürgerkrieg fast in gleichem Maße wie die Arbeiter, die Anarchisten, die Künstler und die Demokraten.“
Zahlreiche Barça-Spieler gehen ins Exil. Einige von ihnen kehren zurück, dürfen aber zunächst nicht wieder für die 1. Mannschaft auflaufen. Erster Präsident nach Kriegsende wird der Aristokrat Enrique Pineyro (Marqués de la Mesa de Asta), der zuvor keinerlei Beziehungen zum Klub unterhielt, aber den Franco-Kräften sehr nahe steht. Allerdings umgibt sich der vom Regime Bestellte in seinem Vorstand mit lebenslangen Barça-Männern. Der Pragmatiker Pineyro sorgt dafür, dass der Bann gegen die aus der Emigration zurückgekehrten Spieler auf wenige Monate reduziert wird. In den folgenden Jahren lässt sich immer wieder beobachten, dass auch die Franco-Gefolgsleute im Barça-Vorstand nicht immer einfach nur im Sinne des Regimes handeln können, was ihnen wiederholt Schwierigkeiten mit der Madrider Zentralgewalt beschert.