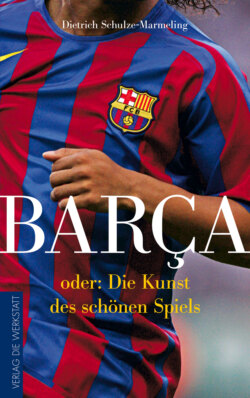Читать книгу Barca - Dietrich Schulze-Marmeling - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 2 Ein Fußballklub, ein Diktator und erste Stars
ОглавлениеIn den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts spitzen sich in Spanien die sozialen, wirtschaftlichen und politischen Probleme weiter zu. Dies gilt auch für Barcelona: Einige seiner Stadtviertel sind hoffnungslos überbevölkert; die Kindersterblichkeit in der Stadt ist eine der höchsten Europas. Barcelona wird zu einer Stadt des Protests und Widerstands, zur europäischen Hochburg der Gewerkschaften sowie der sozialistischen und anarchistischen Arbeiterbewegungen.
Im Juli 1909 werden im Hafen von Barcelona Soldaten für den Kolonialkrieg in Marokko rekrutiert. Bei Barcelonas Unterschicht stößt dies auf massiven Protest, zumal wohlhabende Familien ihre Söhne vom Kriegsdienst freikaufen können. Die Proteste fallen mit einer Streikwelle zusammen und eskalieren in den Tagen vom 26. bis 31. Juli zu einer Rebellion, deren Zentrum der heutige Stadtteil Raval ist. Insbesondere kirchliche Einrichtungen geraten ins Visier der Rebellen. So werden in dieser Woche in Barcelona zwölf Kirchen, 40 Konvente und 24 weitere kirchliche Einrichtungen in Brand gesetzt. Der Kriegszustand wird ausgerufen, und Militär schlägt die Revolte nieder. Binnen einer Woche kommen über 100 Menschen ums Leben. Eine Reihe der Aufständischen wird exekutiert, unter ihnen auch der Anarchist und antiautoritäre Pädagoge Francesc Ferrer i Guàrdia, Gründer der ersten Volksbildungshäuser, in denen Barcelonas Analphabetismusrate von 70 Prozent bekämpft werden sollte. Ferrer ist an den Unruhen zwar nicht beteiligt, wird aber der „moralischen Verantwortung“ bezichtigt. Die Ereignisse gehen als Setmana Tràgica in die Geschichte Kataloniens ein.
Ein Jahr später gründet sich in Barcelona die bis heute berühmteste Organisation in der Geschichte des Anarchismus, die Confederación Nacional de Trabajo (CNT). Die anarchistische Gewerkschaft wächst in den nächsten Jahren zu einer Massenorganisation, in der 1918 rund 80 Prozent der katalanischen Arbeiter organisiert sind.
Barças erster Goalgetter: Paulino Alcántara
1910 beginnt die zweite Amtszeit Hans Gampers, die bis 1913 dauert. Der FC Barcelona gewinnt erneut die Meisterschaft Kataloniens und anschließend erstmals den seit 1902 ausgespielten spanischen Pokal, Copa del Rey. 1912 überwirft sich Barça sowohl mit dem spanischen wie dem katalanischen Fußballverband und tritt aus beiden vorübergehend aus.
Am 15. Februar 1912 debütiert der erst 15-jährige Paulino Alcántara im Barça-Trikot. Im Spiel des Campeonato de Catalunya gegen den SC Catalá steuert er drei Tore zum 9:0-Sieg bei. Bis heute ist Alcántara der jüngste Spieler und Torschütze in der Geschichte des FC Barcelona. Und der erfolgreichste philippinische Fußballer aller Zeiten, denn das Wunderkind kam auf den Philippinen zur Welt.
1913 und 1916 gewinnt Barça mit Alcántara, der mit dem Flügelstürmer Emilio Sagi ein höchst effektives Tandem bildet, den Campeonato de Catalunya und 1913 auch noch den Copa del Rey. Dank Alcántara und Sagi steigt Barça in diesen Jahren zu einem der führenden Klubs Spaniens auf.
1916 beschließen Alcántaras Eltern die Rückkehr auf die Philippinen. Der Sohn muss mit, studiert dort Medizin und läuft 1917 für die Nationalelf der Philippinen auf. Auch an der Tischtennisplatte vertritt Alcántara sein Land. Der FC Barcelona bemüht sich in Gesprächen mit den Eltern immer wieder um die Rückkehr des Goalgetters. Was aber erst gelingt, als Alcántara an Malaria erkrankt und dies zur Erpressung seiner Eltern benutzt. Alcántara will sich nur unter der Bedingung behandeln lassen, dass er nach Spanien zurückkehren darf.
Barça wird katalanisiert
Im Ersten Weltkrieg bezieht Spanien eine Position der Neutralität, von der die spanische und insbesondere die katalanische Wirtschaft profitiert. Kataloniens Wirtschaft boomt. In Katalonien werden u. a. Uniformen für die französische Armee hergestellt.
In Barcelona etabliert sich eine internationale Flüchtlingsgemeinde, bestehend aus Menschen, die sich dem Krieg und Kriegsdienst entziehen wollen. Unter ihnen die avantgardistischen Künstler Sonia und Robert Delaunay, Francis Picabia, Marie Laurencin und Albert Gleizes.
Derweil sieht sich Hans Gamper erneut Angriffen ausgesetzt. War es zuvor mehr seine protestantische Konfessionszugehörigkeit, ist es nun seine angebliche „Deutschfreundlichkeit“ als Deutschschweizer, die stört. Und seine Handelsgeschäfte leiden unter den unsicheren Seewegen.
In der Stadt gärt es. Die Bevölkerung Barcelonas hat sich in den vergangenen 20 Jahren verdoppelt. Die katalanische Metropole ist nun nicht nur die größte Stadt Spaniens, sondern mit ihren Industrien auch die einzige proletarische Stadt des Landes und das „Manchester Kataloniens“. 1917 führen starke Lohnverluste der Arbeiterschaft zu Protesten, die von der anarchistischen Gewerkschaft CNT – 1910 gegründet, aber erst 1915 nach mehreren Jahren des Untergrunddaseins zugelassen – angeführt werden. In den Städten (insbesondere Barcelona) entwickelt sich eine gewerkschaftliche Tradition des Syndikalismus, der sich auf den russischen Anarchisten Bakunin bezieht. Die CNT will mit einer Politik der „Direkten Aktion“ den Staat überwinden und seine Institutionen ersetzen durch Selbstverwaltungsorgane, Industrieverbände unter der Kontrolle der Arbeitenden sowie durch freiwillige Verträge autonomer Organisationen. CNT und die sozialistische Gewerkschaft Unión General de Trabajadores (UGT) rufen zum Generalstreik auf.
In den Jahren 1917 bis 1925 treten Barças Sympathien mit dem politischen Katalanismus noch deutlicher zutage. Als US-Präsident Woodrow Wilson 1918 das Recht der Nationen auf Selbstbestimmung proklamiert, gewinnt die Bewegung für katalanische Unabhängigkeit weiter an Stärke. Pro-katalanische Organisationen werben mit einer Petition für Autonomie. Zu den Unterzeichnern gehört auch der FC Barcelona. Lokalrivale RCD Español initiiert eine eigene Petition, die sich gegen Autonomie ausspricht. Der Inhalt stammt aus der Feder von Pena-Ibérica-Mitgliedern, einer Schlägertruppe, die auf den Straßen Barcelonas die Autonomisten attackiert. 1933 tritt Pena Ibérica den Falangisten bei und kämpft im Bürgerkrieg auf Seiten Francos.
Beim FC Barcelona wird Katalanisch zur offiziellen Sprache des Klubs. Hans Gamper, der 1917 seine dritte Amtszeit als Barça-Präsident angetreten hat, wird mehr und mehr zum überzeugten katalanischen Nationalisten. Am 23. Juli 1920 katalanisiert der Verein eine Hälfte seines Namens: Aus dem Football Club wird ein Futbol Club. Die Zeitung La Veu de Catalunya schreibt: „Der Futbol Club Barcelona ist der katalanische Klub geworden.“ Nur zwei Jahrzehnte nach seiner Gründung ist Barça zu einem nationalen Symbol Kataloniens avanciert.
El Mag und El Divi
1917 verpflichtet Gamper mit dem Engländer John Barrow den ersten Profitrainer in der Geschichte des FC Barcelona, dem nur wenige Monate später Landsmann Jack Greenwell folgt. Der Sohn eines Bergarbeiters aus der englischen Grafschaft Durham ist bereits 1912 als Spieler von Crook Town zum FC Barcelona gestoßen. 1916 beendete Greenwell seine Spielerkarriere nach 88 Einsätzen und zehn Toren für Barça.
1919 gelingt dem FC Barcelona die Verpflichtung des 17-jährigen Offensivspielers Josep Samitier und des ein Jahr älteren Torwarts Ricardo Zamora. Samitier kommt vom FC Internacional Barcelona. „El Sami“ ist ein „totaler Fußballer“, der das gesamte Spielfeld zu seinem Aktionsraum erklärt und ständig die Position wechselt. Seine Kreativität und seine Beweglichkeit bringen ihm die Spitznamen El Mag (der Magier) und Home Llagosta (Grashüpfer-Mann) ein. Zamora kommt von Español. Der Sohn eines Arztes ist in Barcelonas Stadtteil Sarrià y Urgel aufgewachsen. Die spätere Torwartlegende ist ein Multisportler, der sich auch als Boxer, Schwimmer und Leichtathlet betätigt. Seine überragende Reaktionsschnelligkeit hat er dem baskischen Spiel Pelota zu verdanken. Für den Wechsel zum FC Barcelona bricht Zamora sein Medizinstudium ab.
Zamora und Samitier sind auch dabei, als Spanien 1920 sein erstes offizielles Länderspiel bestreitet. Im Rahmen der Olympischen Spiele in Antwerpen trifft die spanische Auswahl in Brüssel auf Dänemark und gewinnt mit 1:0. Die Selección beendet das Turnier mit der Silbermedaille. Eigentlich sollte auch der zurückgekehrte Paulino Alcántara mitwirken, der aber kurz vor den Abschlussprüfungen seines Medizinstudiums steht. Alcántara spielt später noch für Spanien. Als die Selección Frankreich am 22. April 1922 in Bordeaux mit 4:0 besiegt, schmettert der zweifache Torschütze Alcántara den Ball mit einer solchen Wucht ins Tor, dass das Netz zerreißt.
Mit Jack Greenwell als Trainer, Alcántara, Samitier und Zamora beginnt mit der Saison 1918/19 Barças erste goldene Dekade. Im Zeitraum 1918 bis 1924 gewinnt der Verein zunächst fünfmal den Campeonato de Catalunya sowie 1920 und 1922 den Copa del Rey.
Zamora, Kettenraucher (65 Stück pro Tag; bei Barça wird ihn allerdings später noch Johan Cruyff übertreffen), Cognac-Freund und Frauenschwarm, seit dem Olympischen Turnier nur noch El Divi (der Göttliche) genannt und einer der ersten Superstars des europäischen Fußballs, kehrt im Sommer 1922 nach einem Disput mit Hans Gamper zu Español zurück.
Jack Greenwell verlässt den FC Barcelona 1924 und trainiert anschließend noch CD Castellón, Español, RCD Mallorca, erneut Barça, den FC Valencia, Sporting de Gijon, den peruanischen Klub Universitario de Deportes und schließlich die Nationalelf des Andenlandes. Nur Johan Cruyff wird sich später beim FC Barcelona noch länger auf dem Trainerstuhl halten. Greenwells Nachfolger wird der Ungar Jesza Poszony, dem bis 1931 mit Ralph Kirby und James Ballamy wieder zwei Engländer folgen, bevor Greenwell noch einmal für zwei Spielzeiten das Zepter übernimmt.
Paulino Alcántara bleibt dem FC Barcelona bis zum 3. Juli 1927 erhalten. Dann hängt er seine Fußballschuhe an den Nagel, um den Beruf des Arztes nun in Vollzeit auszuüben. Der Goalgetter kommt in 357 Spielen für Barça auf sagenhafte 356 Tore, bis heute Klubrekord. In den Jahren 1931 bis 1934 sitzt Alcántara im Aufsichtsrat des FC Barcelona.
Samitier bleibt bis 1933 beim FC Barcelona und ist in den 1920ern der bestbezahlte Profi in Barças Team und gemeinsam mit Españols Zamora wohl auch in Spanien.
Unruhige Zeiten
1921 beginnt die vierte Amtszeit von Hans „Joan“ Gamper als Barça-Präsident. Gamper agiert erneut als Retter, die Existenz des Klubs ist von politischen Zerwürfnissen bedroht. Der mittlerweile zu Wohlstand gelangte Immigrant ermöglicht mit einer Unterstützung von einer Million Peseten den Bau des Stadions Les Corts im gleichnamigen Stadtteil, dessen Kapazität zunächst 20.000 (später: 60.000) beträgt und dem Klub bis 1957 bzw. bis zum Bau von Camp Nou als Spielstätte dient.
Vor dem Hintergrund des anhaltenden Chaos in Barcelona und der Krise im Kolonialkrieg in Marokko ruft König Alfonso XIII. 1923 den Generalkapitän von Barcelona, Primo de Rivera, nach Madrid. Um die permanente Staatskrise zu beenden, errichtet Primo de Rivera am 13. September 1923 in Absprache mit dem König eine Militärdiktatur. Ab 1925 werden auch Zivilisten in die bis dahin ausschließlich mit Militärs besetzte Junta aufgenommen, und Rivera tauft sich zum „Ministerpräsidenten“ um.
Primo de Rivera erfreut sich zunächst der Zustimmung der konservativen Katalanisten und des katalanischen Bürgertums – dank vager Autonomieversprechungen, die er allerdings nie einlösen wird, sowie der Unterdrückung der Arbeiterbewegung einschließlich des Verbots der CNT.
Doch die Stimmung dreht sich bald. Als die mancumunitat, die 1914 gewährte Union der vier katalanischen Provinzen, aufgehoben wird, als das Regime gegen die katalanische Sprache und katalanischen Symbole vorgeht, rückt das katalanische Bürgertum mehr und mehr auf Distanz zu De Rivera. Die Militärdiktatur und ihr hartes Vorgehen gegen separatistische Bestrebungen hat eine Radikalisierung und Popularisierung des katalanischen Nationalismus zur Folge.
In Barças Jubiläumsjahr 1924 beginnt die fünfte und letzte Amtszeit von Hans Gamper. Anlässlich des 25-jährigen Bestehens schreibt die satirische Sportzeitschrift Xut (Der Schuss), dass „der glorreiche FC Barcelona in seiner Frühzeit richtiggehend ‚exotisch‘ war. So nach und nach wurde er katalanisiert, und 25 Jahre Hartnäckigkeit haben ausgereicht, das Volk für sich zu gewinnen“. Das Jubiläumsposter zeichnet der aus Valencia stammende Künstler Josep Segrelles, einer der fähigsten und prominentesten Illustratoren des 20. Jahrhunderts.
Erfolgreich verläuft Barças Kampagne zur Gewinnung neuer Mitglieder: 25 Jahre nach der Gründung sind es schon 12.207.
Eklat in Les Corts
Zur Saison 1924/25 verstärkt sich der FC Barcelona mit dem deutschen Abwehrspieler Emil „Emilio“ Walter. In Deutschland spielte Walter während des Ersten Weltkriegs bereits 16-jährig für die 1. Mannschaft des FC Germania Brötzingen. 1922 hatte der gelernte Kaufmann die inflationsgeplagte Heimat verlassen und war nach Katalonien ausgewandert. Dort schloss er sich zunächst Unió Esportiva Figueres an, bevor Barça auf ihn aufmerksam wurde. Walter wird bis 1933 242 Pflichtspiele für den FC Barcelona bestreiten und dabei dreimal den Copa del Rey gewinnen. Laut dem Fußballforscher Andreas Wittner wird Walter zeitweise als bester Verteidiger Spaniens gehandelt. Für die deutsche Nationalelf reicht es trotzdem nicht, denn der DFB mag keine Profis und Legionäre. Für Spanien wiederum kann Walter wegen seiner deutschen Staatsangehörigkeit nicht auflaufen. Nur in der Auswahl Kataloniens darf der populäre Deutsche mitwirken.
Am 14. Juni 1925 ist das Barça-Stadion Les Corts Bühne eines Benefiz-Spiels, bei dem sich der FC Barcelona und der ebenfalls in Barcelona beheimatete Klub Jupiter gegenüberstehen. 14.000 Zuschauer sind ins Stadion gekommen. Die Eintrittsgelder sollen dem Orfeó Català zugutekommen, einer 1891 von Lluís Millet und Amadeu Vives gegründeten Chor-Gemeinschaft mit Sitz in Barcelonas Palau de la Música Catalana, noch heute der berühmteste Chor Kataloniens. Orfeó Català war als Tribut an Josep Anselm Clave (1824-74) ins Leben gerufen worden, Chorleiter, Komponist und Poet sowie katalanisch-nationalistischer Politiker. Clave, dessen Name einem noch heute in vielen Orten Kataloniens auf Straßenschildern begegnet, hatte die Chormusik der Arbeiterschaft nähergebracht.
Die Chor-Gemeinschaft spielte beim Revival der katalanischen Kultur eine bedeutende Rolle, aber die Benutzung der katalanischen Sprache ist unter dem Militärregime verboten. Die Militärs erlauben die Begegnung, verbieten aber die Spende an Orfeó. Arthur und Ernest Witty haben eine Kapelle der britischen Royal Marines engagiert, die zu diesem Zeitpunkt im Hafen von Barcelona liegen. Nicht wissend, auf welch einem politischen und kulturellen Minenfeld sie sich bewegen, spielen die Musiker vor dem Anpfiff die spanische Nationalhymne, was das Barça-Publikum mit einem gellenden Pfeifkonzert quittiert. Daraufhin wechselt man mitten im Lied zur englischen Nationalhymne über – und das Publikum applaudiert.
Die Militärs, im Stadion vertreten durch den Generaloberst Milans del Bosch, spanischer Befehlshaber für Katalonien, fühlen sich brüskiert. Primo de Rivera lässt das Stadion des FC Barcelona für sechs Monate schließen. Auch der Orfeó Català darf eine Zeitlang nicht öffentlich auftreten.
Barça-Präsident Joan Gamper wird von den Machthabern „nahegelegt“, mit Rücksicht auf seine körperliche Unversehrtheit das Land für einige Zeit zu verlassen, was er dann auch für sechs Monate tut. Gamper legt sein Amt als Barça-Präsident nieder und formuliert in seiner Rücktrittserklärung, der FC Barcelona habe niemals aufgehört, sich „getreu der Situation nur an sportlichen Zielen zu orientieren“. Die gegenwärtige Situation entspräche nur dem Wunsch, „ein patriotisches Ziel zu erreichen“.
Im Exil kann sich Gamper nicht mehr ausreichend um seine Geschäfte kümmern, außerdem leidet er unter Depressionen. Gamper ist ein gebrochener Mann, der sein Lebenswerk FC Barcelona zerstört sieht. Zwar darf er nach Barcelona zurückkehren, aber nur unter der Bedingung, keinen Kontakt zum Klub zu unterhalten. Manuel Tomás: „Dieses Abseitsstellen konnte er kaum ertragen, und er fiel in eine schwere Depression.“
Der FC Barcelona verliert auch Arthur Witty, den die Politisierung des FC Barcelona stört. Witty bleibt zwar Barça-Fan, geht aber mehr und mehr auf Distanz zum Klub und widmet sich vornehmlich seinen Geschäften. Gemeinsam mit seinem Sohn Frederick sorgt er dafür, dass in den 1930ern Unternehmen wie Cadbury, Johnnie Walker, Unilever und Bovril den spanischen Markt betreten.
Gampers Freitod
In den neun Spielzeiten 1923/24 bis 1931/32 heißt Kataloniens Meister achtmal FC Barcelona. Der Copa del Rey wird 1925, 1926 und 1928 gewonnen. 1928 bedarf es hierzu gleich dreier Spiele. Zweimal trennen sich Barça und der baskische Klub Real Sociedad San Sebastián unentschieden, die dritte Auflage gewinnt Barça in Santander mit 3:1. Beim ersten Aufeinandertreffen mit Real Sociedad heißt Barças Bester in einem brutalen Spiel Ferenc Platko. Der ungarische Keeper hatte 1923 die Nachfolge von Ricardo Zamora im Tor des FC Barcelona angetreten. Der anwesende Dichter Rafael Alberti ist von Platkos Heldentaten so hingerissen, dass er ihm anschließend eine „Oda A Platko“ widmet.
1926 legalisiert Spanien den Professionalismus. Josep Samitier und Ricardo Zamora sind die ersten Großverdiener im spanischen Fußball. Mit der Saison 1928/29 wird zudem eine nationale Liga eingeführt, die Primera División. Bis dahin hat jede spanische Provinz oder Region ihre eigene Liga und Meisterschaft wie den Campeonato de Catalunya oder den Campeonato Centro in Madrid und Umgebung. Diese regionalen Meisterschaften besaßen eine enorme Bedeutung, denn die jeweiligen Champions qualifizierten sich für den Copa del Rey, der somit zunächst eine Mischung aus Meisterschaft und Pokal war, ähnlich der Deutschen Fußballmeisterschaft vor Einführung der Bundesliga.
Erster Meister der Primera División wird der FC Barcelona, dank einer starken Rückrunde, in der sich Barça nur gegen die Lokalrivalen Europa Barcelona und Español mit einem Remis begnügen muss, und nicht zuletzt dank Samitier. Der Vorsprung auf Vizemeister Real Madrid beträgt zwei Punkte. Die Meisterschaft von 1929 wird Barças letzte bis 1945 bleiben.
Ebenfalls 1929 ist Barcelona zum zweiten Mal nach 1888 Schauplatz der Weltausstellung. Im Vorfeld wird die Stadt erneut und nicht zum letzten Mal umgebaut. Zahlreiche öffentliche Projekte werden angepackt, so der Bau der ersten U-Bahn-Strecke zwischen Plaça Catalunya und Plaça d’Espanya. Der Stadtberg, der Montjuic, wird erschlossen, wozu auch der Bau eines neuen Stadions gehört, und der Placa d’Espanya erneuert. Es entstehen eine Reihe von Gebäuden im Stil der katalanisch-neoklassizistischen Bewegung Noucentisme. Der deutsche Pavillon von Mies van der Rohe (Bauhaus) kündigt einen internationalen Trend zum Rationalismus an.
Die rege Bautätigkeit treibt jährlich über 30.000 Zuwanderer in die katalanische Metropole, die den Baufirmen als billige Arbeitskräfte dienen. Gab einst die Textilindustrie in Katalonien den Ton an, so treten nun die Produktion von Stahl und die Kaligewinnung mit ausländischer Kapitalmehrheit in den Vordergrund.
Zur Eröffnung des neuen Stadions auf dem Montjuic empfängt eine Fußballauswahl Kataloniens am 20. Mai 1929 die Bolton Wanderers, die als frischgebackener FA-Cup-Gewinner nach Barcelona kommen. Die Katalanen überfahren die Engländer mit 4:0. Unter den 70.000 Zuschauern befindet sich auch Walther Bensemann, der deutsche Fußballpionier und Begründer des Kicker, der anschließend vor allem von einem Spieler schwärmt: „Der beste Mann auf dem Platz, vielleicht zugleich mit dem ewig jungen Samitier und dem englischen Linksaußen, war der in Barcelona ansässige Emil Walter aus Brötzingen bei Pforzheim, ein ebenso guter Fußballer wie patenter Mensch. Nichts hat mich in Barcelona so gefreut, als bei diesem Spiel einen Landsmann in so angenehmer Rolle wirken zu sehen.“
Am 28. Januar 1930 sieht sich Primo de Rivera zum Rücktritt gezwungen. Das Regime versucht damit einer Eskalation der Unruhen und der Entwicklung zum offenen Aufstand zuvorzukommen. Politischer Druck und internationale Finanzkrise haben den Zusammenbruch der Diktatur beschleunigt. De Riveras Nachfolger wird General Brenguer. Die Militärdiktatur hat auch die Monarchie diskreditiert. In Katalonien breitet sich eine Protestbewegung gegen den König aus. Zu den sozialen Spannungen im Land gesellt sich auch der Gegensatz zwischen Katalonien und dem Rest Spaniens.
Am 30. Juni 1930 erschießt sich Hans „Joan“ Gamper in seinem Haus in der Carrer de Girona Nr. 4 in Barcelona. Beim Börsencrash von 1929 hat der Kaufmann sein gesamtes Vermögen verloren. Tausende folgen seinem Sarg. Im Kicker formuliert Walther Bensemann, der Gamper persönlich kannte, folgenden Nachruf: „Einem jeden, der heute über internationalen Sport schreibt, wird ein Name in Erinnerung kommen und damit tiefer Schmerz, dass einer der ganz Großen von uns genommen ist. Ich rede von Hans Gamper, der aus Zürich stammte, von dort nach Spanien ging und in Barcelona den Fußballsport einführte. (…) Der Verlust dieses gebornen Sportführers ist schwer, der Verlust des Menschen unersetzlich. Seine Verdienste um den spanischen Rasen- und Wassersport waren immens; kein großer europäischer Fußball-Club existiert, der nicht Gampers Gastfreundschaft in Barcelona genossen hätte. Zumal während der Inflationszeit hat dieser weitblickende Mann unzählige Vereine des Auslandes auf Jahre hinaus saniert. Wochenlang konnten sich die ausgehungerten Spieler an den catalonischen Fleischtöpfen sättigen, um dann ihren ausgepoverten Klubs Zehntausende von Peseten heimzubringen. Wer von Barcelona zurückkehrte, lobte den idealen Führer, der bei allen Verhandlungen stets großzügig blieb, alle Streitigkeiten schlichtete und allen Verdruss einsteckte. Kam eine Mannschaft um 5 Uhr morgens in Barcelona an, war er an der Bahn; fuhr sie um Mitternacht weg, sah man die riesige Gestalt aus der Bahnhofshalle heraus zum Abschied winken. Seine Freigebigkeit war sprichwörtlich; sowie einer, der mit ihm am Tisch saß, zahlen wollte, kam die typische abwehrende Handbewegung mit dem typischen ‚dumm’s Züg!‘. Von allen Pionieren der Bewegung, die ich gekannt habe, war er der beste, vornehmste, beliebteste, bescheidenste. Er besaß die große Gabe, andere Menschen wie ein Kind bewundern zu können, und wenn er erzählte, wie sein Freund Hans Enderli als 15-jähriger Bub in den politischen Versammlungen Zürcher Bürger über Sport und andere Dinge gesprochen hatte, dann leuchteten seine Augen. Er war das, was Horaz eine anima candida genannt hat.“