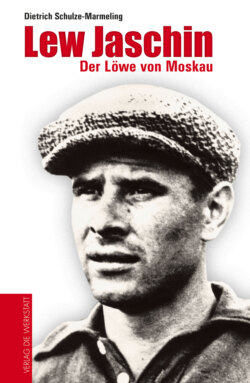Читать книгу Lew Jaschin - Dietrich Schulze-Marmeling - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKAPITEL 1
Russischer und sowjetischer Fußball vor Lew Jaschin
Lew Jaschin verbrachte seine Zeit als Vereinsfußballer komplett bei Dynamo Moskau, dem Klub des Geheimdienstes bzw. des Innenministeriums und bis in die 1970er Jahre einer der führenden Vereine des Landes. In Russland bzw. der Sowjetunion wurde die Entwicklung des Fußballs durch die Abfolge von Krieg, Revolution und Bürgerkrieg lange Zeit gebremst. Ligen besaßen zunächst nur lokalen Charakter, erst 1936 wurde eine nationale Liga gegründet. Erste Meister waren Dynamo und der Lokalrivale Spartak. Die Dynamik des sowjetischen Fußballs wurde nun vom Antagonismus zwischen diesen beiden Klubs angetrieben. Geheimdienstchef und Dynamo-Boss Lawrenti Beria versuchte dabei, das populärere Spartak auch mithilfe von Repression vom Thron zu stoßen.
Ende der 1930er / Anfang der 1940er sorgte Dynamo-Trainer Boris Arkadiew für eine taktische Modernisierung des sowjetischen Fußballs. Im September 1945 war Dynamo das erste sowjetische Team, das auf westeuropäischem Boden spielte. Eine Tour durch Großbritannien hinterließ auch im Westen nachhaltigen Eindruck. Star der Dynamo-Expedition war ihr Torhüter Alexander Khomich, später ein Mentor des jungen Lew Jaschin.
Britische Anfänge
Auch in Russland waren es Briten, die den Fußball ins Land brachten. In den 1860ern traten britische Seeleute im Hafen von Odessa vor den Ball. Zum Zentrum fußballerischer Aktivitäten avancierte bald St. Petersburg, wo das Fußballteam des 1888 gegründeten „Sankt Petersburger Kreises der Amateursportler“ regelmäßig gegen die Besatzungen englischer Schiffe antrat.
1890 wurde in Moskau eine Liga der Fabrikvereine gegründet, doch die erste richtige Fußballliga Russlands konnte St. Petersburg für sich reklamieren. 1901 wurde hier die St. Petersburg Football League aus der Taufe gehoben, die zunächst von Teams dominiert wurde, die Engländer und andere ausländische Bürger gegründet hatten. 1908 konnte erstmals ein russisches Team den Titel gewinnen. Ein Jahr später verließen einige starke Ausländerteams die Football League und gründeten eine eigene Liga, die „Russische Gesellschaft der Amateurfußballer“. Diese spielte ab 1910 um einen Pokal, den der britische Botschafter Alan Nicholson gestiftet hatte. 1911 kam es zur Wiedervereinigung der beiden Ligen, aber die Teams der Ausländer hatten sportlich den Anschluss verloren und zogen sich bald ganz vom Spielbetrieb zurück. Der russisch-englische Spielverkehr, der für die damalige Zeit viele Zuschauer mobilisierte, war damit beendet.
1911 startete auch eine gesamtrussische Liga, in der aber nur Stadtauswahlmannschaften spielten und die nur kurzlebig war. 1913 bekam auch Moskau eine eigene Stadtliga, die von 25 Klubs gebildet wurde. In der St. Petersburger Liga spielten zu dieser Zeit 23 Mannschaften.
Erste Länderspiele
1912 war mit dem Rossijski Fotbolny Sojus (RFS) ein nationaler Dachverband gegründet worden. Ebenfalls 1912 bestritt Russland beim olympischen Fußballturnier in Stockholm seine ersten Länderspiele. Die Ergebnisse waren ernüchternd. Gegen Finnland, das damals noch zum russischen Kaiserreich gehörte, verlor man am 30. Juni 1912 mit 1:2. Gegen Deutschland kassierte man einen Tag später eine 0:16-Klatsche, bei der der deutsche Stürmer Gottfried Fuchs mit zehn Toren einen noch heute gültigen Rekord aufstellte. Allerdings bestand die russische Elf vornehmlich aus Leichtathleten. Der Ball war nicht ihr Freund. Außerdem hatten beide Teams am Vorabend gemeinsam gesoffen – die Russen offensichtlich etwas mehr als die Deutschen.
Anschließend wurde es erst einmal nicht besser. Im Juli 1912 unterlag Russland Ungarn in Moskau mit 0:9 und 0:12. Allerdings gehörten die Ungarn bereits zu den besten Teams auf dem Kontinent und hatten zuvor auch Frankreich, Italien, Deutschland und Österreich geschlagen. In Imre Schlosser und Vilmos Kertesz besaßen sie bereits Starspieler von internationalem Ruf, die gegen die Russen 13 der 21 Tore schossen. Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs spielte die russische Nationalelf noch viermal. Einer 1:4-Heimniederlage im Mai 1913 gegen Schweden folgten drei Remis. Von Norwegen trennte man sich in Moskau und Oslo jeweils 1:1, von Schweden in Stockholm 2:2.
Revolution kontra Fußball
Anschließend ruhte der Spielbetrieb der Nationalelf für gut zehn Jahre, bedingt durch den Ersten Weltkrieg, die Revolution und den anschließenden Bürgerkrieg.
Im Februar 1917 mündete eine Demonstrations- und Streikwelle in der Entmachtung der zaristischen Führung Russlands. Auf die Februarrevolution folgten die von Lenin initiierte Oktoberrevolution der Bolschewiki und die Ausrufung der „Russischen Sowjetrepublik“. Der folgende Bürgerkrieg, den Lenins kommunistische Bolschewiken und ihre Rote Armee gegen Konservative, Reaktionäre, Demokraten, gemäßigte Nationalisten und die Weiße Armee ausfochten, zog sich bis 1921 hin. Robert Edelmann, Professor für russische Geschichte und Geschichte des Sports an der Universität of California in San Diego: „Der Bürgerkrieg war begleitet von Hunger, Seuchen, Chaos und Entvölkerung der Städte. Das spielerische Vergnügen eines so spontanen Spiels wie Fußball passte schlecht zu den Erfordernissen des bedrohten neuen Regimes. Die bestehenden Vereine und anderen Institutionen, die sich mit Fußball befasst hatten, wurden alleine gelassen. (…) Die Ausländerkolonie verflüchtigte sich, was die Verbindung zum Mutterland des Fußballs, Großbritannien, unterbrach.“
Der Bürgerkrieg endete mit einem Sieg der Bolschewiken. Am 31. Dezember 1922 wurden große Teile des auseinandergefallenen Russischen Reiches als Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, kurz UdSSR, wiedervereint.
Das kommunistische Regime hatte den Charakter einer „Entwicklungsdiktatur“ und betrieb nun eine zentral gesteuerte nachholende Industrialisierung des Landes. Innerhalb von 20 Jahren wollte man die vielerorts noch mittelalterlichen, feudalen Produktionsverhältnisse beseitigen und das rückständige Land in eine industrielle Großmacht verwandeln.
Am 21. Januar 1924 starb Revolutionsführer Lenin. Kurz vor seinem Tod hatte er vor Stalin gewarnt: „Genosse Stalin hat dadurch, dass er Generalsekretär geworden ist, eine unermessliche Macht in seinen Händen konzentriert, und ich bin nicht überzeugt, dass er es immer verstehen wird, von dieser Macht vorsichtig Gebrauch zu machen. (…) Stalin ist zu grob.“ Doch Stalin gewann den Kampf um Lenins Nachfolge, und an die Stelle der Diktatur einer Partei trat nun die Diktatur einer Person. 1928 begann die Zwangskollektivierung der Landwirtschaft, die ohne Rücksicht auf Menschenleben betrieben wurde und allein in der Ukraine 3,5 Millionen Todesopfer forderte.
Die Kommunisten standen dem Sport und dem Fußball zunächst skeptisch bis ablehnend gegenüber. Ihre Argumente waren teilweise deckungsgleich mit denen konservativer Turnideologen in Deutschland, die die englische Herkunft des Spiels und seinen mit der kapitalistischen Leistungsgesellschaft kompatiblen „übertriebenen“ Wettkampfcharakter ablehnten. Aber es gab auch wesentliche Unterschiede. Die Linken betrachteten Leibesübungen im Kontext mit Maßnahmen zur Verbesserung der sozialen Lage der Massen. Die Rechten sahen sie vor allem im Kontext mit der „Wehrhaftmachung“ des Volkes. Jim Riordan, ein 2012 verstorbener englischer Schriftsteller und Sporthistoriker, Verfasser vieler wissenschaftlicher Arbeiten zum sowjetischen Sport: „Der sportliche Wettkampf, so meinten nun viele Kommunisten, desavouiere die ‚ewigen Ideale’ der Leibesübungen. Statt den Körper umfassend zu bilden, führe er zur ungesunden Spezialisierung; er begünstige Krämergeist, Habgier und Sittenverfall, und statt die Massen zur aktiven Erholung zu führen, wie es ein sozialistisches Grundziel forderte, dränge er sie in die Rolle passiver Zuschauer.“
Aber Fußball entwickelte sich zu einer „dermaßen attraktiven Unterhaltung, dass er in den 20er Jahren schließlich ein Bestandteil der kommerzialisierten Freizeitkultur wurde“ (Robert Edelmann). Bereits Ende der 1920er florierte ein informeller Professionalismus mit Spielertransfers und lukrativen Schaukämpfen.
Weltfußball ohne Sowjets
Nach der Gründung der UdSSR kam es zu heftigen Verstimmungen zwischen der FIFA und dem neuen Staat, der nicht Mitglied des Weltverbandes war. Die FIFA verbot ihren Mitgliedsländern Spiele gegen die UdSSR. Das einzige FIFA-Mitglied, das sich dem widersetzte, war die Türkei. Am 16. November 1924 empfing die sowjetische Nationalmannschaft in Moskau die Türkei zum ersten Nachkriegsländerspiel. Die Sbornaja, wie die sowjetische Nationalelf genannt wurde, gewann glatt mit 3:0.
Zwischen der Sowjetunion und der Türkei existierten besondere Beziehungen. Im März 1921 hatte die UdSSR mit der in Ankara ansässigen nationalen türkischen Regierung ein Friedens- und Freundschaftsabkommen unterzeichnet. Es war der erste international ratifizierte Vertrag eines Staates mit der antiimperialistischen Widerstandsbewegung von Mustafa Kemal Pascha (ab 1934 Mustafa Kemal Atatürk), die am 29. Oktober 1923 die Republik ausrief.
Im Mai 1925 tourte eine sowjetische Auswahl durch die Türkei. Am 15. Mai 1925 besiegte die UdSSR die Türkei in Ankara mit 2:1.
Aber die Sbornaja kickte nicht nur gegen die offizielle Nationalmannschaft, sondern auch gegen Teams der türkischen Arbeitersportverbände. Die FIFA verdächtigte die UdSSR, den Ausbau ihrer 1921 gegründeten Roten Sportinternationale (RSI) zu betreiben und Arbeitersportorganisationen anderer Länder zum Austritt aus den neutralen Verbänden zu bewegen. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, spielten die Sowjets nun nur noch gegen politisch befreundete Teams der internationalen Arbeitersportbewegung – so u. a. 1927 zweimal gegen Mannschaften des deutschen Arbeiter-Turn- und Sportbundes (ATSB). Zwischen 20.000 und 30.000 Zuschauer wollten jeweils in Leipzig und Hamburg die Sbornaja sehen. Beide Begegnungen, die als „Russenspiele“ in die Annalen eingingen, endeten mit klaren Siegen – 8:2 und 4:1 – für die Sowjets.
Fußball-Ballett
Ende der 1920er begann die kommunistische Partei ihre kritische bis ablehnende Haltung zum Sport und zum Fußball zu überdenken. Zu groß war die Begeisterung für das Spiel, das bis zu 70.000 Menschen in die Stadien lockte. Allerdings waren Stalin-Porträts am Eingang der Stadien Pflicht.
Vor allem Mannschaftsportarten wurden nun gefördert. „Es entstand ein gesellschaftliches Subsystem der Fußball-Ligen, Stadien, Pokale, Meisterschaften, der Paraden und Festzüge, der Beliebtheitswahlen und des Heldenkults. All dies sollte ein Gemeinschaftsgefühl des Sowjetmenschen erzeugen und dem Ausland demonstrieren, wie glücklich und sorgenfrei es sich ‚unter der Sonne der stalinistischen Verfassung‘ (so ein Slogan von 1936) leben ließ. Wichtige Fußballspiele wurden nun vorzugsweise auf politische Feiertage gelegt (1. Mai, Tag der Verfassung, Jahrestag der Oktoberrevolution). Auf diese Weise sollte die Öffentlichkeit mit der Regierung, der Partei und natürlich mit Stalin selbst versöhnt werden, mit dessen Porträt auch im Sport Kult getrieben wurde.“ (Jim Riordan)
Auch der Fußballer änderte sich: „Gegen Ende der 1920er hatten (…) viele ‚Gentlemen-Amateure‘, wie auch jene Ausländer (Briten, Franzosen, Deutsche usw.), die die Revolution überlebt und weiterhin Fußball gespielt hatten, ihre aktive Laufbahn beendet. Die neuen Spieler kamen fast durchweg aus der Industriearbeiterschaft.“ (Riordan)
Der Komponist und der Ball
Ein glühender Fan des Spiels war der Pianist und Komponist Dimitri Schostakowitsch, der aus einer bürgerlich-liberalen Familie stammte. Die Eltern engagierten sich für die Bewegung der Narodniki, die für die Befreiung der Bauern kämpfte. Die Bemühungen der Narodniki, den Bauern Schulbildung zu vermitteln, stieß auf den heftigen Widerstand der orthodoxen Kirche.
Dimitri Schostakowitsch ließ kaum ein Spiel seines Klubs Zenit St. Petersburg aus. Die Publizistin, Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin Katja Petrowskaja, 2013 Gewinnerin des Ingeborg-Bachmann-Preises, hat sich eingehender mit Schostakowitschs Fußballleidenschaft beschäftigt: „Es gibt eine Reihe von Fotos, wo Schostakowitsch am Fußballfeld sitzt. Er ist wie ein Kind, die Augen leuchten. Man hat wirklich das Gefühl, dass sich Schostakowitsch im Fußballstadion ausgetobt hat. Er fuhr buchstäblich zu fast allen Spielen. Nicht nur die in Leningrad stattfanden, sondern auch in Moskau. Ein paar Mal kam er nach Tblissi, um Spiele seiner Lieblingsmannschaft zu sehen.“ Als seine Frau mal auf Reisen war, nutzte er die Sturmfreiheit, um die Mannschaft von Zenit zum Abendessen einzuladen und mit einem Privatkonzert zu beehren.
1929 erhielt Schostakowitsch, der sein Leben lang die Rolle des führenden sowjetischen Komponisten spielte, den Auftrag, die Musik für ein Fußball-Ballett zu schreiben. Schostakowitsch-Biograf Krzysztof Meyer: „Man rechnete damit, dass Schostakowitsch an dem sportlichen Thema der Handlung Gefallen finden würde. Er war in der Tat über den prestigeträchtigen Auftrag sehr erfreut, aber das primitive und naive Libretto dämpfte seine Begeisterung. (…) Zunächst wehrte sich Schostakowitsch gegen ein solches Libretto, aber nachdem ihm Nikolai Smolitsch und Iwan Sollertinski gut zugeredet hatten, gab er nach und machte sich an die Arbeit.“ (Smolitsch war Regisseur, Sollertinski Wissenschaftler und Kulturpolitiker und als solcher maßgeblich am Aufbau eines sowjetischen Musiklebens beteiligt.) Das Stück spielt in einer nicht näher definierten Stadt Westeuropas, in der eine Industrieausstellung mit dem Namen „Das goldene Zeitalter“ – so auch der Titel des Balletts – stattfindet. Im Zentrum des Geschehens stehen zwei Fußballmannschaften – eine westliche (faschistische) und eine sowjetische (sozialistische). Für das Spiel der kapitalistischen Kicker wählte Schostakowitsch Musik und Tanz aus der westlichen Kultur (Foxtrott und Can-Can), der sozialistische Gegner spielte zu Klängen aus der slawischen. Das sowjetische Team gewinnt natürlich. Das Finale bildet ein Solidaritätstanz der sowjetischen Sportler mit westlichen Arbeitern.*
Das Spiel wurde zunehmend ideologisiert. Sowjetunion-Experte Thomas Heidbrink schreibt: „Spätestens mit Beginn der 1930er Jahre versuchte die sowjetische Regierung, die Prinzipien des Sozialismus auch im Fußballsport umzusetzen. Besonders mit Hilfe des Kollektivismus sollte ein Spielsystem entwickelt werden, das genauso gut beziehungsweise besser sein sollte als das der westlichen Teams aus den kapitalistischen Ländern.“ Aufgrund der Isolation und Selbstisolation der UdSSR gestaltete sich dies aber schwierig.
1934 reiste eine Stadtauswahl Moskaus auf Einladung der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei nach Prag, um gegen Teams der Roten Sportinternationale anzutreten. Die Sowjets liebäugelten auch mit einem Spiel gegen eines der Prager Profiteams, Slavia oder Sparta, und besaßen hierfür die Zusage des tschechoslowakischen Verbands. Doch nach sechs hohen Siegen der Moskauer Stadtauswahl gegen Gewerkschaftsteams zog der Verband mit der Begründung zurück, die UdSSR sei kein Mitglied der FIFA. Offensichtlich fürchtete man die Stärke der Fußballer aus Moskau, denn die FIFA hatte dem Verband für diese Begegnung eine Ausnahmegenehmigung erteilt. Die Stadtauswahl spielte nun stattdessen in Brünn, wo sie im ersten Spiel einer sowjetischen Mannschaft gegen ein (tschechoslowakisches) Profiteam mit 3:2 die Oberhand behielt.
Spartak und Dynamo
1922 gründete Nikolai Starostin den Moskowski kruschok sporta Krasnopresnenskowo rajona, kurz MKS. Das Team wurde nach einem Arbeiterviertel benannt. Starostin war in der Zwischenkriegszeit einer der besten Fußballer in der Sowjetunion und hatte u. a. bei den „Russenspielen“ in Leipzig und Hamburg mitgewirkt. Im folgenden Jahr, am 18. April 1923, wurde Dynamo Moskau aus der Taufe gehoben, wo später Lew Jaschin seine komplette Spielerkarriere verbrachte. Die Keimzelle des Klubs war eine 1894 entstandene Mannschaft der Morosow-Textilfabrik. Deren englischer Generaldirektor Harry Charnock stammte aus Blackburn, einem weltweiten Zentrum der Baumwollspinnerei. Charnock sah im Fußball eine Möglichkeit, seine Arbeiter vom Wodkatrinken abzuhalten. Der fußballverrückte Engländer war ein Fan seines Heimatvereins Blackburn Rovers. Von den Rovers übernahm das Team die Farben Blau und Weiß, die auch die Farben Dynamos wurden.
Dynamos Gründung erfolgte auf Geheiß von Felix Edmundowitsch Dserschinski, dem Chef der Tscheka, der ersten Geheimpolizei Sowjetrusslands. Dynamo war keine Fabrik- oder Stadtteilmannschaft, sondern eine Gründung „von oben“. Die Geheimpolizei übernahm auch die Schirmherrschaft über den Klub. (Später ging diese auf das Innenministerium über.) Dynamo Moskau war Teil einer landesweiten Dynamo-Sportorganisation, die sich nicht nur dem Fußball widmete und dazu gedacht war, die physische Gesundheit der nationalen Ordnungskräfte zu stärken. Dynamo-Klubs gab es deshalb auch andernorts. „Bis zum Ende des Jahrzehnts sollte Dynamo der am besten ausgestattete Sportverein der Sowjetunion werden, und seine Unterstützung durch den Staatshaushalt war substanzieller als für jede andere sportliche Vereinigung.“ (Robert Edelmann) Die Verbindung Dynamos mit den Sicherheitsbehörden des Landes blieb über die gesamte Lebensdauer der Sowjetunion erhalten.*
1928 wurde nordöstlich der Innenstadt, am Leningradski Prospekt, einer der Hauptverkehrsadern Moskaus, das Dynamo-Stadion eröffnet. Anlass war die von der RSI veranstaltete internationale Spartakiade, ein Konkurrenzprojekt sowohl zu den „bürgerlichen“ Olympischen Spielen wie zu den Arbeiterolympiaden der sozialdemokratischen Luzerner Sportinternationalen (LSI). Das größte Interesse mobilisierte der Fußballwettbewerb der Spartakiade, der sowohl eine Endrunde um die sowjetische Meisterschaft als auch ein internationales Turnier war. Die neue Arena trug dazu bei, dass sich der Fußball in Moskau zu einem Zuschauersport entwickelte. Das Dynamo-Stadion konnte zunächst 55.000 Zuschauer aufnehmen – 35.000 saßen, 20.000 standen. Mit der Zeit wurde das Fassungsvermögen auf 90.000 ausgebaut. Die Spielstätte avancierte zum Nationalstadion der UdSSR, in dem auch viele wichtige Länderspiele angepfiffen wurden. In den 1940ern und 1950ern war die Arena, die eine eigene Metro-Station („Dynamo“) bekam, regelmäßig Austragungsort der Endrunde um die sowjetische Eishockeymeisterschaft.
1936 wurde aus MKS Spartak Moskau. Auch Nikolai Starostins Brüder Alexander, Petr und Andrei spielten für den Klub, dessen Farben Rot und Weiß waren. Nikolai Starostin wollte mit Spartak ein Gegengewicht zu Dynamo aufbauen. Spartak genoss die Unterstützung der Promkooperatsija, einer gewerkschaftlichen Organisation der Angestellten im Dienstleistungs- und Handelssektor, die im Handelsministerium angesiedelt war. Laut Starostin gingen 15 Prozent ihrer Einnahmen an Spartak.
Liga und Professionalisierung
Spartak war ambitioniert und suchte das Kräftemessen mit ausländischen Gegnern. Ende 1935 fuhr eine Kombination aus Spielern von Spartak und des Lokalrivalen Dynamo nach Paris, wo sie am Neujahrstag 1936 gegen den renommierten Racing Club de Paris spielte und mit 1:2 unterlag. Zurück in Moskau, forderte Starostin eine radikale Neustrukturierung des sowjetischen Fußballs, den Professionalismus inbegriffen: „In den letzten zwei oder drei Jahren hat der sowjetische Fußball gezeigt, daß er auf derselben Ebene mit den besten europäischen Mannschaften steht. (…) Gleichzeitig zeigt uns eine bessere Bekanntschaft mit den Arbeitsbedingungen für ausländische Berufsfußballer – und sämtliche der besten Mannschaften in Europa bestehen aus Berufsfußballern –, daß der Berufsfußball eine Reihe von Vorteilen gegenüber den Amateuren hat.“
Nikolai Starostin gehörte auch zu den Vätern der 1936 gegründeten sowjetischen Fußballliga. Thomas Heidbrink: „Sportpolitisch sollte die sowjetische Liga zu einem neuen völkerverbindenden Element innerhalb des Vielvölkerstaates UdSSR heranreifen.“ Manfred Zeller, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Forschungsstelle Osteuropa der Universität Bremen, weist darauf hin, dass im Fußball anders verfahren wurde als im Eishockey, der zweiten populären Sportart in der Sowjetunion: „Speziell in den 1960er und 1970er Jahren war die Situation im Fußball eine andere als im Eishockey. Während der sowjetische Sport im Eishockey alle Mittel in Moskau konzentriert hat, ist dies im Fußball dezentraler vonstattengegangen. Alle großen Republiken bzw. deren Hauptstädte sollten mit einer Mannschaft in der höchsten sowjetischen Liga vertreten sein, sodass auf der Ebene darunter, beispielweise von den Parteioder Staatsoffiziellen in Kiew, in Eriwan oder in Tiflis, die Mittel einem bestimmten Klub zugewiesen wurden.“
Die politischen Vorbehalte gegenüber einem professionell betriebenen Spitzenfußball schwanden. Die Gründung der Liga korrespondierte mit einem politischen Kurswechsel gegen Ende des ersten Fünfjahresplanes (1928–33). „Stalin (hatte) sich scharf von sozialer Gleichmacherei und Lohngleichheit verabschiedet. Er hatte realisiert, dass die Fähigkeiten und Fertigkeiten der so genannten Spezialisten, die vor der Revolution ausgebildet worden waren, für zukünftige Fortschritte unabdingbar waren. Menschen mit diesen Begabungen erwarteten, angemessen entlohnt zu werden. Das Ziel der sozialen Gleichheit der vorrevolutionären Linken wurde aufgegeben zugunsten sozialer Hierarchie. Die Führung war nun der Auffassung, dass das momentan ‚bessere und fröhlichere‘ Leben professioneller Unterhaltung bedurfte, die rund um die Welt junge Arbeiter begeisterte. Fußball war der moderne Sport par excellence. Er schuf eine gemeinsame Sprache für die männlichen Angehörigen des höchst disparaten neuen sowjetischen Proletariats. Fußball stellte eine neue Form von Männerbund dar, nicht zuletzt für die vielen jungen Bauern, die in die Städte gezogen waren und traditionellere Formen von Maskulinität hinter sich gelassen hatten – ein ‚männliches‘ Spiel für den ‚Neuen sowjetischen Menschen‘.“ (Robert Edelmann)
Sowjetische Profis
Im Gründungsjahr der Liga wurden noch zwei Meisterschaften ausgespielt, eine Frühjahrs- und eine Herbstmeisterschaft. Erster Meister wurde Dynamo Moskau, die Herbstmeisterschaft gewann Rivale Spartak. Anschließend wurde auf eine Ganzjahresmeisterschaft umgestellt.
Offiziell waren die sowjetischen Fußballer keine Profis, denn dies hätte der offiziellen Sportideologie widersprochen. Profifußball war kapitalistisch, Amateurismus folglich ein antikapitalistisches Prinzip. (Die Arbeitersportorganisationen im Westen sahen dies ebenso, weshalb im Deutschland der Weimarer Jahre einige ihrer Spitzenfußballer ins Lager des „bürgerlichen Fußballs“ überliefen.) Aber de facto waren die Spieler von Spartak, Dynamo und anderen Klubs sehr wohl Berufsfußballer. Starostin und seine Brüder sollen monatlich 2.000 Rubel kassiert haben, was in etwa dem Zehnfachen eines durchschnittlichen Industriearbeitergehalts entsprach. Alle Teams waren mit Unternehmen oder Behörden assoziiert. „Entgegen der offiziellen Sportideologie, die den Amateurismus zum antikapitalistischen Prinzip erklärte, waren sie formell Angestellte großer Betriebe, des Militärs und der Behörden, faktisch jedoch Berufsspieler.“ (Riordan) Dynamo-Sportler wie Lew Jaschin waren formell Beschäftigte des Innenministeriums und bezogen ein entsprechendes Gehalt.
Bereits vor der Gründung der Liga war das Zuschauerinteresse an Fußballspielen stark gestiegen. Die neue Liga verursachte einen weiteren Popularitätsschub. Drei Jahre nach ihrer Gründung kamen im Schnitt 19.000 Zuschauer zu den Begegnungen. Die Zentren bildeten Moskau, Odessa, Leningrad, Kiew und Tiflis. Schon Mitte der 1930er besaßen fast alle größeren Städte der UdSSR Stadien, in denen mindestens 20.000 Zuschauer Platz fanden.
In der sowjetischen Hauptstadt mobilisierte insbesondere die Rivalität zwischen Spartak und Dynamo große Massen. „Die führenden Moskauer Vereine Spartak und Dynamo standen an der Spitze dieser Entwicklung, durch welche sich Fußball als massenkulturelles Phänomen dem Kino annäherte.“ (Robert Edelmann). Selbst das große Dynamo-Stadion konnte häufig nicht das Interesse am Derby zwischen Moskaus „großen zwei“ decken.
Fußball auf dem Roten Platz
1936 wollten Spartak und Dynamo am „Tag des Sportlers“ auf dem Roten Platz einen Schaukampf veranstalten – vor den Augen des Diktators Josef Stalin. Fußball stand bei Stalin nicht hoch im Kurs. Aber vielleicht könnte man mit einem Spiel sein Interesse wecken. Wenn der Diktator nicht zum Spiel kam, musste das Spiel zum Diktator kommen. Auf dem Roten Platz wurde ein 9.000 Quadratmeter großer grüner Filzteppich ausgerollt. Aber Dynamo sagte ab. Die Geheimpolizei befürchtete, der Ball könnte die Kremlmauern oder sogar Stalin treffen. So spielte Spartaks 1. Mannschaft gegen die Spartak-Reserve. Der Journalist Simon Kuper: „Man ging davon aus, dass dies das erste Spiel sei, das ‚Der Größte Freund des Sports‘ je gesehen hatte, und das Ziel war, eine großartige Vorstellung abzuliefern. Die Mannschaften hatten ein Feuerwerk an verschiedenen Toren geplant – Kopfballtore, Hackentricks, ein Tor nach einem Eckstoß, durch einen Strafstoß et cetera.“ Spartak I schlug Spartak II mit 4:3, aber das Ergebnis war nur Nebensache. Wichtiger war, dass Stalin das Spiel offensichtlich gefallen hatte. Um den Diktator nicht zu langweilen, war als Spielzeit zunächst nur eine halbe Stunde geplant. Neben Stalin war ein Funktionär postiert, der den Mannschaften mit einem weißen Taschentuch winken sollte, wenn dem Chef die Lust am Zuschauen verging. Aber Stalin gefiel das Gekicke so gut, dass er erst nach 43 Minuten genug davon hatte.
Baskische Lehrstunden
Ende Juni 1937 besuchte eine baskische Auswahlmannschaft die Sowjetunion. Das Team Euskadi tingelte durch Europa, um Geld und Solidarität für die republikanische Sache im spanischen Bürgerkrieg zu mobilisieren. In die UdSSR kam es, um sich für die sowjetische Unterstützung im Bürgerkrieg zu bedanken. Sechs baskische Akteure hatten zum spanischen Team für die WM 1934 in Italien gezählt. Ihr Star war Mittelstürmer Isidro Lángara, der in diesen Jahren zu den Besten seines Fachs in Europa zählte. In den Spielzeiten 1933/34 bis 1935/36 war Lángara dreimal in Folge Torschützenkönig der spanischen Liga geworden. Für die spanische Nationalelf hatte er in zwölf Spielen 17-mal getroffen. In der Sowjetunion sollten die Basken zunächst sechsmal auftreten – zweimal in Moskau mit Lokomotive und Dynamo als Gegner und je einmal in Leningrad, Kiew, Tiflis und Minsk. Die Spiele gegen Lokomotive und in Kiew, Tiflis und Minsk wurden locker gewonnen. Gegen Dynamo ging es knapper zu. Hier siegten die Basken vor 90.000 Zuschauern mit 2:1. Die Leningrader Mannschaft konnte sogar ein Remis erzwingen.
Die Sowjets wollten noch eine letzte Chance, weshalb zwei weitere Spiele gegen Dynamo und Spartak anberaumt wurden. Dynamo verlor auch das zweite Aufeinandertreffen, während Spartak gegen nun müde Basken und mit einer gewissen Hilfestellung durch den Schiedsrichter zu einem 6:2-Sieg kam.
Spartak war damit die erste sowjetische Mannschaft, der ein Sieg gegen westeuropäische Profis gelungen war, wodurch die Popularität des Klubs weiter stieg.
Beria gegen Spartak
Die Begegnungen gegen die Basken 1937 öffneten den Sowjets die Augen, wie sehr man mittlerweile der kontinentalen Entwicklung hinterherhinkte. Für die UdSSR galt noch immer, was Walter Benjamin 1926 in seinem „Moskauer Tagebuch“ geschrieben hatte: „Unzweifelhaft weiß man in Russland über das Ausland weit weniger als man im Ausland (etwa mit Ausnahme der romanischen Länder) von Russland weiß. Man ist hier vor allem damit beschäftigt, in dem ungeheuren Territorium selbst den Kontakt der Arbeiter und Bauern unter sich herzustellen.“
Die Prawda resümierte nach der Abreise der Basken: „Es ist klar, daß eine Qualitätsverbesserung der sowjetischen Teams Spiele gegen ernsthafte Gegner erfordert. Die Spiele gegen die Basken waren von großem Nutzen für unsere Spieler.“ Der sowjetische Fußball erfuhr nun eine Modernisierung – insbesondere in taktischer Hinsicht. So wurde das einst von Herbert Chapman bei Arsenal London kreierte W-M-System übernommen. Zunächst war es vor allem Spartak, das von den Basken lernte. 1938 und 1939 wurde der Klub Meister. Dynamo dagegen schwächelte in diesen Spielzeiten – Fünfter 1938, nur Neunter 1939.
In diesen Jahren gerieten Spartak und Dynamo vollends in die Mühlen der Politik. 1936 bis 1938 rollte eine staatliche Terrorwelle über das Land, die sich gegen „Abweichler“ in Politik, Militär, Wirtschaft, Verwaltung, Wissenschaft und Kultur richtete. Schauprozesse wurden veranstaltet und Zehntausende im Zuge der „Großen Säuberungen“ ermordet. Von den 1.966 Delegierten, die Anfang 1934 am 17. Parteitag der KPdSU teilnahmen, waren zum Zeitpunkt des 18. Parteitags 1939 nur noch 30 Prozent am Leben. Der „Große Terror“ löschte fast die gesamte revolutionäre Elite von 1917 aus. An ihre Stelle traten stalintreue Apparatschiks.
Auch Dimitri Schostakowitsch geriet in die Schusslinie von Stalin und seinem Gefolge. Obwohl in der Stalin-Ära offiziell die Nummer eins der sowjetischen Komponisten, musste er wiederholt um seine Freiheit und sein Leben fürchten. Im Januar besuchte Stalin eine Aufführung von Schostakowitschs Oper „Lady Macbeth von Mzensk“, die dem Führer der Sowjetunion überhaupt nicht gefiel: „Das ist Chaos und keine Musik!“ In der Prawda erschien eine ausführliche Abrechnung mit dem Werk. „Diese ‚linke‘ Disharmonie der Oper entspringt der gleichen Quelle wie die ‚linke‘ Disharmonie in der Malerei, der Poesie, der Pädagogik und Wissenschaft. Die kleinbürgerliche ‚Neuerungssucht‘ führt zur Abkehr von der echten, authentischen Kunst, Wissenschaft und Literatur. (…) Der Komponist bediente sich der nervösen, verkrampften und hysterischen Jazzmusik, um die ‚Leidenschaft‘ seiner Helden zu zeigen. In einer Zeit, in der unsere Kritiker um den sozialistischen Realismus kämpfen, stellt das Werk von Schostakowitsch einen vulgären Naturalismus dar.“
Der Komponist suchte Zuflucht beim Fußball: „Das Stadion ist in diesem Land der einzige Ort, wo man laut die Wahrheit über das sagen kann, was man sieht.“ Katja Petrowskaja: „Diese ‚Wahrheit‘ dokumentierte er in Form einer privaten Fußballstatistik. Mit wissenschaftlichen Methoden und Klassifizierungen bilanzierte er alles fein säuberlich in Zeilen und Spalten, die ein ganzes Buch füllten: die Ergebnisse der Spiele, die Punktzahlen, das Torverhältnis und sogar die Namen der Torschützen, die damals im Sinn des Kollektivsports in kaum einer Sportzeitung erwähnt wurden.“ Schostakowitschs Fußballleidenschaft erreichte in den Jahren des „Großen Terrors“ ihren Höhepunkt. Er erwarb alle Fußballzeitschriften, deren er habhaft werden konnte. Wann immer sich die Möglichkeit bot, lauschte er den Fußballreportagen am Radio. Vom Aussehen her kannte er Hunderte von Spielern, viele auch persönlich. Schostakowitsch schrieb dem Ingenieur und verhinderten Fußballstar Valentin Kogan 53 mehrseitige Fußballbriefe, die häufig in einem größeren Kreis vorgelesen wurden, und verfasste Fußballreportagen. Katja Petrowskaja: „Seine Fußballreportagen waren offenbar so professionell, dass einige von ihnen den Weg in die wichtigsten Zeitungen des Landes fanden.“
Der berüchtigste von Stalins Apparatschiks war Lawrenti Beria, der am 25. November 1938 Leiter des Innenministeriums (NKWD) wurde. In dieser Funktion unterstanden ihm Polizei, Geheimpolizei, Miliz, die Gefängnisse und die Lager des Gulag-Systems – und auch Dynamo. „Beria war (…) eine der unzivilisiertesten Gestalten der sowjetischen Geschichte. Wenn er nicht gerade (…) Menschen in einer Säuberungsaktion beseitigte, fuhr er entweder in seiner Limousine kreuz und quer durch Moskau und griff junge Mädchen auf, oder er sah sich Fußballspiele an.“ (Simon Kuper)
Beria war ein fanatischer Fußballfan. In den 1920ern hatte er selbst gespielt und war dabei Nikolai Starostin begegnet. Starostin erinnerte sich später an einen „technisch schwachen, aber sehr groben linken Läufer“. „Die Entstehung des Gegensatzes zwischen Spartak und Dynamo fällt in ebenjene Zeit, als Lawrenti Beria den bisherigen Geheimdienstchef Nikolai Jeschow ablöste, wodurch auch der Komsomol unter Alexander Kosarew unter Druck geriet, der in diesen Jahren der wichtigste Patron von Spartak Moskau war.“ (Manfred Zeller)
Beria neidete Spartak Popularität und Erfolg. Insbesondere der Schaukampf auf dem Roten Platz und Spartaks Sieg über die Basken hatten den Geheimdienstchef eifersüchtig gemacht. Fortan ließ er nichts unversucht, um Dynamo eine Vormachtstellung zu verschaffen. Kasmir Wasilewski, Chef der Kooperative, die Spartak unterstützte, und Alexander Kosarew, Vorsitzender der kommunistischen Jugendorganisation Komsomol und einer der Architekten Spartaks, wurden im Zuge von Säuberungen verhaftet. Kosarew half auch nicht, dass er ein glühender Stalin-Verehrer war. Der Komsomol-Chef wurde am 3. Februar 1939 im Moskauer Lefortowo-Gefängnis erschossen. Auch Wasilewski wurde hingerichtet.
Beria griff zudem direkt ins Spiel ein. Im Halbfinale des sowjetischen Pokals besiegte Spartak Dynamo Tiflis durch ein umstrittenes Tor mit 1:0. Der georgische Klub verzichtete auf einen Protest. Anschließend gewann Spartak auch das Finale gegen Stalinez Leningrad mit 3:1. Für Beria war dies zu viel. Wenige Tage später entschied das Innenministerium, dass das Halbfinale Spartak gegen Tiflis wiederholt werden müsste. Der Schiedsrichter der ersten Begegnung, der ehemalige Dynamo-Spieler (!) Iwan Gorelkin, wurde verhaftet. Doch auch bei der zweiten Auflage behielt Spartak mit 3:2 die Oberhand. Thomas Urban, Journalist der Süddeutschen Zeitung und Osteuropa-Experte, zitiert Nikolai Starostin mit der Erinnerung: „Als ich zur Ehrentribüne hochblickte, sah ich, wie Beria aufsprang, seinem Sitz wütend einen Tritt verpasste und zum Ausgang stürmte.“
Im März 1942 ließ Beria die vier Starostin-Brüder verhaften. Ihnen wurde vorgeworfen, sie hätten versucht, „bourgeoise Moral in den sowjetischen Sport einzuschleppen“. Nikolai Starostin wurde zu zehn Jahren Zwangsarbeit im Gulag verurteilt. Auch seine Brüder wurden ins Lager geschickt.
Berias Kampf gegen Spartak führte dazu, dass Dynamo von vielen Fußballfans als Klub der herrschenden Ordnung und des Apparats betrachtet wurde, Spartak als Klub des Volkes. Manfred Zeller: „Spartak war sehr populär, da sich Moskauer mit dieser Stattteilmannschaft gerne identifizieren mochten, die Anfang der zwanziger Jahre gegründet und im Unterschied zu vielen anderen nicht aufgelöst wurde. Dynamo wurde ebenfalls Anfang der 1920er Jahre gegründet, 1923, war aber klar als Mannschaft der Geheimpolizei, der Tscheka, markiert.“
Boris Arkadiew, der Modernisierer
Berias Eingriffe waren aber nicht der einzige Grund, warum Dynamo 1940 wieder die Führung in der Liga übernahm. Auf dem Rasen war der Schlüssel zum Erfolg der Trainer: Boris Arkadiew, der Modernisierer des sowjetischen Fußballs schlechthin. Arkadiew trainierte Dynamo bis 1943. Von 1944 bis 1952 führte er dann den Lokalrivalen ZDKA zu einer Serie von Titeln.
Arkadiew leitete eine Art Perestroika im sowjetischen Fußball ein, indem er das W-M-System weiter verfeinerte. Man habe in die erstarrte englische Erfindung die russische Seele geblasen, schrieb der erste große Theoretiker des sowjetischen Fußballs später. Arkadiews Buch „Taktiken des Fußballs“ avancierte in den ersten Nachkriegsjahren zur „Bibel der osteuropäischen Trainerzunft“, schreibt der Taktikexperte Jonathan Wilson.
Arkadiew modifizierte das W-M-System, indem er die Raumdeckung und Positionswechsel einführte. Im Dynamo-Spiel war viel Bewegung und wurde ein präzises Passspiel gepflegt, das Passowotschka. Dabei spielte Dynamo auch häufig lange Pässe. Dynamos Fußball war taktisch diszipliniert, rational und erfolgsorientiert. Spartaks Spiel wirkte improvisierter und romantischer. Für den berühmten Kinderbuchautor Lew Abramowitsch Kassil spielte Spartak mehr mit Gefühl, während Dynamo einen „konsistenten und geplanten“ Zugang zum Spiel habe.
Vor dem Start der Spielzeit 1940 wurden die Dynamo-Spieler eingehend in die neue Taktik eingewiesen. Für Arkadiew wurden Spiele nicht dadurch entschieden, dass man die besseren Spieler besaß, sondern die bessere Taktik. Doch sein Saisonstart war bescheiden. Nach drei Spielen lautete Dynamos Bilanz: zwei Remis, eine Niederlage. Die Spieler mussten nun schriftliche Kritiken über ihr eigenes Spiel wie das ihrer Kameraden verfassen. Dadurch entwickelten sie sich stärker zu einer taktischen Einheit. Am Ende der Saison war Dynamo Meister. Die Tordifferenz war mit 44 die mit Abstand beste der Liga. Lokalrivale Spartak wurde vor 85.000 Zuschauern mit 5:1 abgekanzelt. Für einige der beteiligten Dynamo-Spieler war es das größte Spiel ihrer Karriere.
In den Jahren 1941 bis 1944 musste die Liga ihren Betrieb kriegsbedingt einstellen. Am 13. Mai 1945, also nur fünf Tage nach der deutschen Kapitulation, nahm sie den Spielbetrieb wieder auf. Die Liga wurde um zwei Vereine auf zwölf aufgestockt. Sechs kamen aus Moskau, zwei aus Leningrad und je einer aus Stalingrad, Tiflis, Minsk und Kiew.
Der Fußball erlebte nun einen Boom. Wenn Dynamo gegen die Lokalrivalen Spartak, ZDKA und Torpedo oder gegen ein Spitzenteam aus der Provinz spielte, kamen 70.000 bis 90.000 Zuschauer ins Dynamo-Stadion. Im Schnitt besuchten 45.000 die Begegnungen der ersten beiden Nachkriegsmeisterschaften.
Erster Nachkriegsmeister wurde 1945 Dynamo. Aber anschließend übernahm das mit dem Militär verbundene, inzwischen von Boris Arkadiew trainierte ZDKA Moskau das Kommando und wurde 1946 bis 1948 dreimal in Folge Meister. Bis 1961, als Dynamo Kiew den Titel gewann, kam der sowjetische Fußballmeister stets aus der Hauptstadt: Dynamo wurde bis dahin neunmal Meister, Spartak siebenmal, ZDKA/ ZDSA/ZSK-MO (heute: ZSKA) fünfmal und Torpedo einmal.*
Dynamo besucht Britannien
Nach dem Weltkrieg öffnete sich die UdSSR sportpolitisch gegenüber dem Westen und dem bürgerlichen Sportbetrieb. Der erste Klub, der auch in Westeuropa für Schlagzeilen sorgte, war Dynamo Moskau.
Im November 1945 tourte Dynamo durch Großbritannien, auf Einladung der britischen Regierung, um den gemeinsamen Sieg über Faschismus und Nationalsozialismus zu feiern. Am 13. November 1945, also 58 Jahre vor der Ankunft von Roman Abramowitsch im Londoner Westen, wurden erstmals Russen im Stadion des Chelsea Football Clubs gesichtet. Vor 85.000 Zuschauern an der Stamford Bridge trennten sich Hausherr Chelsea und Dynamo Moskau unentschieden (3:3). Dies war der erste internationale Auftritt einer sowjetischen Fußballmannschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Die englischen Zuschauer waren so begeistert, dass Tausende von ihnen nach dem Schlusspfiff aufs Spielfeld strömten und die sowjetischen Akteure auf den Schultern zu den Umkleidekabinen trugen. Der Manchester Guardian attestierte den Gästen, sie hätten auf höchstem internationalen Niveau gespielt und eigentlich einen komfortablen Sieg einfahren müssen. Auch von den Glasgow Rangers trennte man sich vor 92.000 Zuschauern im Ibrox Park unentschieden (2:2). Gegen Arsenal London feierte Dynamo im Stadion Highbury bei starkem Nebel, der eigentlich kein Spiel gestattete, einen knappen 4:3-Sieg. Allerdings war das Team der Gunners durch den Krieg geschwächt und musste mit Gastspielern auflaufen. Dynamo genehmigte dies unter der Bedingung, dass sie als Gäste den Schiedsrichter stellen dürfen. Der Dynamo-„Unparteiische“ bot eine fragwürdige Vorstellung. Er postierte beide Linienrichter auf einer Spielfeldseite, um auf der anderen Seite Schieds- und Linienrichter in Personalunion zu spielen. Cardiff City wurde mit 10:1 deklassiert. Der russische Journalist Igor Iwanow schrieb über die Reise: „Streng genommen handelte es sich mehr um eine freundschaftliche Geste mit der Absicht, die Fußballer aus dem verbündeten Land des letzten Krieges näher kennenzulernen. Man sah die Tournee mehr unter dem Blickwinkel der politischen als der sportlichen Bedeutung. Desto größer war das Erstaunen, als das Moskauer Team in seinen vier Spielen auf dem Boden Albions nicht nur nicht bezwungen wurde, sondern im Gegenteil zwei starke Klubs der 1. Englischen Division, Cardiff und Arsenal London, mit 10:1 bzw. 4:3 besiegte.“
Dynamos Spiel war noch stark von Boris Arkadiew beeinflusst, auch wenn das Team nun von Michail Jakuschin trainiert wurde. Chelseas Linksverteidiger Albert Tennant war tief beeindruckt: „Die Russen waren ständig in Bewegung. Wir konnten kaum mit denen mithalten.“ Und der ehemalige Rangers-Kapitän Davie Meiklejohn beobachtete für den Daily Record: „Es war unmöglich, die in der Stadionzeitschrift angegebenen Positionen der Spieler nachzuvollziehen. Die liefen hierhin und dorthin, ganz wie sie wollten. Besonders beeindruckend war aber, dass sie sich dabei nicht in die Quere kamen.“
Mit seinem technisch anspruchsvollen schnellen Kurzpassspiel (Passowotschka) mit kurzen Ballhaltzeiten und Positionswechseln präsentierte Dynamo einen Gegenentwurf zum starren Mainstream des englischen Fußballs, der immer noch von Physis dominiert wurde und dem Motto „Hoch und weit bringt Sicherheit“ folgte. Dass sich die Dynamo-Spieler vor ihren Trainingseinheiten und dem Anpfiff eines Spiels warm liefen und Dynamo-Coach Jakuschin eine Tafel zur Erklärung der Taktik benutzte, hinterließ ebenfalls Eindruck.*
Der englischen Presse fielen das Zusammenspiel ins Auge, die mannschaftliche Geschlossenheit, die kämpferische Einstellung und die Angriffslust der Russen. Hier stellt sich die Frage, ob es einen Zusammenhang zwischen Dynamos Spielstil und der Ideologie des Sowjetstaates gab. Brian Glanville, eine Legende des englischen Fußballjournalismus, sah im Vortrag Dynamos einen „Triumph des Sozialismus über den Individualismus, denn der Ball wurde niemals von einem Mann gehalten, sondern in einer verwirrenden Weise sofort zu einem anderen gepasst.“ Jonathan Wilson: „Man verglich Dynamos Fußball mit Schach und vermutete, dass ein Großteil des Spiels auf einstudierten Spielzügen beruhte. Die These, dass die Mannschaft im kommunistischen Fußball als Einheit und die Spieler als Rädchen darin verstanden wurden, während der britische Fußball demgegenüber mehr Individualität erlaubte, mag etwas simpel, aber deshalb nicht falsch sein.“
Dynamo-Trainer Michail Jakuschin nährte die Sichtweise vom „sozialistischen/kommunistischen Fußball“ mit Äußerungen wie: „Der sowjetische Fußball folgt dem Prinzip des Kollektivspiels.“ Die individuelle Qualität eines Stanley Matthews sei hoch, „aber bei uns steht der Kollektivfußball über dem Individualfußball.“
Ähnlich argumentierte Boris Arkadiew, der einige Jahre später in seinem Lehrbuch schrieb, die Basis der „sowjetischen Schule des Fußballspiels“ liege in der „Wissenschaft zu siegen“ und einer „Ideologie des Kollektivs“.** Dynamos Fußballer seien zwar technisch etwas schwächer gewesen als die Engländer, aber dafür hätten sie „eine mehr durchdachte, zweckmäßigere und originellere Spieltaktik als der Gegner“ gezeigt. Eine Hegemonie des „Kollektivfußballs“ über individuelle Klasse ließe sich aber auch bei vielen westlichen Mannschaften konstatieren, zumal bei englischen und deutschen. Jakuschin und Arkadiew versahen die Debatte über die richtige Gewichtung von kollektivem und individualistischem Handeln, eine Debatte, die den modernen Fußball seit seiner Erfindung verfolgte (und noch heute verfolgt), mit einem sozialistischen/ kommunistischen Vorzeichen. Dies war keine Frage des politischen Systems. Aber im totalitären System des sowjetischen Kommunismus sah sich wohl mancher Trainer genötigt, seine taktischen und strategischen Überlegungen und Spielphilosophien ideologisch zu verbrämen.
Jaschins Vorgänger: Alexander Khomich
Das Dynamo-Team, das in Großbritannien auflief, war eines ohne Schwachpunkte und mit einigen Stars. So der Läufer Michail Semitschastny und die Stürmer Konstantin Beskow und Wsewolod Bobrow – durch die Bank individuell starke Spieler, die aber in das System passten. Der Stürmer Bobrow war für die Tournee von ZDKA ausgeliehen worden und traf auf der britischen Insel sechsmal. Anschließend widmete er sich auch dem Eishockey. Fußball blieb zwar sein Hauptsport, aber die größeren Erfolge feierte er nicht auf dem Rasen, sondern auf dem Eis, wo er mit der sowjetischen Eishockeynationalmannschaft wiederholt Weltmeister wurde. Bei der WM 1954 in Stockholm wurde er sogar als bester Stürmer geehrt.
Der größte Dynamo-Star aber stand zwischen den Pfosten und war schon durch seine Spielposition ein Individualist: Alexander Khomich, den die englische Presse „Tiger“ taufte. Der Keeper maß nur 1,73 Meter, besaß aber eine gewaltige Sprungkraft. Khomich war ein Multisportler – auch als Turner, Schwimmer und Turmspringer besaß er exzellente Qualitäten. Volleyball und Schach spielte er zumindest auf einem ordentlichen Niveau. Jonathan Wilson: „Er arbeitete hart an seiner Leistung und widmete sich voll und ganz dem Training, dachte aber auch über das Spiel nach und entwickelte u. a. neue Varianten für den Abwurf von hinten heraus. (…) Auf Dynamos Gastspieltournee (…) wurde er zur Kultfigur.“ Die englische Presse verglich ihn mit der spanischen Torwartlegende Ricardo Zamora.
Helden in Blau und Weiß
Bei ihrer Rückkehr in die Heimat wurden die Dynamo-Spieler wie Helden empfangen. Auch die Staatsführung war begeistert von ihren Fußballern. Hastig wurde ein 90 Seiten starkes Büchlein produziert, das Fotos von den Spielen, Autogramme der Spieler, Cartoons und Presseberichte enthielt und reißenden Absatz fand.
Die Auftritte auf der britischen Insel trugen dazu bei, dass sich die Sicht auf Dynamo veränderte. In den 1930ern war Dynamo als Team der Geheimpolizei nicht besonders beliebt gewesen, die meisten Moskauer bevorzugten Spartak. Dies wandelte sich nun. Manfred Zeller: „Dynamo blieb die Mannschaft des Innenministeriums, aber Radio- und Fernsehübertragungen und auch internationale Erfolge überlagerten diese Zugehörigkeit für die Nachkriegsjugend etwas. Ein Gesprächspartner hat mir etwa erzählt, dass er zu Dynamo hielt, gerade weil die Mehrheit der Kinder seiner Umgebung, in der er sich nicht wohlfühlte, zu Spartak hielt. Der politische Kontext spielt da zunächst einmal gar nicht diese große Rolle.“
Zellers Interviewpartner gingen in der Regel davon aus, dass sich die Sympathien der Moskauer Fußballanhänger gleichmäßig auf Spartak und Dynamo verteilten. Der Wissenschaftler ergänzt: „Ich bin mir relativ sicher, dass das nur für die Nachkriegszeit gilt und nicht für die Vorkriegszeit, weil es einfach zuvor nicht wirklich einen Grund gab, für dieses Dynamo zu sein, als sich nach der Gründung der sowjetischen Fußballliga 1936 eine erste große Euphorie um Spartak entfachte und Dynamo der von der Geheimpolizei unterstützte Opponent war.“
*„Das goldene Zeitalter“ wurde am 26. Oktober 1930 in Leningrad aufgeführt. Die Premiere war ein großer Erfolg. Krzysztof Meyer: „Den Künstlern wurden Ovationen bereitet; außerdem musste eine Nummer nach lang anhaltendem Beifall wiederholt werden.“ Bei den Kritikern fiel das Stück indes durch. U. a. wurde der „bourgeoise Stil in den an eine Revue erinnernden Teilen“ bemängelt. „Das goldene Zeitalter“ wurde nur in wenigen anderen Städten aufgeführt und in Leningrad nach einer Saison abgesetzt. Dabei gehörte „Das goldene Zeitalter“ zu den eher opportunistischen Werken Schostakowitschs, der auf einem schmalen Grat wanderte: Der Komponist sah sich immer wieder zur Einordnung gezwungen, wollte aber gleichzeitig seine Kunst nicht korrumpieren lassen.
*Dynamo ist heute eine gesamtrussische Fitness- und Sportgesellschaft mit Sitz in Moskau. Diese hat Tochtergesellschaften im Ausland, u. a. in Armenien, Weißrussland, Georgien und der Ukraine. Viele der Dynamo-Klubs aus der Zeit der UdSSR sind heute eigenständig. So auch Dynamo Moskau, dessen Präsident seit 2013 der russisch-finnische Oligarch Boris Romanowitsch Rotenberg ist. Mit seinem Bruder Arkadi besitzt Rotenberg die Unternehmensgruppe StroyGazMontazh, die Gazproms Hauptauftragnehmer für den Bau von Öl- und Gasleitungen ist. Außerdem gründeten die Rotenberg-Brüder die SMP-Bank, die bis 2013 in den Kreis der 40 größten Finanzinstitute Russlands aufstieg. Boris Rotenberg gehört zur sogenannten St.-Petersburg-Connection, dem Machtzirkel Wladimir Putins. In der Saison 2015/16 stieg Dynamo erstmals in seiner Geschichte in die Zweitklassigkeit ab.
*Der Klub der Armee änderte wiederholt seinen Namen: 1928–50 ZDKA (Sportklub des zentralen Hauses der Roten Armee), 1951–56 ZDSA (Sportklub des zentralen Hauses der sowjetischen Armee), 1957–59 ZSKA-MO (Zentraler Sportklub des Ministeriums der Verteidigung, seit 1960 ZSKA (Zentraler Sportklub der Armee).
*Nach den Vorführungen des Dynamo-Teams waren die Queen’s Park Rangers (London) möglicherweise der erste englische Klub, der das Warmlaufen vor dem Anpfiff eines Spiels praktizierte. Walter Winterbottom, der 1946 erster englischer Nationaltrainer wurde, übernahm von Jakuschin die Taktiktafel. Der Modernisierer wurde dafür in der Heimat aber auch als „Kreidefinger“ verlacht.
**Nach der England-Tour kannte das Selbstlob kaum Grenzen. Arkadiew behauptete, Dynamos Auftritte hätten dazu geführt, dass man seither im Ausland von der „sowjetischen Schule des Fußballspiels“ spreche. Arkadiew und die sowjetische Presse erweckten den Eindruck, als sei es nur noch eine Frage der Zeit, wann der sowjetische Fußball an der Spitze des Weltfußballs stehen würde.